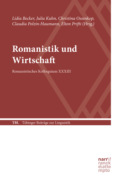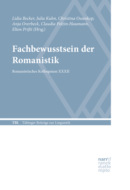Kitabı oku: «Wikipedia und der Wandel der Enzyklopädiesprache», sayfa 6
Die Ausführungen zum Wandel von Diskurstraditionendiskurstraditioneller Wandel ergeben, dass diese in den größeren Rahmen der kulturellen Traditionenkulturelle Tradition eingeordnet werden können und folglich dem Wandel unterliegen. Ein wesentlicher Faktor, der diskurstraditionelle Dynamikdiskurstraditionelle Dynamik auslösen kann, sind gesellschaftliche und insbesondere mediale Umbrüche. Die Ausführungen von Koch (1997), Oesterreicher (1997) und einige Beispielstudien erlauben Überlegungen dazu, welcher Art diese medialen Veränderungen sein müssen, damit neue Diskurstraditionen entstehen und deuten auf graduelle Unterschiede hin, die von der Realisierung derselben Diskurstradition in einem anderen Medium bis hin zu konzeptionellen Verschiebungen und zur Ausbildung einer neuen Diskurstradition reichen. In diachroner Sicht entstehen neue Diskurstraditionen durch die Abänderung eines Vorläufers, von dem sie sich nach und nach entfernen. Ungeachtet aller medialen Einflüsse auf Diskurstraditionen bleibt zusätzlich zu berücksichtigen, ob kulturspezifische Ausprägungen in den Neuen Medien eine Vereinheitlichung erfahren, oder ob diese erhalten bleiben.
3.1.3 Zwischenresümee
Um die Transformation von EnzyklopädieartikelnEnzyklopädieartikel in WikipediaWikipedia zu untersuchen, wird das Konzept „DiskurstraditionDiskurstradition“ fruchtbar gemacht, das herausstellt, dass Diskurse nicht nur spontane Realisierungen von Sprache sind, sondern auch Konventionen folgen. Je nach Komplexitätsgrad können Diskurstraditionen von einfachen FormelnFormel über Text-/DiskurstraditionenDiskurstradition bis hin zu DiskursuniversenDiskursuniversum reichen. Die Konventionen, die die Ausprägung diskursiver MusterDiskursmuster steuern, sind gänzlich anderer Natur als die Regeln einer Einzelsprache. Im Gegensatz zu SprachregelnSprachregel sind DiskursregelnDiskursregel stets auf konkrete KommunikationssituationenKommunikationssituation bezogen, erlauben aber auch große Freiheitsgrade bei der Realisierung eines Musters. Sie sind zudem häufig sprachübergreifend wirksam. An diesen Eigenschaften zeigt sich bereits, dass Diskurstraditionen in Verbindung mit universellen Parametern der Kommunikation einerseits und mit gesellschaftlich-kulturellen Normengesellschaftlich-kulturelle Norm andererseits stehen. Eine DiskurstraditionDiskurstradition lässt sich somit nicht ausschließlich aus der Mischung der kommunikativen ParameterwerteParameterwert erklären, sondern diese erfahren in der Regel eine mehr oder weniger starke kulturelle Anpassung. Die DiskursregelnDiskursregel ergeben sich folglich aus einem Zusammenspiel der kommunikativen Parameterwerte mit kulturellen Normen und selegieren ihrerseits die jeweils angemessenen sprachlichen und nichtsprachlichen Gestaltungsmittel. Rekurrente Anforderungen führen zur wiederholten Auswahl derselben Mittel, wodurch sich Muster verfestigen.
Wandeln sich jedoch die kommunikativen oder die kulturellen Bedingungen, so kann sich die Auswahl der Gestaltungselemente verändern. Als Spezialfall einer kulturellen Tradition reagieren auch Diskurstraditionen auf historische Umbrüche, die häufig neue kommunikative Erfordernisse mit sich bringen. Insbesondere mediale Umbrüche machen eine Veränderung der kommunikativen Praktiken erforderlich, was sich auch daran zeigt, dass die Entstehung des Internets und insbesondere der Web 2.0Web 2.0-Technologie eine Reihe neuer Diskurstraditionen hervorbringt. Allerdings sind nicht alle digitalen DiskurstraditionenDiskurstradition– digitale völlig neu entstanden, sondern sie haben sich häufig aus analogen Vorgängern durch sukzessive Anpassungen an das neue TrägermediumTrägermedium entwickelt. Bei der Entscheidung, ob es sich um eine neue Diskurstradition handelt, ist folglich der Abstand zur analogen DiskurstraditionDiskurstradition– analoge entscheidend. Dabei ist abzuwägen, ob es sich um eine Variante derselben Diskurstradition in einem neuen Medium handelt, oder ob die Verschiebungen in der KonzeptionKonzeption der Diskurstradition so gravierend sind, dass eine neue Diskurstradition vorliegt. Die Konzeption einer Diskurstradition betrifft sowohl Veränderungen in der Mischung der kommunikativen Parameterwerte als auch eine veränderte Auswahl sprachlicher Mittel, die an der Textoberfläche sichtbar wird. Dass es dennoch nicht ganz einfach ist, zu entscheiden, ob eine neue Diskurstradition vorliegt oder nicht, zeigen die Befunde in Herring (2013: 15) zu Wikipedia. Die kollaborativekollaborativ Erstellung von EnzyklopädieartikelnEnzyklopädieartikel in einem WikiWiki schätzt sie als völlig neue kommunikative Praktik ein, die jedoch in diametralem Gegensatz zu ihrem Befund steht, dass sich das Produkt dieses Prozesses, die WikipediaartikelWikipediaartikel, kaum von gedruckten EnzyklopädieartikelnEnzyklopädieartikel– gedruckter unterscheiden.
3.2 Gedruckte Enzyklopädieartikel
Um nun Veränderungen in Enzyklopädieartikeln nachzugehen, die kollaborativ in Wikipedia produziert werden, ist es notwendig, zunächst die Konventionen gedruckter Enzyklopädieartikel zu rekonstruieren, um diese anschließend mit den Konventionen der Wikipediaartikel vergleichen zu können. Dazu wird der gedruckte Enzyklopädieartikel in einem ersten Schritt von benachbarten Diskurstraditionen abgegrenzt. Er wird anschließend hinsichtlich der Kommunikationssituation, des Artikelaufbaus und der sprachlich-stilistischen Mittel auf der Basis bisheriger Forschungsergebnisse charakterisiert.
3.2.1 Abgrenzung zu benachbarten Diskurstraditionen
In enger Verbindung zur Diskurstradition EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel stehen der LexikonartikelLexikonartikel, der WörterbuchartikelWörterbuchartikel und der Eintrag im enzyklopädischen Lexikonenzyklopädisches Lexikon. Während die Bezeichnung Lexikonartikel teilweise als Sammelbezeichnung für Einträge in verschiedenen Arten von Nachschlagewerken fungiert, beziehen sich die Bezeichnungen Wörterbuchartikel, Eintrag im enzyklopädischen Lexikon und Enzyklopädieartikel auf unterschiedliche Diskurstraditionen, die jedoch nicht immer klar voneinander abgrenzbar sind. In dieser Trias bilden die Diskurstraditionen WörterbuchartikelWörterbuchartikel und EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel zwei Extrempole. Der Eintrag im enzyklopädischen Lexikon, der insbesondere im romanischsprachigen Raum genutzt wird, stellt eine Mischform dar. Verglichen werden hier lediglich Prototypen, wobei im Bereich des SprachwörterbuchsWörterbuch– Sprach-~ der monolinguale Definitionsartikel mit rein sprachlicher InformationInformation– sprachliche als WörterbuchartikelWörterbuchartikel angesehen wird, und im Bereich der EnzyklopädieEnzyklopädie ein von der Textur her an der Encyclopédie geschulter Artikel betrachtet wird.
| Merkmal | Wörterbuchartikel | Enzyklopädieartikel |
| Semiotischer Status des Lemmas | Lemma als signifiant | Lemma verweist auf ein Konzept |
| Mediostruktur | Konzentration auf wörterbuchinterne Verweise externe Verweise auf Quellen zu Beispielangaben | interne und externe Verweise weiterführende externe Hinweise zur Vertiefung des Themas |
| Mikrostruktur | standardisierte Anzahl, Art, Reihenfolge der Kommentare programmierte Abfolge von Informationen (z.B. Formkommentar, semantischer Kommentar, etc.) | nicht-standardisierter Textaufbau thematische Entfaltung nach begrifflichen Aspekten (z.B. Oberbegriff/Unterbegriff, Chronologie) |
| Datendistribution | Angaben zum Lemma | Angaben zum Lemma weitere enzyklopädische Informationen zum Themenbereich |
| Adressierung der Angaben | Adressierung an das Lemma | Adressierung an andere Bezugswörter im Text möglich |
| Kondensation | nach standardisierten Regeln kondensierte Textfragmente | schwach bis nicht kondensierter Fließtext |
| Funktionalisierung zitierter Textpassagen | Angabe zur Bedeutung und Verwendung des Wortes | enzyklopädische Zusatzinformation zum Themengebiet Verifikation von Fakten |
| Illustration | keine | häufig |
| Inhalt | sprachliche Information | enzyklopädische Information |
Tabelle 1: Strukturelle Unterschiede zwischen Wörterbuch- und Enzyklopädieartikeln (cf. Lara 1989; Rey-Debove 1971; Schafroth 2014; Wiegand 2003, 2002, 1989a, 1989b; Wolski 1989)
Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Artikeltypen liegt darin, dass der Eintrag im SprachwörterbuchWörterbuch– Sprach-~ vor allem sprachliche InformationenInformation– sprachliche bereitstellen soll, der EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel jedoch Wissen über die Welt, also enzyklopädische InformationInformation– enzyklopädische. Da Enzyklopädien als Referenzwerke angesehen werden, wird erwartet, dass ein EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel in neutraler, informierender Weise ein gesichertes Wissen über das im LemmaLemma angegebene Thema vermittelt (cf. d’Achille/Proietti 2011: 93). Aus diesen unterschiedlichen Funktionen ergeben sich weitere Differenzen zwischen den beiden Diskurstraditionen: So fungiert das Lemma im WörterbuchartikelWörterbuchartikel als Wortform auf der signifiant-Ebene, zu dessen sprachlichen Eigenschaften Informationen in einem standardisierten und kondensierten Programm von Angaben gegeben werden, die einen strengen Bezug zum Lemma haben. Es geht hierbei um Angaben zur Form, Bedeutung und Verwendung eines Wortes, die allenfalls an Beispielangaben illustriert werden. Im Gegensatz dazu steht beim EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel die enzyklopädische Information im Vordergrund. Dementsprechend fungiert das Lemma als Etikett für einen ganzen Themenbereich und verweist auf das mit dem Ausdruck verbundene gedankliche Konzept, das im Artikel in seinen Teilaspekten sprachlich dargestellt wird. Interne Verweise strukturieren und verknüpfen die Informationen, externe Verweise dienen der Verifikation der dargebotenen Fakten und der zusätzlichen Vertiefung. Der Artikelaufbau ist insgesamt wenig standardisiert, kaum kondensiert und hochgradig themenabhängig, da die Textgliederung eher begrifflichen Aspekten wie Ober- und Unterbegriffen oder der Ereignischronologie folgt. Die Angaben können sowohl Teilthemen des Oberthemas als auch verwandte Aspekte in Textteilen ausbauen, weswegen nicht alle Aussagen auf das Lemma bezogen sind.
3.2.2 Kommunikationssituation
Die Kommunikationssituation, in die ein gedruckter Enzyklopädieartikel eingebettet ist, lässt sich mithilfe der Parameter nach Koch/Oesterreicher (2011: 13) charakterisieren, die durch weitere Parameter ergänzt werden. Es lässt sich sagen, dass die Gesamtheit der Parameterwerte des gedruckten Enzyklopädieartikels darauf hinweisen, dass es sich um eine Diskurstradition der kommunikativen Distanzkommunikative Distanz handelt (cf. Reutner 2013b: 237). Gedruckte Enzyklopädieartikel werden für ein breites Publikum publiziert, weswegen es sich um ein Produkt der öffentlichen KommunikationÖffentlichkeit, ja sogar der Massenkommunikation handelt, wobei jedoch der Zugang in der Regel käuflich erworben werden muss. In einigen Enzyklopädien haben die Artikel einen einzigen Verfasser und die von Hoffmann beschriebene Kommunikationssituation „einer an mehrere“ (Hoffmann 1988: 156) trifft zu. Jedoch werden auch in den PrintenzyklopädienEnzyklopädie– Print-~ Artikel von mehreren Verfassern erstellt, die aufgrund einer fehlenden Signatur anonym bleiben können (cf. d’Achille/Proietti 2011: 93). Diese Praxis deutet bereits auf das Spezifikum von gedruckten Enzyklopädieartikeln hin, dass sich Verfasser und Publikum in der Regel nicht kennen, wobei der Verfasser eines Enzyklopädieartikels stark hinter den Informationen zurücktritt. Da es das Ziel heutiger Enzyklopädieartikel ist, sachlich-neutral Informationen zu einem Thema bereitzustellen, ist eine emotionaleEmotionalität Beteiligung der Kommunikationspartner unerwünscht. Dies schließt allerdings nicht aus, dass es auch in gedruckten EnzyklopädieartikelnEnzyklopädieartikel– gedruckter stellenweise zu emotionalen Äußerungen kommen kann. Die Kommunikationssituation ist außerdem durch die zeitliche und räumliche Trennung des Autors vom Leser geprägt, mit der weitere Merkmale von Situationen der kommunikativen Distanzkommunikative Distanz verbunden sind. So ist die Kommunikationssituation zudem durch Handlungs- und Situationsentbindung gekennzeichnet. Im Enzyklopädieartikel wird weder auf den situativen Kontext des Autors noch auf den des Lesers Bezug genommen, was auch damit zusammenhängt, dass in einem Enzyklopädieartikel ein Wissen kommuniziert werden soll, das situationsunabhängig gültig ist. Aus diesem Anspruch folgt, dass die Gegenstände, über die gesprochen wird, sowohl vom Sprecher als auch vom Rezipienten entfernt sind, weswegen referenzielle Distanz vorherrscht. Ein gedruckter EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel– gedruckter wird ausschließlich von einem Autor produziert und vom Leser passiv rezipiert, ohne dass dieser den Diskurs mitgestalten könnte. Es besteht folglich keine Möglichkeit zur Kooperation. Der Text ist strikt monologisch und es ist kein Rollenwechsel zwischen Sprecher und Rezipient möglich. Der Grad der SpontaneitätSpontaneität ist äußerst gering, da die Abfassung eines Enzyklopädieartikels redaktionellen Vorgaben zu folgen hat, sorgfältig geplant ist, und das Produkt zudem von einer Redaktion überprüft wird. Aufgrund der Statik der PrintenzyklopädieEnzyklopädie– Print-~ können zudem keine spontanen Abänderungen gemacht werden (cf. Reutner 2013b: 236). Das Thema ist durch das Stichwort vorgegeben und kann innerhalb dieses Rahmens entwickelt werden. Die thematische Struktur eines EnzyklopädieartikelsEnzyklopädieartikel ist nicht so stark normiert wie die eines WörterbuchartikelsWörterbuchartikel, allerdings werden allzu große Abschweifungen vom Thema aufgrund des Platzmangels vermieden. Zudem wird das Thema häufig zentral von der Redaktion vorgegeben und der Artikel muss sich in die Makrostruktur der gesamten Enzyklopädie einfügen (cf. Reutner 2013b: 232). Die Aufnahme eines Gegenstandes als Stichwort zeugt von der besonderen enzyklopädischen Relevanz des Themas (cf. Fandrych/Thurmair 2011: 92).
Zusätzlich zu den Parameterwerten nach Koch/Oesterreicher (2011: 13) kann für die Kommunikationssituation der Diskurstradition EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel ein fachliches und somit auch hierarchisches Gefälle zwischen Autoren und Lesern kennzeichnend sein. Dies trifft im Gegensatz zur Fachenzyklopädie, die häufig ausschließlich für Experten konzipiert ist, insbesondere auf die Artikel allgemeiner Enzyklopädien zu, die von ausgewiesenen Experten ihres Fachs verfasst werden und deren Leserschaft äußerst heterogen ist (cf. Fandrych/Thurmair 2011: 90; Hoffmann 1988: 132). Somit richten sich die Artikel der UniversalenzyklopädienEnzyklopädie– Universal-~ zwar in den meisten Fällen an Nicht-Fachleute, was jedoch die Konsultation von Experten nicht ausschließt, zumal die vorausgesetzten fachlichen und sprachlichen Kompetenzen „vergleichsweise hoch“ (Fandrych/Thurmair 2011: 91) sind. Trotz dieser Anforderungen sind EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel in UniversalenzyklopädienEnzyklopädie– Universal-~, falls sie überhaupt einen fachlichen Gegenstand behandeln, höchstens als FachtexteFachtext der äußersten fachlichen Schicht einzuordnen (cf. Hoffmann 1988: 136), da sie in der Regel keine Originalarbeiten, sondern resümierend als Tertiärwerke einen gesicherten Kenntnisstand vermitteln. Die Nachschlagewerke dienen häufig dazu, sich einen ersten Überblick über einen Gegenstand zu verschaffen und fungieren als Referenzwerke, die ein gesichertes Wissen bieten, das von anerkannten Experten präsentiert wird (cf. Hoffmann 1988: 156). Da der Verfasser als Garant für das präsentierte Wissen fungiert, sind die Artikel zumeist signiert. UniversalenzyklopädienEnzyklopädie– Universal-~ sind somit Nachschlagewerke mit didaktischem Charakter, deren zusammenfassende und systematisierende Darbietung von Wissen (cf. Fandrych/Thurmair 2011: 91) eine punktuelle und schnelle Konsultation ermöglicht.
3.2.3 Artikelaufbau
Während die Werte der kommunikativen Parameter für einzelne Exemplare gedruckter EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel– gedruckter sehr einheitlich ausfallen, ergibt die Analyse des Artikelaufbaus an konkreten Texten eine größere Variation. Diese wird durch das gewählte Stichwort, den Fachlichkeitsgrad und die Ausführlichkeit des Werks, aber auch durch die jeweilige Sprach- sowie Diskursgemeinschaft beeinflusst, durch die ein Artikel erstellt wird.
Vorwiegend deutsche Artikel untersuchen Hoffmann (1988) und Fandrych/Thurmair (2011). In seiner Studie wählt Hoffmann (1988) deutsche und russische Artikel aus Universalenzyklopädien1 aus. Für sein Korpus stellt er einen relativ schlichten Artikelaufbau nach dem Muster StichwortStichwort – DefinitionDefinition – Merkmal 1 – Merkmal 2 – Merkmal n fest. Allerdings ergeben sich je nach Artikel unterschiedliche Variationen dieses Grundschemas, weswegen Hoffmann bei seinen Analysen anstelle der Definition häufig nur von allgemeiner Charakteristik spricht, die der Anzahl von spezifischen Merkmalen gegenübersteht (cf. Hoffmann 1988: 142). Welche Merkmale genannt werden, hängt davon ab, welches KonzeptKonzept das Stichwort versprachlicht und welche weiteren Konzepte mit diesem verknüpft sind. Die Teiltexte stehen einerseits in einer hierarchischen Beziehung zum Stichwort, andererseits können Teilthemen weitere Unterthemen enthalten, die wiederum von diesen Oberthemen abhängig sind.2 Für einen Artikel zum Lemmatyp Fließendes Gewässer analysiert Hoffmann beispielsweise den Aufbau: AC: Allgemeine Charakteristik, SM1: Verlauf, SM2: Wasserkraftnutzung, SM3: Nebenflüsse, SM4: Wasserwege und Kanalsystem (cf. Hoffmann 1988: 142).
Eine Mischung aus wenigen obligatorischen und vielen fakultativen Texteinheiten analysieren Fandrych/Thurmair (2011: 95) in ihrem deutschsprachigen Korpus aus Lexikonartikeln.3 Als obligatorische Elemente identifizieren sie das StichwortStichwort und eine allgemeine Charakterisierung, „die meist aus einer Definition, teilweise aber auch in der Angabe von Synonymen oder anderen sprachlichen Charakterisierungen besteht“ (Fandrych/Thurmair 2011: 95). Fakultativ sind sprachbezogene Angaben zum Stichwort wie Aussprache, Herkunft und der Artikel bei Substantiven. Ebenso fakultativ ist eine Rahmensetzung, in der „Angaben zum Sach-/Fachbereich, in dem der Begriff verwendet wird“ (Fandrych/Thurmair 2011: 95), gemacht werden. Zudem wird das behandelte Konzept fachlich, gesellschaftlich und historisch eingeordnet sowie hinsichtlich wichtiger Eigenschaften charakterisiert. In einer begrifflichen Einordnung können Bezüge zu Nachbarbegriffen erläutert werden und das Konzept, auf das sich das Stichwort bezieht, in ein Begriffsnetz eingeordnet werden. Das Konzept kann zudem anhand von Beispielen erläutert werden. Am Ende des Artikels stehen Verweise und weiterführende Literaturangaben (cf. Fandrych/Thurmair 2011: 95).
Einen Vergleich zwischen deutschen und englischen Artikeln aus Universal enzyklopädien zu Stichwörtern aus dem Bereich der Technik4 nimmt Göpferich (1995) vor. Als häufige Elemente benennt sie die Elemente Stichwort – Definition – Überblick über das Begriffssystem – Explikation und Beispiele – Anwendung/historischer Überblick – Verweise – bibliografische Angaben – Anhang (cf. Göpferich 1995: 296–299). Dabei ist das StichwortStichwort durch Fettdruck hervorgehoben, die DefinitionDefinition besteht zumeist nur aus einem Satz und folgt in neun von zehn Fällen dem klassischen Definitionsverfahren durch die Angabe des genus proximum und der differentia specifica (cf. Göpferich 1995: 297). Auf die Definition folgt in vielen deutschen Artikeln ein Überblick über das Begriffssystem, wobei die unmittelbaren Unterbegriffe des Definiendums aufgezählt werden. In englischen Artikeln werden entweder nur sehr wenige oder keinerlei verwandte Begriffe aufgezählt (cf. Göpferich 1995: 298). Anschließend werden die Begriffe unter Angabe von Beispielen erläutert:
In den Explikationen zu Baugruppen werden die einzelnen Komponenten aufgezählt und ihr Zusammenwirken beschrieben; bei Verfahren werden in chronologischer Reihenfolge die Einzelschritte genannt und erklärt (Göpferich 1995: 298).
Zusätzlich können die Anwendungsgebiete beschrieben und ein historischer Überblick gegeben werden, was teilweise in Unterabschnitten mit eigenen Überschriften geschieht. Innerhalb der Artikel wird in Form von Pfeilen auf die Einträge verwandter Begriffe verwiesen, insbesondere, wenn die Stichwörter im Artikel vorkommen und in der Enzyklopädie Einträge zu diesen Stichwörtern existieren. Am Ende der Artikel befinden sich zudem bibliografische Angaben, die die Quellen der Informationen offenlegen und eine weiterführende Lektüre ermöglichen. In einigen Fällen treten Anhänge mit Umrechnungstabellen, Abkürzungsverzeichnissen oder Periodensystemen auf (cf. Göpferich 1995: 298).
Ausschließlich englische Artikel werden von Gläser (1990) und Lauer (1986) analysiert. Zudem fokussieren sich die beiden Studien auf Artikel in englischen FachlexikaLexikon– Fach-~ und FachenzyklopädienEnzyklopädie– Fach-~. Dabei unterscheidet Gläser zwischen einem eher knapp gehaltenen Eintrag in einem Fachlexikon und einem ausführlicheren Eintrag in einer Fachenzyklopädie. Während das
Fachlexikon in der Regel Stichwortartikel enthält, die sich durch eine hohe Informationsdichte und Sprachökonomie auszeichnen, beinhaltet die Fachenzyklopädie längere Artikel, die in der Art einer wissenschaftlichen Abhandlung durch Zwischenüberschriften gegliedert und mit einer Zusammenfassung, einem Anmerkungsapparat und einer Bibliographie versehen sind (Gläser 1990: 107).
Anhand von Artikeln aus 17 englischen Fachlexika5 stellt Gläser (1990: 98) den Aufbau Stichwort – Definition – Explikation/phänomenologische Beschreibung – Beispiele – visueller Code – Literaturhinweise fest. Obligatorisch sind insbesondere in kürzer gehaltenen Fachlexika lediglich StichwortStichwort und DefinitionDefinition. Der in Fachlexika „registrierte, systematisierte, definierte und z.T. auch normierte Fachwortschatz spiegelt die innere Systematik eines fachlichen Begriffssystems durch Verweise auf Hyperonyme, Hyponyme, Synonyme oder verwandte Termini wider“ (Gläser 1990: 107). In einigen Fällen werden metasprachliche Einschätzungen zu den Termini gegeben, „wenn z.B. ein Terminus zu vage oder mehrdeutig gefaßt ist, eine Vielzahl von Synonymen aufweist, wenn er dem veränderten Begriffsinhalt nicht mehr entspricht oder im Veralten begriffen ist“ (Gläser 1990: 93). Die Definition in Fachlexika folgt häufig dem Schema „Oberbegriff + artbildender Unterschied“ (Gläser 1990: 99), weil der Fachexperte „Realdefinitionen braucht, die gerade die Eigenmerkmale eines Begriffs explizieren“ (Gläser 1990: 99). Umschreibungen sind seltener zu finden. Allerdings lassen sich je nach fachlicher Zugehörigkeit des Artikels auch andere Definitionsverfahren feststellen:
Die hier mit Absicht reichhaltig angeführten Belege für den Teiltext ʻDefinitionʼ in Lexikonartikeln ganz unterschiedlicher Fachgebiete verdeutlichen zugleich verschiedene Herangehensweisen an die Bestimmung von Fachbegriffen. Die Herkunft eines Terminus ist zwar für das philologische Verständnis einer Bezeichnung aufschlußreich, bietet aber nur selten den semantischen Zugang zu einem Fachbegriff, dessen Inhalt und Umfang gerade durch seine Beziehungen innerhalb eines Begriffssystems bestimmt werden. Für den Mediziner ist dagegen ein Hinweis auf die griechischen oder lateinischen Terminuselemente hilfreich, weil diese in der Fachterminologie produktiven Wortbildungsmittel auch international üblich sind und eine eindeutige Interpretation eines Fachbegriffs ermöglichen (Gläser 1990: 101).
Auf die Definition folgt eine Explikation oder auch phänomenologische Beschreibung, welche Teilaspekte der allgemeinen Definition klassifiziert und erläutert (cf. Gläser 1990: 99). Zudem illustrieren Beispiele und Grafiken Aspekte der allgemeinen Definition. Am Ende von Artikeln in Fachlexika finden sich häufig Hinweise für eine vertiefende Lektüre (cf. Gläser 1990: 98). Einen komplexeren Aufbau weisen die Artikel6 aus der von Lauer (1986) untersuchten FachenzyklopädieEnzyklopädie– Fach-~ International Encyclopedia of Psychiatry, Psychology, Psychoanalysis and Neurology (1977) auf. Als obligatorisch stellt sie die Elemente Stichwort – Stichwortartikel – weiterführende Bibliografie – Name des Autors fest. Fakultativ lässt sich ein Glossar verwandter FachterminiTerminus dem Artikel voranstellen und die einzelnen Artikelabschnitte können am Ende in einer Zusammenfassung resümiert werden. Am Ende des Artikels einer Fachenzyklopädie finden sich außerdem häufig eine Bibliografie und Verweise auf weitere Literatur. Zudem wird der Name des Verfassers genannt. Artikel in Fachenzyklopädien sind somit Handbuchartikeln ähnlich, was sich auch daran zeigt, dass einzelne Abschnitte häufig durch Überschriften und Absätze separiert sind (cf. Lauer 1986: 98).
Der Aufbau von Artikeln in französischen PrintenzyklopädienEnzyklopädie– Print-~ wird in Mochet/O’Neil (2000) analysiert, wobei diachron die Entwicklung vom 19. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Werken verfolgt wird. Zur Analyse wird der Artikel croisade aus La Grande Encyclopédie André Berthelot (1855), Grand dictionnaire universel du XIXe siècle (1869), Nouveau Larousse illustré, Grand Larousse universel (1982–1995), Dictionnaire encyclopédique Quillet, Encyclopédie Universalis „corpus“ (1995), Axis: l’univers documentaire und der CD-ROM-Version Encyclopédie Hachette Multimédia untersucht. Dabei zeigt sich eine Tendenz zur ausführlichen Darstellung, die zwischen einer und maximal sieben Seiten schwankt. Der Artikel enthält in allen Werken außer Quillet eine Einführung, auf die eine chronologische Darstellung der Ereignisse folgt. Dabei setzen die Werke jedoch sehr individuelle Schwerpunkte, was die Darstellung einzelner Themen betrifft. Am Ende des Artikels befindet sich in allen Werken außer Larousse universel eine Zusammenfassung. In fünf der acht ausgewählten Werke wird am Ende des Kapitels eine Einschätzung des Ereignisses in Form eines bilan durch den Autor vorgenommen. In allen Werken außer Axis wird am Ende des Artikels eine Bibliografie angefügt. Eine Signatur des Autors weisen dagegen lediglich die Artikel in La Grande Encyclopédie André Berthelot und in Encyclopaedia Universalis auf. Auffällig ist außerdem, dass lediglich die jüngsten beiden EnzyklopädienEnzyklopädie, Universalis und Axis, über Inhaltsverzeichnisse verfügen. Ebenso ist die Anreicherung der Artikel mit Bildern, Karten und Kästen eine jüngere Erscheinung, die mit dem Nouveau Larousse illustré einsetzt und in der Folge immer stärker genutzt wird. Da das Korpus nicht nur reine Enzyklopädien, sondern auch enzyklopädische Lexikaenzyklopädisches Lexikon enthält, lässt sich in den Werken des Hauses Larousse und im Dictionnaire encyclopédique Quillet ein Teil mit sprachlichen Informationen zum StichwortStichwort feststellen, der für diese Diskurstradition typisch ist. Insgesamt fällt auf, dass die Artikel aus den untersuchten französischen Enzyklopädien und enzyklopädischen Lexika sich im Gegensatz zu einem kurzen Lexikonartikel durch eine diskursive Darstellung nach dem Schema Einleitung – Darstellung – Zusammenfassung auszeichnen. Am Artikelende werden zudem Einschätzungen der Experten und ausführliche Bibliografien angegeben.
Einen anderen Eindruck gewinnen d’Achille/Proietti (2011) anhand des von ihm untersuchten Korpus von Artikeln aus gedruckten italienischen Enzyklopädien. Ebenso wie die französischen Artikel tragen diese selten die Signatur des Autors. Allerdings sind die Artikel insgesamt kürzer gehalten und Fußnoten fehlen zumeist (cf. d’Achille/Proietti 2011: 94).
Die Ergebnisse der ausgewählten Studien zeigen, dass Einträge in Referenzwerken eine eigene Diskurstradition darstellen, die in einen ganzen Textverbund aus weiteren Artikeln, aber auch aus Hilfstexten, wie einem Vorwort, oder einen Index eingebettet sind. Der Zugriff auf die einzelnen Artikel erfolgt über die alphabetische MakrostrukturMakrostruktur– alphabetische, einzelne Artikel sind häufig über Verweise miteinander verknüpft. Die Artikel selbst können zum einen in der eher knappen Form eines Lexikoneintrags und zum anderen in der ausführlichen Form eines EnzyklopädieartikelsEnzyklopädieartikel vorliegen, wobei die Grenzen zwischen diesen beiden Diskurstraditionen fließend sind. In der kürzesten Variante besteht ein Artikel lediglich aus einem grafisch hervorgehobenen StichwortStichwort und einer allgemeinen Charakterisierung, die entweder in Form einer klassischen Definition, aber auch in Form einer Umschreibung des Stichworts vorliegen kann. In längeren Varianten werden mehrere Teilaspekte des Themas in eigenen Kapiteln entfaltet. Dabei versprachlicht das StichwortStichwort ein Konzept und in den Teilkapiteln werden weitere Konzepte beleuchtet, die einen realen Bezug zum übergeordneten Konzept des Artikels haben. Ein EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel versprachlicht ein ganzes Netz aus Begriffen und setzt diese in Relation zueinander. Zusätzlich werden ausführliche EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel durch weitere Teiltexte wie die Angabe des Wissensgebiets, ein Glossar, Tabellen, Quellenangaben, weiterführende Literaturhinweise und eine Signatur ergänzt.