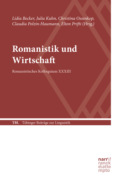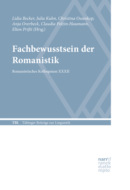Kitabı oku: «Wikipedia und der Wandel der Enzyklopädiesprache», sayfa 7
Insbesondere Artikel in den untersuchten Fachlexika und -enzyklopädien zeichnen sich durch einen umfangreichen wissenschaftlichen Apparat aus und sind häufiger von den Experten signiert, weswegen sie eine Nähe zu Handbuchartikeln aufweisen. Diese Tendenz kann auch für fachsprachliche Stichwörter in UniversalenzyklopädienEnzyklopädie– Universal-~ festgestellt werden.
Es ergeben sich jedoch nicht nur Unterschiede zwischen Artikeln in Fach- und UniversalenzyklopädienEnzyklopädie– Universal-~ und zwischen eher allgemeinsprachlichen und eher fachsprachlichen Stichwörtern, sondern die auftretenden Textteile variieren auch danach, in welcher Sprache der Artikel verfasst ist. So fällt die ausführliche Präsentation von Inhalten in französischen Enzyklopädien auf, die Elemente wie Inhaltsverzeichnisse, einführende Resümees, Zusammenfassungen, Bibliografien und in einigen Fällen Abschnitte mit Expertenmeinungen enthalten. In italienischen Enzyklopädien sind die Artikel dagegen kürzer gehalten und häufig fehlen Fußnoten.
3.2.4 Sprachlich-stilistische Merkmale
Je nach Untersuchungskorpus variieren zudem die sprachlich-stilistischen Merkmale eines EnzyklopädieartikelsEnzyklopädieartikel. Hoffmann (1988) nimmt in seiner Studie exemplarische Analysen der deutschsprachigen Artikel Hegel und Donau aus Meyers Universallexikon vor. Der Artikel Hegel zeichnet sich durch wenig komplexe Subjektsphrasen aus. Häufig fungiert das StichwortStichwort in abgekürzter Form als Subjekt. Demgegenüber steht eine expandierte Prädikatsphrase, die komplexe Objekte enthält:
(1) H. suchte die Resultate aller bisherigen Philosophie u. Einzelwiss. sowie die Geschichte in ihrer histor.-widersprüchl. Entwicklung theoret. zu fassen, die Gesellschaft als gesetzmäßigen Selbsterzeugungsprozeß des Menschen durch die (allerdings idealist. interpretierte) Arbeit (Entäußerung u. Vergegenständlichung der menschl. Wesenskräfte) zu erklären (Hoffmann 1988: 138).
Durch diese Struktur wird das ThemaThema des Satzes, Hegel, über das etwas ausgesagt wird, sehr knappgehalten, wohingegen das RhemaRhema sehr lang und der Text damit maximal informativ ist. AbkürzungenAbkürzung ermöglichen zudem eine bessere Nutzung des begrenzten Platzes. Die Verben treten ausschließlich in der 3. Person auf. Der Text ist durch die ständige Bezugnahme auf das Artikelstichwort gekennzeichnet, was zu einer konstanten thematischen Progressionthematische Progression führt. Dabei ist zu beobachten, dass das Artikelstichwort häufig wiederholt wird und keine ProformenProform eingesetzt werden:
(2) Ausgestattet mit einem enzyklopäd. Wissen, entwarf H. ein objektiv-idealist. System, dem die Identifizierung von Denken u. Sein zugrunde lag. Nach H. ist der Weltgeist das tätige Prinzip […] (Hoffmann 1988: 138).
Der Pronominalisierungsgrad ist somit gering und die Sätze werden über die wörtliche Wiederaufnahmewörtliche Wiederaufnahme verknüpft. Häufig werden die einzelnen Sätze ohne Konnektoren nebeneinandergestellt. Der gesamte Artikel wird von einem lexikalischen Netz aus dem Wortfeld ‚Grundbegriffe der idealistischen Philosophie‘ durchzogen. Während diese Beobachtungen für den gesamten Artikel gemacht wurden, lassen sich jedoch auch Unterschiede zwischen den einzelnen Artikelabschnitten feststellen. Beispielsweise fehlt im ersten Satz des Abschnitts allgemeine Charakterisierung das Verb:
(3) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 27.8.1770–14.11.1831, bedeutendster Repräsentant der klass. Deutschen Philosophie (Hoffmann 1988: 137).
Ebenso werden im Abschnitt zu Werken und Leistungen die Hauptwerke Hegels in Nominalsätzen aufgezählt. Im Artikel Donau finden sich teilweise ähnliche sprachliche Merkmale. Die Subjekte sind auch dort entweder sehr knappgehalten oder werden ganz ausgespart. Die Verben stehen ausschließlich in der 3. Person, die Prädikatsphrase ist erweitert. Der Artikel ist durch den ständigen Bezug auf das Thema Donau gekennzeichnet, wodurch auch dort eine konstante thematische Progressionthematische Progression vorliegt. Zudem durchzieht den Artikel ein Netz aus Lexemen des Wortfelds ‚Fluss/Strom‘. Die Pronominalisierung und die Verbindung von Sätzen durch Konnektoren werden völlig vermieden. Zusätzlich fällt die Reihung von Verben im Aktiv auf, die von Lokalangaben begleitet werden und so den Verlauf des Flusses beschreiben:
(4) Donau f: zweitlängster Strom Europas; 2.860 km, davon 2.580 schiffbar (ab Budapest für Seeschiffe); Einzugsgebiet 817.000 km2; entspringt mit den Quellflüssen Brigach und Brege im Schwarzwald […], durchströmt den SO Rumäniens, ist danach rumän.-sowjet. Grenzfluß, mündet mit 5.000 km2 großem, sumpfigem, schiff- u. fischreichem Delta […] (Hoffmann 1988: 141).
An Hoffmanns exemplarischen Analysen werden Merkmale ersichtlich, die sich in mehreren Artikeln finden lassen. Dazu gehört die ständige Bezugnahme auf das Artikelthema, was eine konstante thematische Progression erzeugt. Verfahren der sprachlichen Kürze, wie die EllipseEllipse des Kopulaverbs in der Definition, die Reihung von Nominalsätzen, deren Subjekt ausgespart wird, und die Verwendung von Abkürzungen ermöglichen einen ökonomischen Umgang mit dem begrenzten Platzangebot.1 Abhängig vom StichwortStichwort sind die auftretenden Wortfelder. Zudem können auch die verwendeten Verben je nach Lemmatyp variieren, beispielsweise je nachdem, ob es sich um ein statisches oder ein dynamisches Konzept handelt.
Die von Hoffmann für deutsche Artikel festgestellten sprachlich-stilistischen Merkmale bestätigen Fandrych/Thurmair (2011: 108) an ihrem deutschsprachigen Korpus von Artikeln: Progression mit einem durchlaufenden Thema, Wiederholung des Lemmas in abgekürzter Form, elliptischer Stil mit Auslassung des Kopulaverbs, Verzicht auf Konnektoren. Als Stilmittel sind im Korpus ParenthesenParenthese auffällig. Des Weiteren stellen Fandrych/Thurmair (2011) eine hohe Frequenz des Passivs in ihrem Korpus fest, wobei sie darauf hinweisen, dass dieses sprachliche Mittel der Deagentivierung insbesondere im Deutschen bevorzugt verwendet wird und im Englischen metonymische Subjekte verwendet werden (cf. Fandrych/Thurmair 2011: 113). Einer näheren Analyse unterziehen sie außerdem die sprachlichen Verfahren der nominalen Verdichtungnominale Verdichtung, die ebenfalls für das Deutsche typisch sind. Die Verdichtungnominale Verdichtung bewirkt, dass zum Ausdruck des propositionalen Gehalts weniger Formen auf der Textoberfläche erscheinen als in einer expandierten Form, was in romanischen Sprachen beispielsweise durch Konstruktionen mit einem Gerundium oder einem Partizip geleistet werden kann, die einen Nebensatz ersetzen. Im Deutschen stehen für die nominale Verdichtungnominale Verdichtung Wortbildungsmechanismen (Komposition, Substantivierung, Bildung komplexer Adjektive) sowie die Attribuierung zur Verfügung. Häufig folgt die Satzstruktur in EnzyklopädieartikelnEnzyklopädieartikel dem Schema X ist Y, wobei die Nominalphrase in Y durch Attribuierung stark erweitert wird, wie Fandrych/Thurmair am folgenden Beispiel aus dem Artikel mechanische Musikinstrumente illustrieren:
(5) […] Herzstück der m.M. ist seit dem 14. Jh. die Stiftwalze, eine drehbare Holzwalze (später auch Metall) mit vorstehenden Metallwinkeln, Eisenbolzen oder Nagelstiften, die in Umdrehungsrichtung entsprechend dem Rhythmus, in Querrichtung entsprechend der Tonhöhe angeordnet sind, wobei eine Walze mehrere Musikstücke tragen kann (Fandrych/Thurmair 2011: 108).
In diesem Beispiel wird das Element Stiftwalze durch eine Apposition erweitert, die mit eine drehbare Holzwalze beginnt und bis zum Ende des Satzes reicht (cf. Fandrych/Thurmair 2011: 109). Dabei werden verschiedene Verfahren der nominalen Verdichtungnominale Verdichtung miteinander kombiniert, was in dieser Weise lediglich in der deutschen Sprache möglich ist:
Eine solche Kombination von Wortbildung, pränuklearer und postnuklearer Attribution sowie Apposition ermöglicht es, mehrere Merkmale, die teils komplex ineinander verschachtelt sind, beidseitig an eine Nominalphrase „anzulagern“, eine Strukturmöglichkeit des Deutschen, die in anderen europäischen Sprachen nicht in dieser Weise ausgeprägt ist (Fandrych/Thurmair 2011: 109).
Gläser (1990) präsentiert in ihrer Studie sprachlich-stilistische Merkmale von englischsprachigen Fachlexika, Fachenzyklopädien und Fachglossaren. Insbesondere in den Fachlexika lassen sich Verfahren der sprachlichen Kürze feststellen. Häufig wird „auf satzartige Definitionen und Erläuterungen zugunsten elliptischer Aussagen verzichtet“ (Gläser 1990: 93). In Fachenzyklopädien finden sich dagegen eher „längere, ausformulierte Abhandlungen“ (Gläser 1990: 96). Dementsprechend liegt auch die Frequenz von EllipsenEllipse in Fachlexika höher als in Fachenzyklopädien, nämlich in der Fachenzyklopädie bei 4,7 % (cf. Lauer 1986: 102) und im Fachlexikon bei 83 % (cf. Fiedler 1986: 100). Des Weiteren lassen sich Verfahren feststellen, die eine neutrale, unpersönliche Darstellung bewirken. In den untersuchten Artikeln fehlen Pronomina der 1. und 2. Person ebenso wie emotional-expressive Stilmittel. Teilweise treten jedoch in den enzyklopädischen Lexikonartikeln persönliche Stellungnahmen und Wertungen auf, insbesondere wenn sie die sachliche Darstellung unterstützen (cf. Gläser 1990: 102). Zudem ist in den Artikeln der Fachlexika eine hohe Frequenz an PassivformenPassivform zu verzeichnen, während diese in den Artikeln aus den enzyklopädischen Lexikonartikeln niedriger liegt (cf. Gläser 1990: 103). Darüber hinaus weisen enzyklopädische Lexikonartikel im Vergleich zu Artikeln der Fachlexika eine größere Breite an Stilmitteln auf:
Infolge der obligatorischen Informationsverdichtung beschränken sich die Stilfiguren des Lexikonartikels auf die Ellipse, Parenthese und den Parallelismus. In enzyklopädischen Lexikonartikeln ist mit dem Asyndeton, der stilistischen Inversion, dem Nachtrag und einzelnen Metaphern zusätzlich zu rechnen (Gläser 1990: 108).
Die ermittelten Stilmittel stehen in enger Relation zu den kommunikativen Verfahren, die für Artikel in Nachschlagewerken typisch sind. So tritt die ParentheseParenthese in Zusammenhang mit dem Explizieren oder Kommentieren von Sachverhalten auf. Auch bei diesen Verfahren weist der Lexikonartikel ein schmaleres Spektrum als der Artikel der Fachenzyklopädie auf. Während sich der Lexikonartikel vorwiegend auf die Verfahren Definieren und Explizieren beschränkt, werden diese Verfahren im enzyklopädischen Lexikonartikel durch die Verfahren Feststellen, Referieren, Beschreiben, Kommentieren und Beurteilen ergänzt (cf. Gläser 1990: 107). Zusätzlich zu sprachlichen Mitteln, die eine unpersönliche, neutrale Darstellung bewirken, fallen Verfahren auf, die mit der didaktischen Funktion von EnzyklopädieartikelnEnzyklopädieartikel verbunden sind. Göpferich (1995) zufolge sind die EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel in ihrem deutsch-englischen Korpus diejenigen Diskurstraditionen, die den höchsten Anteil an metasprachlichen Elementen beinhalten. Ebenso stellt sie eine hohe Frequenz verallgemeinernder Formulierungen fest (cf. Göpferich 1995: 296; Haß 2016: 13).
Sprachlich-stilistische Merkmale von französischen Artikeln aus Enzyklopädien und enzyklopädischen Wörterbüchern untersuchen Mochet/O’Neil (2000). Die Artikel folgen überwiegend einem sachlich-neutralen Stil. Die Definitionen sind elliptisch, wobei sie im Falle von Universalis nicht als eigenständiger Teiltext, sondern als Teil des einleitenden Resümees erscheinen. Die vergangenen Ereignisse im Artikel zum Stichwort croisade werden im passé simple, imparfait und passé composé präsentiert. Durch den Einsatz des imparfait wird insbesondere in La grande encyclopédie: inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts par une société des savants et des gens des lettres von Dreyfus/BerthelotBerthelot, Marcellin (1886–1902) ein narrativer Stil gepflegt, der in den nachfolgenden Enzyklopädien einer sachlich-neutralen Darstellung weicht. Lediglich der Teiltext bilan enthält in mehreren Enzyklopädien des 20. Jahrhunderts persönliche Urteile der Verfasser:
Seul le „bilan“ des croisades conserve, à travers les commentaires appréciatifs, la marque d’opinion des auteurs (Mochet/O’Neil 2000: 105).
Die Ausprägung sprachlich-stilistischer Merkmale in traditionellen italienischen Enzyklopädieartikeln2 untersuchen d’Achille/Proietti (2011: 93f.) und kontrastieren sie anschließend mit einem multilingualen Korpus aus Wikipediaartikeln. Als diskurstraditionell beschreiben sie die Auslassung des KopulaverbsKopulaverb in der Definition und die regelmäßige Wiederaufnahme des LemmasLemma in abgekürzter Form. Aufgrund des begrenzten Platzangebots weisen die Artikel häufig keinerlei Absätze auf. Aufzählungen, die von einem Doppelpunkt eingeleitet werden, garantieren eine kurze und knappe Präsentation der Information. Aus Gründen der Kondensation sind die EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel durch einen hohen Grad an lexikalischer Dichte gekennzeichnet. Die Artikel orientieren sich an der Standardsprache und sind einer sachlich-nüchternen Darstellung in einem unpersönlichen Stil verpflichtet. Aus diesem Grund fehlen markierte Satzkonstruktionen sowie Frage- und Ausrufesätze. Die Interpunktionszeichen werden in ausschließlich syntaktisch-grammatischer Funktion verwendet. Ebenso beschränken sich die Tempusformen auf das Präsens und Vergangenheitstempora, das Futur wird zumeist vermieden. Des Weiteren fehlen Deiktika, Konnektoren und Gliederungssignale. Diskurstraditionell sind zudem ParenthesenParenthese, die auf kondensierte Weise Einschübe ermöglichen. Die Artikel streben insgesamt eine sprachlich homogene Darstellung an, wobei anhand von Abkürzungssystemen, Konventionen zur Großschreibung oder paragrafematischen Elementen der Stil eines Werks sichtbar werden kann.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass Artikel in Nachschlagewerken zum einen in der knappen Form eines Lexikonartikels und zum anderen in der ausführlichen Form eines Enzyklopädieartikels auftreten können, wobei die Grenzen fließend sind. Sowohl der Lexikonartikel als auch der EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel sind durch die permanente Wiederaufnahme des Artikelthemas gekennzeichnet, um das herum die neuen Informationen organisiert werden (cf. Fandrych/Thurmair 2011: 103). Dabei tritt die Initiale des Lemmas am Satzanfang als Thema auf, auf das eine häufig expandierte Prädikatsphrase mit der neuen Information folgt. Zusätzlich wird über ein lexikalisches Netz aus Ausdrücken, die in semantischer oder assoziativer Beziehung zum Lemma stehen, der thematische Zusammenhang aufrechterhalten. Die Häufigkeit von Mitteln der sprachlichen Kürze variiert je nach Ausführlichkeit des Artikels. In der knapp gefassten Version fehlt das Kopulaverb in der Definition, im Artikeltext werden Lexeme abgekürzt. Das Artikelstichwort wird einmal ausgeschrieben und anschließend wird nur noch die Initiale als abgekürzte Form angegeben. Im Artikeltext werden die Aussagen asyndetisch aneinandergereiht, auf Konnektoren wird verzichtet. Zu einer solchen Informationsverdichtung tragen auch die häufigen ParenthesenParenthese bei. In deutschen Artikeln sind stark expandierte Nominalphrasen zu beobachten, was in anderen Sprachen rein strukturell nicht in dieser Ausprägung möglich ist. In den romanischen Sprachen werden beispielsweise Gerund- und PartizipialkonstruktionenPartizipialkonstruktion eingesetzt. Die Verfahren der sprachlichen Kürze sind in enzyklopädischen Artikeln seltener zu beobachten. Zudem enthalten enzyklopädische Artikel ein breiteres Spektrum an Stilmitteln wie beispielsweise stilistische Inversionen, Nachträge und Metaphern. Die kürzeren Lexikonartikel sind durch einen hohen Grad an Unpersönlichkeit gekennzeichnet. Dieser wird durch den Verzicht auf Pronomina der 1. und 2. Person erreicht. Eine Deagentivierung erzeugen auch Passivkonstruktionen, die insbesondere deutsche Artikel kennzeichnen, während in anderen Sprachen auch Mittel des Passiversatzes denkbar sind. Die enzyklopädischen Artikel verzichten ebenfalls auf Pronomina der ersten und zweiten Person, jedoch weisen sie seltener Passivkonstruktionen auf. Zudem verzichten sie, anders als die Lexikonartikel, nicht komplett auf emotional-expressive Ausdrücke. Im Falle, dass Wertungen des Verfassers die Klarheit eines enzyklopädischen Artikels fördern, sind diese sogar als Expertenurteil erwünscht. Auffällig bei einigen EnzyklopädieartikelnEnzyklopädieartikel zu Stichwörtern aus den Naturwissenschaften und der Technik ist zudem der hohe Anteil metasprachlicher Elemente und verallgemeinernder Formulierungen, die auf die didaktische Funktion von EnzyklopädieartikelnEnzyklopädieartikel zurückzuführen sind. Der Vergleich mit den Merkmalen traditioneller italienischer Artikel zeigt außerdem, dass die sprachlich-stilistische Gestaltung sprachübergreifend eine möglichst prägnante, sachlich-neutrale Darstellung zum Ziel hat und dass große Ähnlichkeiten bestehen. Allerdings fallen in gedruckten französischen Artikeln Abschnitte mit einer kritischen Diskussion oder persönlichen Stellungnahmen der Verfasser auf, was zeigt, dass vor dem Hintergrund zahlreicher sprachübergreifender Gemeinsamkeiten auch sprach- und kulturspezifische Ausprägungen der Diskurstradition EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel auszumachen sind.
3.2.5 Zwischenresümee
Zusammengefasst betrachtet, besteht die Funktion von Enzyklopädieartikeln darin, dem Leser ein gesichertes Wissen zu dem Konzept bereitzustellen, auf das sich das Stichwort bezieht. Im Gegensatz zum WörterbuchartikelWörterbuchartikel und zum Eintrag im enzyklopädischen Lexikonenzyklopädisches Lexikon enthält ein EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel keine sprachlichen InformationenInformation– sprachliche zum StichwortStichwort, sondern lediglich enzyklopädische InformationenInformation– enzyklopädische zu dem Themengebiet, das durch das Lemma benannt wird. Diese Informationen werden in einem EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel diskursiv dargeboten und gehen nicht auf ein kondensiertes Programm zurück, wie es in einem WörterbuchartikelWörterbuchartikel zu finden ist.
Der EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel ist eine Diskurstradition, die durch die kommunikativen Parameterwerte des Distanzsprechens geprägt ist. Die Diskurstradition ist öffentlich für ein breites Publikum zugänglich, Autor und Rezipient sind einander fremd, die emotionale Beteiligung der Kommunikationspartner wird zugunsten einer sachlich-neutralen Darstellung vermieden. Die Inhalte eines EnzyklopädieartikelsEnzyklopädieartikel besitzen eine situationsunabhängige Gültigkeit, wodurch Handlungs- und Situationsentbindung vorliegt. Zudem beziehen sich die Inhalte auf Gegenstände, die sowohl vom Autor als auch vom Rezipienten entfernt sind (referenzielle Distanz). Zwischen dem Autor und dem Rezipienten herrscht sowohl räumliche als auch zeitliche Distanz. Der Artikel wird vom Rezipienten als fertiges Produkt konsultiert, weswegen weder eine Mitwirkung am Diskurs noch der Wechsel der Sprecherrolle möglich ist, da es sich um einen monologischen Text handelt. Aufgrund der Tatsache, dass EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel häufig redaktionellen Vorgaben folgen und der redaktionellen Kontrolle unterliegen, wird sowohl deren Struktur als auch deren sprachliche Abfassung sorgfältig geplant. Das Thema des Artikels wird durch das StichwortStichwort vorgegeben, das sich in eine vorher redaktionell festgelegte Makrostruktur fügen muss. Allerdings haben die Autoren gewisse Freiheiten bei der Auswahl der präsentierten Informationen. Für gedruckte EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel– gedruckter ist typisch, dass sie von Experten verfasst sind und in der Regel vom interessierten Laien konsultiert werden. Dadurch entsteht ein fachliches Gefälle zwischen Autor und Leser. Der Autor garantiert die Korrektheit der Informationen.
Während die Kommunikationssituation für einzelne EnzyklopädieartikelEnzyklopädieartikel relativ einheitlich ist und lediglich der Parameter Hierarchie zwischen den Kommunikationspartnern je nach Zuschnitt des Werks schwankt, sind im Aufbau der Artikel größere Unterschiede festzustellen. In der kürzesten Version besteht der Artikel aus einem grafisch abgehobenen Stichwort und einer allgemeinen Charakterisierung, die häufig die Form einer Definition annimmt. In der längeren Variante werden im Artikel zusätzlich Teilaspekte des Themas, das durch das Stichwort vorgegeben wird, in einzelnen Kapiteln behandelt, die von umfangreichen Begleittexten umgeben sein können wie Glossaren, Tabellen, Quellenangaben oder weiterführender Literatur. Ein wissenschaftlicher Apparat und eine Signatur fallen insbesondere bei den Fachlexika auf. Durch Querverweise ist der Artikel mit anderen Artikeln verknüpft, das Stichwort ist zudem Teil der alphabetischen Makrostruktur. Die Ausprägung des Artikelaufbaus ist nicht nur vom Grad der Fachlichkeit des Werks oder des Stichworts abhängig, sondern auch von kulturellen Traditionen in der jeweiligen Diskursgemeinschaft. So lässt sich beobachten, dass französische Enzyklopädieartikel häufig ausführlich gestaltet sind und eine Einleitung, eine Darstellung des Inhalts und eine Zusammenfassung aufweisen. Am Ende des Artikels kann eine Einschätzung des Sachverhalts durch den Autor enthalten sein. Die Informationen sind anhand einer Bibliografie nachvollziehbar. Eher kürzer und neutral gehalten sind dagegen italienische Enzyklopädieartikel, die keine Abschnitte mit Urteilen des Verfassers und in der Regel auch keine Fußnoten enthalten.
Die prominente Funktion des Stichworts als Themengeber, um das herum alle weiteren Informationen organisiert sind, zeigt sich auch darin, dass Artikel in Nachschlagewerken durch eine konstante thematische Progression geprägt sind, wobei das Lemma häufig in abgekürzter Form wiederholt wird. Der knapper gehaltene Lexikonartikel ist durch Verfahren der sprachlichen Kürze geprägt, die jedoch, wenn auch seltener, ebenso in Enzyklopädieartikeln auftreten können. Auffällig sind die Auslassung des Kopulaverbs in der Definition, nominale Sätze, Abkürzungen, ParenthesenParenthese, der Verzicht auf Kohäsionsmittel und insbesondere in deutschen Artikeln stark expandierte Nominalphrasen. In EnzyklopädieartikelnEnzyklopädieartikel werden diese Verfahren weniger häufig verwendet und durch Stilmittel, wie die stilistische Inversion, oder auch Metaphern ergänzt. Die Unpersönlichkeit der Darstellung wird durch einen Verzicht auf Pronomina in der 1. und 2. Person erzielt, in deutschen Artikeln werden auch häufig Passivkonstruktionen eingesetzt. Insbesondere zu fachsprachlichen Stichwörtern lassen sich metasprachliche Elemente finden, ebenso wie in einigen Artikeln verallgemeinernde Formulierungen zu finden sind, die sich mit der wissenspopularisierenden Funktion von Enzyklopädieartikeln erklären lassen. Welche sprachlich-stilistischen Mittel auftreten, ist zum einen durch die in einer Sprache zur Verfügung stehenden Mittel bedingt, nicht zuletzt aber auch durch kulturelle Traditionen der Diskursgemeinschaften. So sind in den Zusammenfassungen französischer Enzyklopädieartikel bewertende Ausdrücke auffällig, die in Enzyklopädieartikeln anderer Sprachen nicht diskurstraditionell sind.