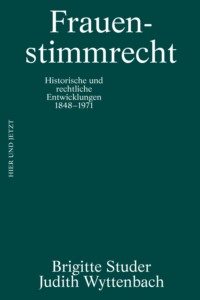Kitabı oku: «Frauenstimmrecht», sayfa 2
Die politische Aktion
Die Geschichte des Frauenstimmrechts in der Schweiz ist dicht und vielschichtig. Zwischen der Einführung des allgemeinen Männerstimm- und -wahlrechts 1848 und der gesamtschweizerischen Realisierung des Frauenstimmrechts 1990 durch einen Bundesgerichtsentscheid (Fall Rohner), der den Kanton Appenzell Innerrhoden zwang, seinen Widerstand gegen die politische Gleichberechtigung der Frauen aufzugeben, vergingen rund 150 Jahre. Dazwischen fanden über neunzig Abstimmungen auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene statt.
Im Folgenden geht es darum, erstens eine Periodisierung vorzunehmen und die Momente des Wandels auf nationaler Ebene oder mit nationaler Bedeutung (Verfassungsrevisionen, nationale Abstimmungen und Petitionen, kantonale Abstimmungen mit nationaler Relevanz, parlamentarische Interventionen, Bundesgerichtsentscheide) zu analysieren. Inwiefern stellten sie Möglichkeitsfenster dar und welches waren die daran geknüpften Erwartungen der Befürworterinnen und Befürworter des Frauenstimmrechts? Und folgten darauf jeweils Phasen der politischen Stagnation oder des gesellschaftlichen Rückschritts? Zu fragen ist ferner, welche Taktiken die Befürworterinnen und Befürworter, aber auch die Gegnerinnen und Gegner verfolgten oder welches Aktionsrepertoire ihnen zur Verfügung stand, welche Allianzen welcher Art sie schliessen konnten und wie funktionstüchtig diese waren. Zweitens gilt es, den Blick auf die inter- und transnationale Ebene zu richten und zu fragen, welchen Einfluss die transnationalen Verflechtungen der Schweizer Feministinnen und Momente des Beitritts der Schweiz zu internationalen Organisationen oder Konventionen auf die Debatten rund um das Frauenstimmrecht hatten.
1848 bis 1872/74: die konzeptuelle Emergenzphase
1848 gilt gemeinhin als das Jahr, in dem der neue Bundesstaat das allgemeine oder universelle (Männer-)Stimmrecht einführte. Das stimmt so nicht. Es handelte sich nicht nur im Hinblick auf die Ausgrenzung des weiblichen Geschlechts um einen falschen Universalismus. Die Eidgenossenschaft liess zahlreiche Ausnahmen zu. Art. 74 der Bundesverfassung (BV) bestimmte lediglich, dass jeder Kantonsbürger auch Schweizer Bürger sei, denn die kantonale Niederlassungsberechtigung war Grundlage des Schweizer Bürgerrechts. Doch Frauen, Kinder, Entmündigte, Armengenössige, Konkursiten, Verbrecher oder Fremde blieben von den politischen Rechten ausgeklammert.11 Die Tagsatzungskommission nennt 437 103 Stimmberechtigte, die 1848 über die BV entscheiden konnten, was bloss zwanzig Prozent der damaligen Gesamtbevölkerung der Schweiz entsprach.12 Eine Schätzung beziffert den Anteil der effektiv Wahlberechtigten an der Gesamtbevölkerung bis 1910 auf höchstens einen Viertel.13 Im internationalen Vergleich war das zwar ein relativ hoher Wert, die «älteste Demokratie der Welt» war aber weit von «universellen» politischen Rechten entfernt.
Zu berichtigen ist ferner die Vorstellung, dass die verfassungsgebende Tagsatzungskommission 1848 eine direkte Demokratie verabschiedet hätte. Sie wählte im Gegenteil eine liberal-repräsentative Demokratie für die Bundesebene und liess den Kantonen weitgehende Freiheit in der Organisation ihres Wahlsystems. Die Tagsatzungskommission diskutierte zwar die Ungleichbehandlung der Juden im Bereich der Niederlassungsfreiheit, verlor aber kein Wort über die mindere Rechtsstellung der Frauen und ihren Ausschluss von den politischen Rechten.14 Die Schweizer Verfassungsgeber übernahmen die Ideen der Freiheit und Gleichheit des Naturrechts, interpretierten es aber wie die Gesetzgeber in anderen Ländern auch als Gleichheit für die Gleichen, Ungleichheit für die Ungleichen.15 Nur dem männlichen Geschlecht wurden im liberal-radikalen Weltbild die für die öffentliche Sphäre notwendigen Fähigkeiten zugeschrieben, Frauen hingegen wurden diese prinzipiell abgestritten. Doch während die Ausschlussgründe für die Männer zunehmend abgebaut und gleichzeitig die demokratischen Rechte erweitert wurden, blieben die Frauen von der politischen Teilhabe rund 120 Jahre (und kantonal sogar rund 150 Jahre) ausgeschlossen – freilich nicht ganz widerspruchsfrei.
Wiederholt vereinzelte Stimmen
Die rechtliche Gleichstellung der Frauen und das Frauenstimm- und -wahlrecht waren Mitte des 19. Jahrhunderts keineswegs unbekannte Forderungen. In Wirklichkeit entstand die feministische Kritik des weiblichen Ausschlusses von den bürgerlichen Rechten parallel zu diesem Ausschluss.16 Den modernen Auftakt während der Französischen Revolution machte Olympe de Gouges mit ihrer Forderung «la femme a le droit de monter sur l’échafaud; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune», was sich aber nur für den ersten Teil des Satzes bewahrheiten sollte. Als weniger folgenreich (persönlich und auch politisch) erwies sich eine Reihe späterer Interventionen, die ebenfalls den falschen Universalismus der politischen Repräsentation, wie ihn Demokratien reklamierten, anprangerten. Bekannt geworden ist die Forderung des Berner Gelehrten Beat von Lerber (1788–1849) in seiner Eingabe von 1830 an die Berner Regierung: «Das weibliche Geschlecht soll in allen Menschenrechten dem männlichen ganz gleich gestellt werden.»17 Während in der Schweiz die Verfassungsgründer stillschweigend über die Diskriminierung von Frauen hinweggingen, hatte sich in Deutschland und in Frankreich zur Zeit der 1848er-Revolutionen eine breitgefächerte Frauenbewegung formiert; in Grossbritannien ertönte die Forderung des Frauenstimmrechts im Chartismus und jeweils im Zuge der Wahlrechtsreformen (1832/1860er-Jahre).18 John Stuart Mill scheiterte allerdings 1867 im britischen Parlament mit seinem Antrag für politische Rechte für Frauen. In Wien forderten anonyme «Bittstellerinnen» 1848 in einer Flugschrift die «Gleichstellung aller Rechte der Männer mit den Frauen: oder: die Frauen als Wähler, Deputirte [sic!] und Volksvertreter».19 Im gleichen Jahr verlangten die in Seneca Falls im Bundesstaat New York versammelten Amerikanerinnen das Wahlrecht.
Im jungen Bundesstaat der Schweizerischen Eidgenossenschaft beanstandete ungefähr zur selben Zeit eine Gruppe Freiburgerinnen indirekt ihre fehlenden politischen Rechte. In ihrer am 5. Januar 1849 den Schweizer Bundesbehörden eingereichten Petition empörten sie sich, dass sie von der Freiburger radikalen Regierung als «auteurs et fauteurs du Sonderbund et de la résistance armée» zur Zahlung einer Strafsteuer verurteilt worden waren. Es sei unglaublich, dass Frauen für den Ausgang von Kämpfen und politischen Maximen verantwortlich gemacht würden, wenn das Gesetz sie gleichzeitig zu Minderjährigen erkläre und einer dauernden Vormundschaft unterwerfe. Ausserdem konnten sie nicht verstehen, dass man damit drohte, ihnen die politischen Rechte zu entziehen, über die sie gar nie verfügt hätten.20
Mit den Demokratisierungsbewegungen der 1860er-Jahre meldeten sich auch in der Schweiz vereinzelte Stimmen, die das Frauenstimmrecht forderten. Sie blieben ungehört. Bekannt ist die Petition der Sissacherinnen von 1862 aus dem Kanton Basel-Landschaft.21 Im Lauf der Arbeiten an einer neuen Zürcher Verfassung 1868 richteten «mehrere Frauen aus dem Volke» eine Eingabe an den Verfassungsrat mit folgendem Inhalt: «Soll die Losung des Züricher Volkes ‹Freiheit, Bildung, Wohlstand› zur That und Wahrheit werden, so müsste Jungfrauen und Frauen vom 20ten Lebensjahre an ein voller Antheil an allen bürgerlichen Rechten gewährt sein. Was wir nur aus diesem Grunde erbitten, was wir verlangen, das heisst: Wahlberechtigung u. Wahlfähigkeit für das weibliche Geschlecht in allen sozialen und politischen Angelegenheiten und Beziehungen.»22
Die Eingabe ging als Nr. 99 in die systematische Übersicht der Revisionswünsche ein. Es war nicht die einzige: Auch Theodor Zuppinger aus Männedorf setzte sich für das «Stimmrecht der Bürgerinnen» ein, während Diakon Heinrich H. Hirzel aus Zürich eine «Stimmberechtigung des Frauengeschlechtes in Kirchen- und Schulgemeindeversammlungen» verlangte. Die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) kommentierte lakonisch: «Das Stimmrecht der Frauen, durch verschiedene Eingaben angeregt, fand in der Kommission keinen Anklang. Ein einziges Mitglied erklärte sich für die Emanzipation, verzichtete aber auf jede Antragstellung.»23 Bereits rund ein Jahrzehnt früher, 1857, hatte ein Neuenburger Grossrat anlässlich der Diskussion über die kantonale Verfassungsrevision kurz das Wahlrecht von Frauen eingebracht, allerdings nur für kirchliche Angelegenheiten und ohne dass die Sache weiterverfolgt worden wäre.24
Transnationale und transkantonale Vernetzung
Anlässlich der Vorarbeiten zur Revision der Bundesverfassung von 1872 erfolgten mehrere Interventionen zur rechtlichen Gleichstellung der Frauen im Zivilrecht und auf wirtschaftlicher Ebene, nicht aber zur politischen Gleichstellung.25 Federführend waren die Genferin Marie Goegg-Pouchoulin (1826–1899) und die Bernerin Julie von May (1808–1875).26 Goegg war die Gründerin der ersten feministischen Organisation der Schweiz, der transnational vernetzten Association internationale des femmes (1868). Die Limitation auf das Zivilrecht und auf ökonomische Rechte war taktischer Natur. Wie Goegg 1870 ausführte, zählte der Zugang zu den politischen Rechten schon nur aus Gründen der Gerechtigkeit ebenfalls zu den Zielsetzungen der Association. Denn solange die Frauen nicht am allgemeinen Stimmrecht (suffrage universel) partizipierten, sei der Begriff irreführend. Gefordert wurde das Stimmrecht ferner aus materiellen Gründen: als Mittel zur Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse.27 Goegg erreichte zwar, dass ab 1872 Frauen der Zugang zur Universität Genf prinzipiell offenstand.28 Doch weder ihre noch von Mays Petitionen und Schriften fanden bei den eidgenössischen Räten das nötige Gehör, um in die neue Bundesverfassung von 1872 respektive in die schliesslich verabschiedete von 1874 einzugehen.29 Der Ausbau der Volksrechte ging am weiblichen Geschlecht vorbei. Auch das 1912 in Kraft getretene Schweizer Eherecht war für die Frauen enttäuschend, wurden sie doch weiterhin der Vormundschaft ihres Ehemanns unterstellt.
Vor der Jahrhundertwende bis 1912: die organisationale und politische Konstruktionsphase
In der Schweiz ertönte die Frage der Geschlechtergleichstellung erst nach der Wachstumskrise Ende der 1880er-Jahre wieder zaghaft in der Öffentlichkeit. Die Frauenfrage wurde damals zur sozialen Frage. Das Studium stand Frauen nun an fast allen Schweizer Universitäten offen. Mit der revidierten Bundesverfassung war der Schulbesuch für alle Kinder obligatorisch geworden und kostenlos. 1882 bildeten die Frauen die Hälfte der Belegschaften in den Fabriken. Auch die Frauen aus der Mittelschicht begannen ins Erwerbsleben einzutreten, sei es am unteren Ende als Angestellte der Post oder am oberen wie Marie Heim-Vögtlin, die 1874 als erste Frau eine Praxis für Gynäkologie eröffnete.
Das Werden einer Forderung
Es waren aber vorerst immer noch einzelne, isolierte Stimmen, die sich zu Wort meldeten. Von der restlichen Schweiz unbeachtet, hatten 1892 anlässlich der kantonalen Verfassungsrevision vier Tessiner Grossräte beantragt, das Frauenstimmrecht einzuführen – erfolglos.30 Als erster Intellektueller verteidigte der Lausanner Philosophieprofessor Charles Secrétan (1815–1895) in seiner 1885 publizierten Schrift «Le droit de la femme» mit ähnlicher Argumentation wie Marie Goegg-Pouchoulin die politische Gleichheit. Der Zugang zu den politischen Rechten würde den Frauen ermöglichen, ihre Interessen zu verteidigen und mache die Frau erst zur juristischen Person. Am 1. Januar 1887 forderte die Bündner Aristokratin Meta von Salis (1855–1929) in einer Zeitung der Demokraten, der Züricher Post, das Frauenstimmrecht aus Gerechtigkeitsgründen. Wie neu und provokatorisch das Anliegen damals tönte, zeigt der Titel «Ketzerische Neujahrsgedanken einer Frau» sowie der redaktionelle Kommentar, dass es sich um eine Zuschrift handle und man diese aus Gründen der Meinungsfreiheit veröffentliche.31 Von Salis erfuhr aber bald, dass es Wege gab, unliebsame Frauen mundtot zu machen. Für ihre Stellungnahme für die Ärztin Caroline Farner wurde sie wegen Ehrverletzung angeklagt, worauf sie sich aus dem öffentlichen Leben zurückzog. Anders Emilie Kempin-Spyri (1853–1901), die erste Juristin der Schweiz und im deutschsprachigen Raum: Sie gründete in Zürich 1893 die Zeitschrift Frauenrecht und den progressiven Frauenrechtsschutzverein. Nach Abschluss ihres Studiums 1887 war sie wegen ihres fehlenden Aktivbürgerrechts nicht zur Advokatur zugelassen worden. Sie reichte beim Bundesgericht Rekurs ein, scheiterte jedoch mit ihrer Klage, wonach Art. 4 BV «Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich» sich auf die politische Gleichberechtigung der Frauen beziehen liesse.32 Dieser BGE schuf einen folgenreichen Präzedenzfall.33
Die Forderung des Frauenstimmrechts war Ende des 19. Jahrhunderts noch umstritten, auch international. Selbst der International Council of Women, die erste Frauenorganisation, die sich ab 1888 transnational für die Menschenrechte der Frauen einsetzte, vermied es in den ersten 15 Jahren seiner Existenz, zu den politischen Rechten der Frauen Stellung zu nehmen.34 1899 wurde das Thema sogar kontrovers traktandiert. Das führte zur Spaltung und 1904 zur Gründung der International Woman Suffrage Alliance (IWSA), der Speerspitze des transnationalen Stimmrechtskampfs.
Der erste Schweizerische Kongress für die Interessen der Frau, der 1896 in Genf stattfand, traktandierte das Frauenstimmrecht noch gar nicht. Mehrere Redner behandelten das Thema gleichwohl. Die beiden Genfer Professoren Louis Wuarin (1846–1927) und Louis Bridel (1852–1913) sprachen sich beide für die Einführung des Frauenstimmrechts aus, allerdings mit jeweiligen Vorbehalten. Wuarin meinte, die Frauen müssten es sich zuerst durch Dienstleistungen an der Allgemeinheit verdienen; Bridel erwartete zwar eine moralische Besserung der Gesellschaft, plädierte aber für ein etappenweises Vorgehen in der Gleichstellungspolitik, beginnend bei der zivilrechtlichen Gleichstellung bis hinauf zur politischen.35 Der Kongress in Genf skizzierte einige der Pfade, die in den folgenden Jahrzehnten beschritten werden sollten: zum einen den meritokratischen Weg über den weiblichen Leistungsbeweis, zum anderen das schrittweise politische Vorgehen. Er zeigt im Übrigen die Rolle transnationaler Vorbilder für den politischen Lernprozess des Schweizer Feminismus auf. Die Organisatorinnen Julie Ryff (1831–1908), Helene von Mülinen (1850–1924), Emma Boos-Jegher (1857–1932), Pauline Chaponnière-Chaix (1850–1934) und Camille Vidart (1854–1930) folgten dem Muster der amerikanischen Feministinnen und ihrem Woman’s Building an der Weltausstellung von Chicago im Jahr 1893, zu deren Anlass diese den Weltkongress der Frauen durchführten. Auch die Schweizerinnen liessen ihren Kongress örtlich und zeitlich mit einem Grossereignis zusammenfallen und profitierten so von der öffentlichen Aufmerksamkeit, welche die Schweizer Landesausstellung generierte. Eduard, der Mann von Emma Boos-Jegher, der die Chicagoer Ausstellung besucht hatte, diente als transatlantischer Ideenübermittler.
Die Gründung einer nationalen Stimmrechtsorganisation am 28. Januar 1909 ging ebenfalls auf einen internationalen Impuls zurück. Bis dahin existierten einzig kantonale respektive lokale Verbände, beginnend 1905 in den Städten Neuenburg und Olten, 1907 in Genf und Lausanne, gefolgt 1908 von Gruppierungen in den Städten Bern und La Chaux-de-Fonds. In Zürich bestand seit 1893 der Frauenrechtsschutzverein, der 1896 mit dem Schweizerischen Verein für Frauenbildungsreform zur Union für Frauenbestrebungen fusionierte. Erst auf Einladung der Präsidentin der IWSA, Carrie Chapman Catt, an den internationalen Kongress vom Juni 1908 in Amsterdam formierten die Schweizerinnen den gemischtgeschlechtlichen Schweizerischen Verband für Frauenstimmrecht (SVF) mit 765 Mitgliedern.
In der Schweiz erhob 1897 mit Carl Hilty (1833–1909) erstmals ein gewichtiger Vertreter der Elite seine Stimme zugunsten des Frauenstimmrechts. In dem von ihm gegründeten «Politischen Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft» schlug der Professor des Bundesstaatsrechts und Völkerrechts an der Universität Bern, der bald darauf Vertreter der Eidgenossenschaft an der ersten Haager Friedenskonferenz und Mitglied des internationalen Schiedsgerichtshofs in Den Haag war, einen Verfassungsartikel vor, der allerdings den Kantonen die letzte Entscheidung vorbehielt.36 Hilty kritisierte zwar die herrschende Geschlechterordnung klar und deutlich als Machtausübung der Männer, die Frauen lieber ausgeschlossen haben wollten, doch in Bezug auf die politische Taktik blieb er zurückhaltend. Mit seinen föderalistischen Rücksichten legitimierte er ein etappenweises Vorgehen.
Partielle Rechte oder integrales Stimmrecht?
Die Forderung des Frauenstimmrechts gewann nach der Jahrhundertwende an Legitimität, beschränkte sich aber vorerst noch auf partielle Rechte. Die erste Abstimmung, am 4. November 1900 im Kanton Bern, war dank Eingaben durch den Berner Lehrerinnenverband und die Christlich-Soziale Vereinigung vom Regierungsrat veranschlagt worden, sie bezog sich aber nur auf die Wahl von Frauen in die Schulkommissionen. Fast siebzig Prozent der stimmberechtigten Männer lehnten ab. Der Berner Jura zeigte sich dem Anliegen gegenüber freundlicher gesinnt. Der Bezirk Freibergen stimmte sogar mit 632 zu 407 Stimmen zu.37
Während die bürgerliche Frauenbewegung um die Jahrhundertwende erst moderate Anliegen wie das passive Wahlrecht für die Schul- und Armenbehörden anvisierte, begann die Arbeiterbewegung nach und nach, das Frauenstimmrecht zu befürworten und engagierte sich allmählich auch dafür. Als erste Schweizer Organisation sprach sich 1893 der Schweizerische Arbeiterinnenverband (SAV) für das integrale Frauenstimmrecht aus. Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) folgte 1904, die österreichische war bereits 1892 vorausgegangen. Am Kongress von Stuttgart 1907 wurden alle Parteien der Sozialistischen Internationale auf die Verteidigung der Forderung verpflichtet. Doch erst am Parteitag von 1912 folgten auf Druck von weiblichen Mitgliedern auch Taten seitens der Schweizer Parteigenossen.38 So reichte der St. Galler sozialdemokratische Grossrat Johannes Huber noch im selben Jahr die erste Motion zugunsten des Frauenstimmrechts ein.39 Gleichzeitig folgten die Arbeiterinnenvereine dem Beschluss der Sozialistischen Internationale und traten als Organisation aus dem Bund Schweizerischer Frauenvereine (BSF) aus, denn «sozialistische Frauenvereine dürfen nicht Kollektivmitglied bürgerlicher Frauenvereine sein».40 In Bezug auf die Frauenstimmrechtsvereine fehlte ein solcher Konsens. Als das Thema am Parteitag 1913 nochmals auf die Traktandenliste kam, wurde der Antrag, dass die Sozialdemokratinnen aus den «bürgerlichen» Stimmrechtsvereinen austreten sollten, abgelehnt. Eine Abgrenzung gegenüber der bürgerlichen Frauenbewegung blieb zwar bestehen, doch eine Zusammenarbeit war in Bezug auf das Frauenstimmrecht von Fall zu Fall möglich.41
Mit dem SAV, der SP und dem SVF, der nur Sektionen aufnahm, die sich für das integrale Frauenstimmrecht aussprachen, stand nun die Forderung nach politischer Gleichstellung der Frauen mit den Männern im Raum. Mittlerweile hatten mit Finnland 190642 und Norwegen 1913 auch zwei europäische Länder den Frauen das integrale Wahlrecht gewährt. Bis dahin drehten sich die Debatten fast ausschliesslich um beschränkte politische Rechte wie das passive Wahlrecht oder ein partielles Stimm- und Wahlrecht in Schul- oder Armenkommissionen oder kirchlichen Angelegenheiten. Auf diesem Gebiet – und nur diesem – waren erste rechtliche Erfolge zu verzeichnen (passives Wahlrecht in die Schulkommissionen in Genf; Armenpflege im Wallis 1898; Schulbehörden in Basel-Stadt 1903, St. Gallen 1905, Waadt 1906, Neuenburg 1908 etc., siehe Karten 1–3, S. 191–193). In der Praxis wurden aber nur wenige Frauen gewählt. In Genf wurde 1914 das aktive und passive Wahlrecht für die gewerblichen Schiedsgerichte durch eine Initiative sogar wieder abgeschafft.