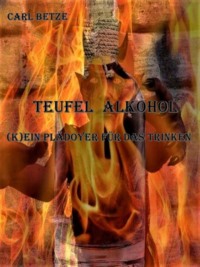Kitabı oku: «Teufel Alkohol», sayfa 4
06 - Die Phantomsucht
„Ich sage zum Alkohol immer nein. Aber er will mir einfach nicht zuhören“
Als Tabu bezeichnet man ein Thema, über das nicht gesprochen wird, über das nicht gesprochen werden darf. Ein heikles Sujet, bei dem man Gefahr läuft, sich den Mund zu verbrennen, wenn man es verbalisiert.
Tummelfeld solcher Tabus sind die Gesellschaft oder auch das praktische Leben selbst, der Alltag.
Die Selbsterkenntnis, ein Problem mit dem Konsum von Alkohol zu haben, ist in diesem unserem Lande einer der letzten Tabus. Darüber spricht man nicht, allerhöchstens tuschelt man ein wenig.
Und so ist die Alkoholsucht als solche ein Mysterium, eine Fata Morgana, eine Schimäre, ein Phantom.
Man kriegt sie nicht gepackt, man kriegt sie nicht zu fassen. Sie versteckt sich, sie tarnt sich, sie gibt Rätsel auf, sich anfangs allenfalls undeutlich zu erkennen und sie kann oft nicht eindeutig identifiziert oder definiert werden.
Ein 'Outing' in diesem Bereich gibt es immer noch nur in Einzelfällen. Die überwiegende Mehrheit trinkt weiter – und schweigt.
Übermäßiger Alkoholkonsum wird gerne verharmlost und oft totgeschwiegen. Selbst den engsten Vertrauten gegenüber. Ich habe mich während meines ersten und einzigen mehrwöchigen Totalabsturzes im Jahr 2003 weder meinen Eltern noch den engsten Freunden gegenüber offenbart.
Lediglich eine gute Freundin wusste Bescheid, ich weiß nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, sie hatte mich damals spontan besucht und so von meinem bemitleidenswerten Zustand erfahren.
Offensichtlich ist es so, dass unterschiedliche Süchte in unserer Gesellschaft auch unterschiedlich bewertet werden. Weil sie mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen und Bildern verknüpft sind.
Bekennt jemand, dass er computerspielsüchtig ist, wird dies sogar bisweilen mit einem Lächeln abgetan und kaum ernst genommen
Über den überfüllten Aschenbecher im Büro sieht man hinweg, über den Kollegen, der unablässig Schokolade in sich hineinstopft und ob dessen kaum mehr in seinen Bürostahl passt auch, sogar der Bekannte, der einen am Ende des Monats um Geld bittet, weil er sein Salär für diesen Monat bereits am Automaten verspielt hat, wird mit Wohlwollen bedacht– nur, wer ein offensichtliches Alkoholproblem hat, wird geächtet.
Diese Ungleichbehandlung setzt sich auch dann fort, wenn der Suchtkranke versucht, seiner Sucht Herr zu werden.
Während Menschen, die ihre Nikotinsucht besiegt haben, Menschen, die ihrer Fresssucht Herr geworden sind und einen Zentner abgenommen haben, Menschen, die sich nicht länger die Nächte in Spielhallen um die Ohren schlagen bewundert werden, rümpft die Gesellschaft bei Menschen, die aufhören zu trinken oder ihren Alkoholkonsum reduzieren, die Nase.
Selbst der Konsum harter Drogen wird komfortabler behandelt als der Alkoholkonsum.
Kommt jemand von Koks oder Heroin weg wird er gefeiert, beim Alkohol sieht man die Bemühungen, den Konsum einzuschränken, eher kritisch.
Der Alkohol ist das einzige Suchtmittel, bei dem dies so ist. Nur, wer dem Alkohol verfallen ist, hat einen Makel und erntet Missbilligung von all' denen, die dieses Schicksal nicht, in vielen Fällen noch nicht, ereilt hat. Und auch von denen, die sich in der gleichen Situation befinden, sich dies aber noch nicht eingestehen wollen oder können.
Warum ist das so?
Warum löst der Satz „Ich trinke zu viel und versuche, es zu reduzieren“ Betroffenheit aus, und nicht etwa aufrichtige Bewunderung wie der ambitionierte Kampf gegen eine andere Sucht?
Warum geht man zu Menschen mit einem Alkoholproblem auf Distanz?
Vielleicht, weil das Wenige, was von einer Alkoholabhängigkeit sichtbar zu Tage tritt, eher abstoßend und unheimlich wirkt. Weil die Folgen des Trinkens oftmals offensichtlicher sind, als die anderer Süchte.
Der Clochard auf der Straße, der durch Alkohol bewirkte Kontrollverlust von Menschen im Umfeld, besoffene Eskapaden von Prominenten, die in den Medien breitgetreten werden.
So entsteht ein Image von Vieltrinkern, von dem sich die Gesellschaft abwendet.
Darüber hinaus glauben viele Menschen nach wie vor, dass ein problematischer Umgang mit dem Alkohol ein Ausdruck von Charakter- oder Willensschwäche, von mangelnder Disziplin oder Verwahrlosung ist. So wird gern ein Selbstverschulden unterstellt. „Wenn man wirklich will, dann kann man auch 'normal' trinken“.
Dabei ist der Alkohol vielleicht jenes Suchmittel, von dem die Entwöhnung am schwersten fällt.
Ich kann es nicht beurteilen, habe ich mit anderen Süchten doch nie zu tun gehabt, aber durchaus möglich, dass es so ist.
Die offen zur Schau gestellte Ablehnung erschwert den Umgang mit dem Alkoholproblem für den Vieltrinker immens und ist einer der Hauptgründe, warum es vielen Betroffenen so schwerfällt, sich und vor allen Dingen anderen gegenüber die Krankheit einzugestehen.
Der negative Nimbus der Alkoholsucht legt das Bagatellisieren derselben, legt ihr Negieren nah.
Auch, weil das Leugnen bei unsichtbaren Krankheiten leichter ist.
Genau deswegen gibt es anonyme Alkoholiker – meines Wissens existieren weder die „Inkognito-Kettenraucher“ noch die „nicht namentlich genannten Spielsüchtigen“.
07 - Sein statt Haben – die Alkoholkrankheit
„Alkohol ist das Schmerzmittel der Gebrochenen“
„...ein Trainer ist nicht ein Idiot! Ein Trainer sehen was passieren in Platz. In diese Spiel es waren zwei, drei oder vier Spieler, die waren schwach wie eine Flasche leer!
Und, zum Ende hin ...“Ich bin müde jetzt Vater diese Spieler, eh, verteidige immer diese Spieler! Ich habe immer die Schulde über diese Spieler. Einer ist Mario, einer, ein anderer ist Mehmet! Strunz dagegen egal, hat nur gespielt 25 Prozent diese Spiel! Ich habe fertig!“ (55).
Herrlich, einfach nur herrlich! Nicht ich bin, nein, ich HABE fertig! Kann man über den verbalen Meilenstein der Sportgeschichte des ehemaligen Bayern-Trainers Giovanni Trappattoni auch immer wieder lachen, die Verwendung der unregelmäßigen Verben „Haben“ und „Sein“ ist ein elementares Element der deutschen Sprache.
Der Begriff „Haben“ bezeichnet das Besitzen, das sein eigen nennen, die Möglichkeit, über etwas verfügen zu können. Dies sowohl im materiellen („ich habe ein Auto“), als auch im emotionalen Bereich („ich habe Angst“). Das „Haben“ kann dabei auch vorübergehender Natur sein.
„Sein“ hingegen bedeutet bestehen, existieren, stammen aus und drückt dabei die Identität dessen, der „ist“, aus. Es handelt sich also um eher längerfristig oder gar unabänderlich auf ewig existierende Zustände.
Im vorangegangenen Kapitel haben wir gelernt, dass die Alkoholsucht im Gegensatz zu anderen Süchten nicht gesellschaftlich akzeptiert ist. Betrachtet man die Alkoholabhängigkeit im Kontext zu anderen Krankheiten, kommt man zum gleichen Ergebnis.
Trotz der wissenschaftlichen verbrieften Erkenntnis, dass es sich um eine Krankheit handelt. Die 'Alkoholkrankheit' wurde 1968 in den offiziellen Krankheitskatalog aufgenommen. Dadurch wurde dokumentiert, dass der problematische Umgang mit dem Alkohol keinesfalls als Charakterschwäche anzusehen ist, der allein mit Willenskraft begegnet werden kann.
Zu einem Umdenken geführt hat dies in der großen Schar der erhobenen Zeigefinger jedoch nicht.
Auffallend ist bereits, dass, im Gegensatz zu den meisten anderen Krankheiten („Ich habe Husten“, „Ich habe ein Magengeschwür“, „Ich habe AIDS“) zur Verbalisierung eines Alkoholmissbrauchs das unregelmäßige Verb „Sein“ zu Rate gezogen wird.
„Ich bin alkoholgefährdet“, „Du bist Alkoholiker“.
Die Krankheit und das Selbst werden dadurch schon sprachlich gleichgesetzt. Man HAT keine Abhängigkeit. Man IST abhängig.
Dem Genuss von Alkohol und seinen Folgen wird durch die Verwendung von bin, bist & Co. etwas Endgültiges, etwas Unabänderliches zugesprochen, er wird quasi als eine EIGENSCHAFT, ein PERSÖNLICHKEITSMERKMAL des Betroffenen angesehen.
Ich bin – empathisch, optimistisch, humorvoll und – alkoholgefährdet.
'Ich bin' ist gleichbedeutend mit zeitlebens, mit 'ich werde es immer bleiben'.
Das mag zwar in der Sache richtig sein, sagt man doch, wer einmal alkoholabhängig ist, der bleibt dies bis ans Ende seiner Tage. Allerdings kann eine Alkoholkrankheit, auch wenn sie nach heutigem Wissensstand nicht geheilt werden kann, durchaus zum Stillstand gebracht werden.
Die gängige Meinung jedoch ist eine andere: Ein Problem mit dem Alkohol ist ein unabänderliches Persönlichkeitsmerkmal.
Und so wird der Trinkende oft auch behandelt. Viele Menschen wenden sich ab, sind distanziert demjenigen gegenüber, der eingesteht, (zu) viel zu trinken.
Weil die Alkoholkrankheit nach wie vor als persönlicher Makel, als charakterliches Defizit, als individuelle Schwäche ausgelegt wird. Unterschwellig wird sogar ein eigenes Verschulden suggeriert, schließlich hat der Betroffene sich die Alkoholika selbst beschafft oder bestellt und nicht zuletzt auch einverleibt.
Mit Menschen, die sich von einem Suchtmittel beherrschen lassen und nicht ausreichend Kraft und Moral besitzen, sich dessen Einflusses zu entziehen, will man nichts zu tun haben. Man vertraut Ihnen nicht. Und geht davon aus, dass jeder Versuch, der Alkoholabhängigkeit Herr zu werden, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.
Schließlich IST man ja Alkoholiker – und bleibt es bis ans Ende seiner Tage.
Dies führt im Umkehrschluss unweigerlich dazu, dass Menschen, die eine Schwäche für den Alkohol haben, dazu neigen, diese anderen gegenüber nicht einzugestehen.
Denn die gesellschaftliche Akzeptanz für eine Alkoholabhängigkeit ist in unserem Land der Viel- und Zuvieltrinker nur marginal ausgeprägt.
Dies liegt wahrscheinlich darin begründet, dass Alkoholabhängigkeit eine eher latente Krankheit ist. Sie tritt in weitaus geringerem Maße offensichtlich zu Tage als andere Krankheiten und ist damit weniger spektakulär.
Einen Psychiater, einen Nervenarzt oder einen Vertreter der Traditionellen Chinesischen Medizin aufzusuchen, ist durchaus hoffähig.
Anders als dem Trinker wird dem „Bekloppten“, dem „Neurotischen“ oder dem „Weggeflogenen“ nämlich kein Eigenverschulden unterstellt.
Wenn Sie sich mit einem Gipsbein, einem Kopfverband oder einer dicken Narbe unter die Leute wagen, sind sie die Attraktion auf jeder Party. Schließlich haben sie etwas zu erzählen, zudem zeugen deutlich sichtbare Zeichen davon, was sie durchmachen mussten.
„Schien- und Wadenbein sind gebrochen“ „die mussten mir den Kopf aufmachen“, „die OP hat sechs Stunden gedauert“.
Manifeste Krankheiten sind spektakulär und erzielen meist einen hohen Mitleidseffekt.
Latente Krankheiten wie die Alkoholabhängigkeit jedoch segregieren. Auch, weil der Schmerz, der hinter der Krankheit steckt, der Suchtdruck, von Nicht-Betroffenen nicht nachempfunden werden kann. So bewirkt Alkohol-abhängigkeit kaum einmal Mitleid, sondern führt eher zur Abkehr.
Andere latente Krankheiten kommen da deutlich besser weg.
Als meinen engsten Freundeskreis sehe ich sechs bis acht Personen samt deren Partnern an - möglicherweise bleibt mir ja nach der Veröffentlichung dieses Buches nur noch einer erhalten – jener, den ich in einer ähnlichen Situation wie der meinen weiß.
08 - Selbstreflektion schlägt Selbsttest – bin ich Alkoholiker?
„Haben Sie ein Problem mit dem Alkohol?“
„Nur, wenn gerade keiner in der Nähe ist“
Vor allem bei alten Menschen gehört es zur Legende. Das regelmäßige Gläschen Wein wird gern als das Geheimnis für langes Leben zitiert. Die englische Königsmutter wurde 101 Jahre alt – vielleicht gerade, weil sie gern einen oder auch mehrere Gins am Tag gebechert hat? Tatsächlich zeigen Statistiken, dass Menschen, die mäßig Alkohol konsumieren, eine höhere Lebenserwartung haben als jene, die gar keinen Alkohol trinken.
Und schon in den 20er Jahren war Pathologen aufgefallen, dass die Blutgefäße von starken Trinkern, die an Leberzirrhose gestorben waren, auffallend saubere Innenwände aufwiesen. Ein Indiz dafür, dass Alkohol das Blut besser fließen lässt.
Somit kann Alkohol, in Maßen genossen, einem Herzinfarkt vorbeugen (56).
Was aber bedeutet Maßhalten in Bezug auf den Alkoholkonsum konkret?
Experten sind sich nicht einig, welche Alkoholmenge denn als mäßig, als risikoarm gelten soll.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO nennt eine Obergrenze von 30g täglich für Männer und 20g täglich für Frauen, die Deutsche Hauptstelle für Suchfragen hält diese Menge für zu hoch. Hier werden 20-24g (Männer) beziehungsweise 10-12g (Frauen) als Obergrenze angesehen.
Zehn Gramm Alkohol befinden sich in 0,125l Wein oder aber 0,25l Bier. Zudem sollten zusätzlich zwei alkoholfreie Tage pro Woche eingelegt werden (57).
DER anerkannte Richtwert für die Tagesration Alkohol, die allerhöchstens getrunken werden sollte, existiert nicht.
Von großer Bedeutung sind zudem auch genetische Faktoren. Es gibt Menschen, die ihr Leben lang übermäßig viel Alkohol trinken und trotzdem ein hohes Alter in guter gesundheitlicher Verfassung erreichen. Die Großmutter eines guten Freundes zum Beispiel war starke Alkoholikerin, doch als sie im hohen Alter starb und obduziert wurde, stellte der Pathologe fest, dass man ihre Leber bedenkenlos zur Transplantation hätte freigeben können – der jahrzehntelange Alkoholmissbrauch hatte ihr nichts anhaben können. Solche Fälle sind jedoch wohl eher zu den Ausnahmen zu zählen; jene, in denen der Alkohol beträchtliche Folgeschäden bis hin zum Tod zur Folge hatte, sind wesentlich häufiger.
Gefährdet oder bereits abhängig? Trinkt ein Mensch auffallend regelmäßig und viel Alkohol, kommen er oder seine Vertrauten irgendwann an den Punkt, sich zu fragen, ob das Trinkverhalten des Betroffenen noch „normal“ ist, oder ob er bereits ein Problem mit dem Alkoholkonsum hat.
Um diese Frage zu beantworten, gibt es im Internet zahlreiche „Alkohol-Selbsttests“.
Ein Testverfahren, welches häufig zur Bestimmung der Abhängigkeit von Vieltrinkern herangezogen wird, ist der vom Psychotherapeuten Dr. Rolf Merkle für den PAL-Verlag entwickelten „Alkohol-Sucht-Test“ (58).
Anhand von 54 Fragen, die der Trinkende beantwortet, wird sein Abhängigkeitsstatus bestimmt.
Wichtig ist natürlich, ehrlich und ohne jeglichen Selbstbetrug zu antworten, sich nichts schön zu reden, auch, wenn es bisweilen schwerfallen mag, sich gewisse Aspekte selbst einzugestehen.
Sie haben sich entschlossen, dieses Buch zu lesen, also wollen Sie eine ehrliche Antwort auf die Frage, wie es um Ihre Alkoholabhängigkeit steht. Diese erhalten Sie jedoch nur dann, wenn Sie den Test wahrheitsgemäß und nach bestem Gewissen absolvieren.
Die Fragen 1 bis 54 beziehen sich auf die vier Phasen einer Abhängigkeitsentwicklung:
Alkohol ist für mich die beste Medizin
Wenn ich Alkohol trinke, fühle ich mich stark und leiste mehr
Wenn ich Alkohol trinke, bin ich zufrieden und fühle
mich erleichtert
Ich trinke auch, weil ich mich dadurch selbstsicherer
fühle
In Gesellschaft fühle ich mich unbefangener und wohler, wenn ich einige Gläser getrunken habe
Ich kann mit Alkohol viel besser aus mir herausgehen
Ich trinke, um Ärger und Schwierigkeiten vergessen zu
können
Wenn ich getrunken habe, fällt mir alles viel leichter
Wenn ich Hemmungen habe oder angespannt bin, dann geht es mir mit Alkohol viel besser
Wenn ich traurig bin, trinke ich Alkohol und fühle mich dann besser
Ich trinke, um mit schwierigen Angelegenheiten besser
fertig zu werden
Alkohol hilft mir, Ärger oder eine schlechte Laune zu beheben
Wenn ich getrunken habe fühle ich mich innerlich ruhig und kann schlafen
Damit die anderen nicht schlecht von mir denken, trinke ich oft heimlich
Ich denke unter Tag ziemlich oft an Alkohol
Vor einem Besuch oder einem Fest hebe ich erst mal
schnell einen, um in Stimmung zu kommen
In Gesellschaft trinke ich schon mal in der Küche, auf dem Gang, auf der Toilette oder woanders, damit die anderen nicht merken, wie viel ich trinke
Manchmal habe ich Schuldgefühle, weil ich so viel trinke
Wenn andere über Alkohol sprechen, ist mir das unangenehm
Mir ist aufgefallen, dass andere Leute anders trinken als ich
Ich habe mich schon gefragt, ob andere wegen meines Trinkens nichts mehr von mir wissen wollen
Wenn ich viel getrunken habe, weiß ich häufig danach nichts mehr oder kann mich nur noch schlecht erinnern
Ich verstecke alkoholische Getränke
Wenn ich die ersten Gläser getrunken habe, muss ich weitertrinken
Meist kann ich nicht mehr kontrollieren, wie viel ich trinke
Ich trinke heute mehr als früher, obwohl ich es gar nicht will
Wenn ich heute trinke, lösen sich meine Anspannungen nicht mehr. Früher war das anders
Wenn ich auf mein Trinken angesprochen werde, benutze ich Ausreden und Entschuldigungen, weshalb ich so viel trinke
Meine Familie und Freunde machen mir Vorhaltungen wegen meiner Trinkerei
Meinem Chef und den Arbeitskollegen ist mein Trinken aufgefallen
Wenn jemand versucht, mich vom Trinken abzuhalten, dann werde ich wütend
Häufig mache ich mir selbst die größten Vorwürfe wegen meiner Trinkerei
Zeitweise habe ich schon versucht, völlig ohne Alkohol zu leben
Ich nehme mir vor, nur zu bestimmten Zeiten und
Gelegenheiten zu trinken
Mein Lebensstil und meine Arbeit richten sich nach dem Trinken.
Ich denke immer mehr an den Alkohol
Ich trinke lieber heimlich und alleine, weil die anderen mich ja doch nicht verstehen
Ich habe schon mehrmals infolge meiner Alkoholprobleme die Stelle gewechselt
Mein Trinken hat sich schon auf das Familienleben
ausgewirkt (zB. getrennte Wohnung, getrennte Schlafzimmer)
Ich muss immer einen Vorrat an Alkohol haben
Mein Partner hat wegen meiner Alkoholprobleme von
Scheidung gesprochen / die Scheidung eingereicht
Morgens -vor dem ersten Schluck- zittere ich
Morgens trinke ich regelmäßig
Ich war schon oft unter Tage betrunken
Ich habe schon einige Tage hintereinander getrunken und konnte nichts mehr anderes tun
Ich brauche ständig Alkohol, egal, was passiert
Manchmal kann ich nicht mehr richtig denken, da ich vom Alkohol benebelt bin
Ich habe schon mit Leuten getrunken, mit denen ich mich früher nicht an einen Tisch gesetzt hätte
Wenn ich nichts anderes habe trinke ich auch mal Fusel, Hauptsache Alkohol
In letzter Zeit vertrage ich Alkohol nicht mehr richtig.
Ich kann nicht mehr aus einer Tasse trinken oder mich rasieren, ohne etwas getrunken zu haben
Mein Trinken ist zwanghaft
Wenn ich nichts trinke, hört das Zittern überhaupt nicht mehr auf
Ich hatte schon mal ein Delirium
Es gibt nach diesem Ansatz vier Phasen der Alkoholabhängigkeit.
1.Phase: Erleichterungs- oder Problemtrinken (Frage 1-13)
2.Phase: Stadium, das der Abhängigkeit vorausgeht (14-24)
3.Phase: Verlust der Selbstkontrolle (25-44)
4.Phase: Chronische Phase (45-54)
Können Sie zwei oder mehr Feststellungen in einer Phase bejahen, dann ist das schon ein Anzeichen dafür, dass Sie sich in dieser Phase befinden könnten.
Es ist möglich, dass Sie sich gemäß der Auswertung gleichzeitig in zwei Phasen aufhalten. In diesem Fall befinden Sie sich in der höheren von beiden Phasen.
Auch, wenn das Ergebnis des Tests besagt, dass Sie „nur“ gefährdet sind, also keine der Fragen 25 bis 78 mit ja beantwortet haben, sollten Sie das Ergebnis nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Entwicklung einer Abhängigkeit ist ein schleichender und lautloser Prozess.
Die körperliche Abhängigkeit kündigt sich nicht an. Sie klopft nicht eines Tages an Ihre Tür und verkündet Ihnen, dass Sie am nächsten Tag körperlich abhängig sein werden, wenn Sie heute nicht mit dem Trinken aufhören.
Wenn Sie sich in Phase 3 oder 4 befinden, empfiehlt der PAL-Verlag, sich an eine Suchtberatungsstelle zu wenden oder zu einem Treffen der Anonymen Alkoholiker zu gehen.
Der Selbsttest des PAL-Verlages mag ein geeignetes Instrument sein, um herauszufinden, wie es um den eigenen Alkoholkonsum oder die eigene Alkoholabhängigkeit aktuell bestellt ist.
Er umfasst verschiedene Aspekte des Trinkverhaltens und berücksichtigt viele Einflussfaktoren.
Ein weiterer Alkohol-Selbsttest wurde vom Psychiater Paul McLaren von der Londoner Beratungsstelle Priory’s Fenchurch Street Wellbeing Centre entwickelt.
Der Vieltrinker sollte sich laut McLaren zunächst folgende Fragen stellen:
Ist mir Alkohol wichtig?
Gehe ich lieber einen trinken, als etwas anderes zu
unternehmen?
Beeinflusst es meinen restlichen Tagesablauf, wenn ich etwas trinken gehe?
Hängt die Wahl meiner Verkehrsmittel von meinem
Alkoholkonsum ab?
Beeinflusst mein Alkoholkonsum meine Freizeitaktivitäten und meine Liebsten?
Mache ich meine Reiseziele davon abhängig, ob ich an
diesen Orten Alkohol trinken kann?
Bin ich eher bereit, für Alkohol Geld auszugeben, als für andere Dinge?
Weiß ich bereits vor dem Trinken, dass ich danach einen Kater haben werde?
Wer die meisten Fragen mit "Ja" beantworten kann, sollte tiefer ins Detail gehen, indem er weitere dreizehn Fragen, die auf einen zu hohen Alkoholkonsum hinweisen können, beantwortet.
Ohne Alkohol fällt es Ihnen schwerer, Spaß zu haben oder sich zu entspannen.
Sie konsumieren regelmäßig mehr als 14 Alkoholeinheiten pro Woche. Das sind eineinhalb Flaschen Wein mit niedrigem Alkoholgehalt (elf Volumenprozent), eine Dreiviertel-Flasche Wein mit hohem Alkoholgehalt (14 Volumenprozent) oder sechs bis acht Dosen Bier (abhängig vom jeweiligen Alkoholgehalt)
Sie fragen sich, wo Sie den nächsten Drink herbekommen könnten und machen Unternehmungen mit Freunden, der Familie oder mit Arbeitskollegen davon abhängig, ob Sie dabei Alkohol trinken können.
Sie trinken aus Gewohnheit und wenn Sie einmal angefangen haben, können Sie nur schwer aufhören.
Wenn Sie nach einer durchzechten Nacht aufwachen, möchten Sie am liebsten gleich weiter trinken
Sie wachen regelmäßig mit Filmrissen auf, weil Sie sich am Abend zuvor maßlos betrunken haben.
Ihr Alkoholkonsum löst Ängste, alkoholbedingte Depressionen und Selbstmordgedanken in Ihnen aus.
Sie leiden unter körperlichen Entzugssymptomen wie Schwitzen, Zittern oder Übelkeit und Sie können diese Symptome nur durch den Konsum von Alkohol abstellen.
Einige Ihrer Angehörigen haben bereits Bedenken zu Ihrem Alkoholkonsum geäußert.
Sie erzählen Ihren Angehörigen nicht, wie viel Sie wirklich trinken.
Sie gehen Risiken ein - und fahren beispielsweise betrunken oder leicht angetrunken Auto.
Sie trinken in der Mittagspause Alkohol und arbeiten danach weiter.
Sie versuchen, Ihre Alkoholfahne durch Kaugummi oder Mundsprays zu verbergen.
Wer die meisten Fragen mit "Ja" beantworten kann, sollte sich schleunigst Gedanken über seinen Alkoholkonsum machen, so McLaren.
Doch was tun, wenn die Anzeichen auf mich zutreffen?
Ist man noch nicht so tief im Suchtstrudel gefangen ist, sollte man sich als nächstes als Ziel setzen, die Alkoholeinheiten zu reduzieren – oder besser ganz mit dem Trinken aufzuhören (59).
Im Test vom PAL-Verlag muss ich stolze 25 von 54 Fragen mit „Ja“ beantworten, beim Test von Paul McLaren sind es 7 von 13. Bin ich somit alkoholabhängig? Womöglich.
Alkohol-Selbsttests sind zwangsläufig recht allgemein gehalten und nicht in der Lage, die individuelle Situation, in der der Trinkende sich befindet, realitätsgetreu abzubilden. Problematisch ist zudem, dass man oft sein „jein“ ankreuzen müsste, wenn man ehrlich zu antworten gedenkt.
Sie sind für den Vieltrinker ein hilfreiches Instrument, gerade dann, wenn er beginnt, sich ernsthaft mit der drohenden Gefahr der Alkoholabhängigkeit auseinanderzusetzen und das Stadium der Entwicklung hin zum Alkoholiker, in welchem er sich befindet, ausfindig zu machen.
Zielführender noch, als Selbsttests wie die oben beschriebenen zur Frage der Alkoholabhängigkeit zu Rate zu ziehen, ist es, das eigene Verhalten in Verbindung mit Alkohol akribisch zu beobachten und zu analysieren.
Es gehört bei mir seit jeher zur Gewohnheit, im Urlaubsdomizil angekommen, zuerst einmal ans Meer und danach in einer urigen einheimischen Lokalität 2,3 Bier trinken zu gehen. So halte ich es auch in Marokko. So will ich es halten, denn: an meinem Urlaubsort wird außerhalb der Hotels kein Alkohol ausgeschenkt.
Der Islam ist auch in Marokko nicht nur Religion, sondern Gesellschaftsordnung und Wirtschaftsfaktor gleichermaßen und spielt deshalb auch im Geschäftsleben eine Rolle.
Ich sitze also in einem Lokal am Strand von Marrakesch mit wunderschönem Blick auf das Meer, nur: genießen kann ich diesen kaum. Ich bin unruhig, möchte mich nicht mit einem Kaffee zufriedengeben, meine Gedanken kehren immer wieder zu dem einem Thema zurück: Gibt es vielleicht irgendwo eine Art Kiosk, einen kleinen Supermarkt, eine Tankstelle, gibt es irgendeinen Ort in der Nähe des Strandes, an dem es möglich ist, Bier zu kaufen?
Ich frage vorbei flanierende Touristen – Fehlanzeige. So unangenehm es mir auch ist, nun muss der Kellner dran glauben – keine Chance, nur in den Hotels.
So sehr ich Strand und Meer auch genieße, ich sehne mich nach dem Moment, an dem ich mir, an der Hotelbar sitzend, mein erstes „Urlaubsbier“ gönne. Ist dieses Verhalten, dieses Denkmuster noch „normal“? Kaum, eher wohl ein Hinweis auf eine, zumindest drohende, Abhängigkeit.
Zumal sich die beschriebene Situation nicht nur auf den Strandurlaub beschränkt. Denn diesen „Biernotstand“, dieses Gefühl, welches beinahe Panik gleichkommt, wenn ich in eine Situation gerate, in der kein Bier greifbar ist, empfinde ich durchaus auch in anderen Situationen.
Da ist die Geburtstagsfeier in einem Kreis von Menschen, die nicht unbedingt meine Wellenlänge sind. Man trifft sich in ländlicher Atmosphäre, schon bei der Anfahrt fühle ich mich unwohl und checke die Umgebung ab: keine Kneipe, in die ich „flüchten“ könnte, kein Supermarkt, kein Kiosk – nichts. In der Gaststätte sitzt man gediegen am Tisch, ich kann kaum alle zwanzig Minuten ein Bier bestellen. Keine Lösung in Sicht. Unwohlsein überkommt mich.
Oder der Besuch von kulturellen Events, mit denen ich absolut nichts anzufangen weiß. Mit einer meiner Lebensgefährtin hatte ich in der Phase des ersten 'Verliebtseins', in der ich noch glaubte, kaum einen Moment ohne meine neue Herzdame auskommen zu können, folgenden Kompromiss geschlossen: sie begleitet mich, ungeachtet der Tatsache, dass sie mit Fußball nichts am Hut hat, am Samstagnachmittag auf den Betzenberg zum Heimspiel meines Herzensvereins, ich revanchiere mich, indem wir am gleichen Abend ihrem Hobby frönen und gemeinsam eine Travestieshow besuchen. Männer in Frauenkleidung, die in ziemlich überdrehter Art und Weise Frauenrollen verkörpern – damit kann ich -zumindest nüchtern- wenig anfangen. Und so trinke ich zum 'Vorglühen' schon einmal zwei Flaschen Bier vor dem Betreten des Theaters. Dem adäquaten Pegel für ein solches Event werde ich an der Bar des Etablissements bevor die Show beginnt weiter auf die Sprünge helfen. Die sprichwörtliche Ernüchterung trifft mich, als ich der dort ausliegenden Getränkekarte gewahr werde: Nur Prickelbrause (Sekt) und Flips (Cocktails). In diesem Fall weicht die aufkommende Panik schnell einem Gefühl der Erleichterung. Selbstverständlich habe ich auf dem Weg von der Bahnhaltestelle zum Theater registriert, dass sich in unmittelbarer Nähe desselben zwei Kioske befinden. „Ich muss mal“ oder „... + telefonieren“ - spätestens in der Pause werde ich kurz vor die Tür gehen.
Situationen, in denen ich mich einfach wohler fühle, wenn ich einen gleichbleibenden Alkoholspiegel im Blut habe und wenn ich vor allem WEISS, dass ich, sollte die Situation es erfordern, umgehend auf Alkohol zurückgreifen kann.
Und Situationen, die mir klar machen, dass Bier und Wein eine zu bedeutende Rolle in meinem Leben zukommen.
Eines der bedeutendsten Kriterien zur Einschätzung der Alkoholabhängigkeit eines Trinkenden ist meines Erachtens der Gebrauch von „Wenn-dann-Konstruktionen“.
WENN
jemand nahestehendes stirbt
ich Probleme auf der Arbeit habe
meine Partnerin mich verlässt
ich ernsthaft erkranke
ich finanzielle Probleme habe.
DANN, ja dann trinke ich Alkohol.
Allein die Tatsache, dass es gewisse, in unregelmäßigen zeitlichen Abschnitten wiederkehrende Situationen gibt, auf die man unweigerlich und postwendend mit dem Konsum alkoholischer Getränke reagiert, beschreibt eindeutig eine Abhängigkeit.
Ich tue mich schwer damit, mich als Alkoholiker zu bezeichnen, weil ich damit eigentlich das tägliche Trinken von früh morgens bis spät abends, und vor allem das „besoffen sein“, verbinde.
Das alles will ich gar nicht, mir geht es nie um das Betrunken-Sein, sondern nur um dieses wohlige Gefühl, das sich einstellt, wenn ich ein gewisses Maß an Alkohol im Blut habe.
Trotzdem muss ich mir infolge der immer wiederkehrenden „Wenn-dann-Situationen“ eingestehen, dass ich zumindest partiell abhängig vom Alkohol und damit alkoholgefährdet bin.
Wenn-dann-Konstruktionen gefährden auch den gefassten Vorsatz, den Alkoholkonsum zu reduzieren und gesundheitsverträglich zu gestalten, wenn man sie nicht nur in Krisensituationen einsetzt, sondern auch im Hinblick auf alltägliche Trinkentscheidungen zu Rate zieht.
Ein Beispiel gefällig?
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.