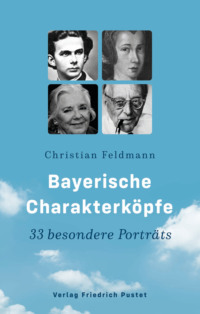Kitabı oku: «Bayerische Charakterköpfe», sayfa 3
Gottes „Verstandeslicht“ erhellt die Welt
Natürlich geht es in der Theologie um mehr als um Erkennen und Wissen. Es geht um das letzte Glück des Menschen, um die Leidenschaft für Gott, die Verstand und Willen mitreißt. Aber lieben kann man nur, was man kennt. Darum nimmt Albert die Ansätze begeistert auf, mit denen der große Aristoteles bereits von einer mündigen Welt spricht und von der Eigengesetzlichkeit der Naturvorgänge.
Als Albert beschloss, sein Bild von der Welt nicht auf das Studium antiker Gewährsleute zu gründen, sondern auf die eigene Erfahrung, setzte er sich damit in Gegensatz zu allen Naturkundigen seiner Zeit. „Das Experiment allein gibt Gewissheit“, hieß sein Motto. „Ein Grundsatz, der vom praktischen Versuch nicht bestätigt wird, ist kein Grundsatz.“ Und: „Es ist nicht genug, zu sagen, das geschieht durch ein Wunder. Wir müssen Rechenschaft geben!“
Deshalb war sich der gefeierte Professor Albert nicht zu schade, eigenhändig das Auge eines Maulwurfs zu sezieren oder durch eigene Geschmackstests herauszufinden, wo der Saft der Bäume am bittersten ist: in der Wurzel nämlich. Deshalb unternahm er ausgedehnte Studienreisen, um in Bergwerken Metalle zu analysieren. In einer Zeit, als den Menschen die ungerodete Natur noch als finstere Bedrohung erschien, staunte Albert, der prächtigste Dom sei im Vergleich zu einem majestätischen Tannenwald doch nur ein wüster Steinhaufen.

Gott ist in der Welt durch Zeichen seiner Gegenwart. Da nämlich der Schöpfer kraft Vernunft und Verstand alles schuf, ist er in der Welt, weil er darin Zeichen seines Verstandeslichtes zurückgelassen hat.“
Die Liebe zur Erde trieb ihm nicht die Sehnsucht nach dem Himmel aus – im Gegenteil. Das eigentliche Wunder war ihm nicht ein spektakuläres Eingreifen Gottes in die natürlichen Abläufe, sondern das ganz alltägliche Funktionieren der Natur nach den sinnvollen Gesetzen, die der Schöpfer in sie hineingelegt hat und die von der menschlichen Vernunft zu erforschen sind.

Der erhabene Gott regiert die Naturdinge und leitet sie durch natürliche Ursachen, und diese suchen wir hier, weil wir die göttlichen – uns nicht so nahe – nicht so leicht finden können.“
Die Natur erhält ihren eigenen Wert zurück – und wird damit entzaubert. Die Menschen haben sie gefürchtet und zum Geisterreich erklärt; jetzt dürfen sie die Natur als Kreatur Gottes, des einzigen Herrn über alle Dinge, bewundern und lieben. Ein Leben lang hat Albert seine Umwelt mit einer fast besessenen Leidenschaft beobachtet. Auch noch, als er in Köln die erste deutsche Hochschule aufbaute und bald darauf zum Provinzial der deutschen Dominikaner gewählt wurde.
Albertus war damals schon ein Sechziger, aber wie ein Wandermönch zog er von Kloster zu Kloster, durch halb Europa: Polen, Frankreich, die Schweiz, die Niederlande, immer zu Fuß. Auf Landstraßen und Ackerwegen, an Flussufern und Meeresstränden machte er epochale Beobachtungen. Als erster Zoologe beschrieb er den Zug der Krähen und die Lebensgewohnheiten von Wiesel, Marder und Haselmaus. Er wusste, dass Spechte von Larven leben, die sie aus der Baumrinde heraushacken, und dass der Uhu eine seiner Zehen nach Lust und Laune vor- und rückwärts bewegen kann. Eigenhändig untersuchte Meister Albert das Verdauungssystem der Bienen; er entdeckte den Bauchnervenstrang bei den Insekten.
Gelehrtes Genie und armer Bettelmönch
Doch „will man fragen nach den tiefsten Geheimnissen Gottes“, mahnte er seine Professorenkollegen, „so frage man nach dem ärmsten Menschen, der mit Freude arm ist aus Liebe zu Gott; der weiß von den Geheimnissen Gottes mehr als der weiseste Gelehrte.“ Ein Mensch, der seinem Nächsten in seinem Leid zu Hilfe komme, soll Albert einmal gesagt haben, handle besser als jemand, der auf dem Pilgerweg von Schwaben bis Rom bei jedem Meilenstein ein Münster aus reinem Gold errichten würde. Denn Jesus Christus sei nicht um einer Kathedrale willen gestorben, sondern für den Menschen.
Fromm wie ein Kind, bedürfnislos wie ein Eremit, lebte der international geschätzte Wissenschaftspionier das arme Leben eines Bettelmönchs. Unerbittlich kämpfte er gegen klerikale Machtpolitik und Habgier. Einem Kölner Prälaten, der ihm stolz berichtete, die römische Kurie habe ihm den Besitz mehrerer einträglicher Pfründen gleichzeitig erlaubt, entgegnete er sarkastisch: „Jawohl, jetzt könnt Ihr mit Erlaubnis zur Hölle fahren!“ Im Dominikanerorden setzte der Provinzial Albertus sehr schmerzhafte Konkretisierungen des Armutsgelübdes durch.
Auf seine Initiative beschloss das Ordenskapitel, Dominikaner müssten in Zukunft beim Reisen auf einen Wagen verzichten und dürften sich ohne triftigen Grund auch nicht von einem Wagen mitnehmen lassen. Führende Ordensmitglieder, die gegen das Armutsgebot verstießen, wurden unnachsichtig bestraft oder sogar abgesetzt. Albert ging selbst mit gutem Beispiel voran: Seine Reisen durch Europa machte er grundsätzlich zu Fuß, unter härtesten Bedingungen, in sommerlicher Gluthitze, bei Eis und Schnee, ein armer Wandermönch.
Und das Verblüffendste: In den Marschpausen legte sich der erschöpfte Wanderer nicht etwa auf die faule Haut. Für ihn war das die Mußezeit zum Schreiben seiner hochgelehrten Abhandlungen über Ethik und Metaphysik, Logik, Mathematik, Zoologie und Botanik – vierzig Bände im Lexikonformat in der kritischen Neuausgabe. Dieses Riesenwerk, welches das gesamte Bildungsgut der damaligen Zeit ordnet, entstand in bescheidenen Herbergen und in den Gastzellen irgendwelcher Klöster. Machte man an der Landstraße Rast, so zog Albert gern eine Pergamenthandschrift mit Aristoteles-Texten aus seinem Bündel. Kam er in ein Kloster, durchforstete er regelmäßig die Bibliothek und schrieb sich aus Büchern, die er noch nicht kannte, in aller Eile die interessantesten Stellen ab.

Naturverliebt: Albertus Magnus
Natürlich geriet der unbestechliche Prophet einer armen Kirche oft genug in Konflikt mit den Machtinteressen besitzstarker Bischöfe und Kardinäle. Er führte eine offene Sprache, wenn es um die Sünden der Kirchenleitung ging, genoss an der römischen Kurie aber dennoch einen so guten Ruf, dass man den Siebenundsechzigjährigen 1260 plötzlich zum Bischof von Regensburg machte.
Ein Bischof als Finanzminister
Regensburg, das war damals ein ausgeplündertes, verrottetes Bistum, das niemand haben wollte. Alberts Vorgänger, ein gewisser Graf von Pietengau, hatte die Diözese mit skrupelloser Machtpolitik, Krieg und Mord zugrunde gerichtet. Ein Bettelmönch als neuer Bischof, als Reichsfürst – in einer auf Geld und Pomp versessenen Kirche mochte das durchaus als Signal zur Umkehr verstanden werden.
Ohne jeden Prunk zog er zu Fuß in seine Bischofsstadt ein. Er fand die Vorratsspeicher leer, dafür Schulden in astronomischer Höhe. „Nahrung für ihn und sein Gesinde gab es nicht“, berichtet ein Chronist schaudernd, „auch kein Futter für die Pferde. Es war nichts vorhanden, was auch nur den Wert von einem Ei gehabt hätte.“
Albert, das Multitalent, wurde auch mit dieser Herausforderung fertig. Der Naturforscher und Theologe verwandelte sich in einen Finanzminister. Er traf geschickte Maßnahmen zur Haushaltssanierung; binnen eines Jahres war das Bistum tatsächlich schuldenfrei. Die Menschen dankten es ihm nicht. Die einfachen Leute zeigten sich enttäuscht von dem Hungerleider auf dem Bischofsthron, der ihnen das Schauspiel der Prachtentfaltung vorenthielt und auf alle Zeichen seiner Würde verzichtete.
Bisher hatte man im Gefolge des Bischofs prunkvoll aufgeputzte Rösser bewundern können. Albert aber pflegte zu Fuß durch seine Diözese zu marschieren. Ein Esel trug die Gewänder für den Gottesdienst. Unangemeldet tauchte er zur Visitation auf, leitete eine Klosterreform ein, suchte sich qualifizierte Laien zur Verwaltung der Bistumsfinanzen.
Von seinen Predigten aber zeigten sich die Menschen fasziniert. Albert fing das ausgesprochen geschickt an: Er ließ seine wichtigsten Sätze von Malern zusammen mit eingängigen Illustrationen auf Holztafeln übertragen, die dann in den Kirchen aufgestellt wurden. Diese sogenannten Alberti-Tafeln fanden bis nach Westfalen und Österreich Verbreitung; heute können sie in Museen bewundert werden. Die Merksprüche des Bischofs wollen deutlich machen, worauf es beim Christsein wirklich ankommt:

Verurteile niemand, das ist Gott wohlgefälliger, denn dass du dein Blut vergießest sieben Stunden am Tag.“ „Wer ein hartes Wort geduldig erträgt in der Liebe unseres Herrn, das ist Gott wohlgefälliger, denn dass er zerschlüge auf seinem Rücken so viel Besen, als auf einem ganzen Acker gewachsen sind.“
„Geh selber zu Gott, das ist dir nützer, denn dass du all die Heiligen und alle die Engel hinsendest, die im Himmel sind.“
Zwei Jahre nach seiner Bischofsweihe gab Albert das Amt zurück. Das Reformprogramm war eingeleitet, ein guter Nachfolger stand bereit. Der Wandertrieb erfasste ihn wieder. Wir finden ihn in Augsburg, Würzburg, Frankfurt, Köln, im Elsass, in Brandenburg, in Basel und Antwerpen. Er weihte Kirchen ein, erstellte Gutachten, schrieb Bücher, betätigte sich als Schiedsrichter: Alberts Name steht unter rund hundert Friedensschlüssen aus jener Zeit. Damals hatte er schon die achtzig überschritten.
Erst in Alberts allerletzten Lebensjahren setzte ein rapider Verfallsprozess ein. Die Sehkraft ließ nach, Arthrose und Gicht plagten den alten Mann. Eine Legende deutet den körperlichen Verfall auf zarte Weise als Berührung Gottes: Während einer Vorlesung verließ den greisen Lehrer plötzlich sein Gedächtnis, und er musste abbrechen. Die Zuhörer waren bestürzt. Nach einer Weile fasste sich Albertus und erzählte seinen „lieben Brüdern“, vor vielen Jahren sei ihm die Gottesmutter erschienen und habe ihm prophezeit, Gott werde durch seine Wissenschaft die ganze Kirche erleuchten. Damit er aber nicht dem Hochmut verfalle, werde Gott vor seinem Tod alle Weisheit von ihm nehmen und ihm die Einfalt eines Kindes wiedergeben.
Am 15. November 1280, im gesegneten Alter von über achtzig Jahren, starb Albert der Große einen friedlichen Tod, im Sessel sitzend, umringt und getröstet von seinen Mitbrüdern.
„Bernauerin auf dem Wasser schwamm, Maria Mutter Gottes hat sie gerufet an“
„Darum hat sie ertränkt werden müssen“
Warum die unglückliche Liebe zwischen Agnes Bernauer (um 1410–1435) und dem Herzogssohn Albrecht ein schreckliches Ende fand
Als sie die zierliche Frau ins Wasser warfen, von der alten Donaubrücke in Straubing, gelang es ihr mit der Kraft der Verzweiflung, ihre Beinfesseln zu lösen und in die Nähe des Ufers zu schwimmen, wobei sie mit heiserer Stimme schrie: „Helft, helft!“ Unter den zahlreichen Zuschauern erhob sich ein Murren gegen die grausame Justiz. Eilig lief der Folterknecht, der die Verurteilte von der Brücke gestürzt hatte und den Zorn seines herzoglichen Auftraggebers fürchtete, herzu und drückte die sich Aufbäumende mit einer langen Stange so lange unter Wasser, bis sie tot war.
So schildert der Chronist Andreas von Regensburg das elende Sterben der „Bernauerin“ am 12. Oktober 1435. Ansonsten sind nicht viele geschichtliche Tatsachen von Agnes Bernauer überliefert. Nur die Kunde von ihrer bezaubernden Schönheit und von ihrer unglücklichen Liebesbeziehung zu Albrecht, dem Sohn des Bayernherzogs Ernst, hat die Jahrhunderte überdauert. Das Volk – das zeigen die landauf, landab bekannten Lieder und Festspiele – hat der damals im Interesse kühler Erbfolgepolitik als Hexe und Kupplerin verurteilten „Bernauerin“ immer die Treue gehalten.
Heuchlerische Doppelmoral
Die Geschichte der um 1410 geborenen Agnes Bernauer beginnt in einer Augsburger Badstube, und die meisten Historiker halten sie für eine Baderstochter – manche aber auch für die aus Biberach stammende Magd des Baders. Sie muss eine strahlende Schönheit gewesen sein, mit einer makellosen Figur, feinen Gesichtszügen und prächtigen blonden Haaren. Der Chronist Veit Arnpeck macht ihr das fantasievolle Kompliment: „Man sagt, dass sie so hübsch gewesen sei, wann sie roten Wein getrunken habe, so habe man den Wein in ihrer Kehle hinab fließen gesehen.“

Justizopfer: Agnes Bernauer
Dort in der Badstube haben sie sich vermutlich kennen gelernt, Agnes und der bayerische Thronfolger Albrecht III., der einzige Sohn des Herzogs Ernst von Bayern-München, und das wäre noch kein Problem gewesen, denn die hohen Herren hielten sich gern Geliebte aus niederem Stand. Aber das ungleiche Paar wollte seine Verbindung legalisieren, und das war für die höfische Gesellschaft mit ihrer heuchlerischen Doppelmoral eine Todsünde.
Die Badstuben – Vorstufen unserer Saunen – waren damals im 15. Jahrhundert äußerst beliebt als Stätten der Erholung und Lust. Stundenlang plätscherten, spielten, musizierten, aßen und tranken die Gäste beiderlei Geschlechts im warmen Wasser, bedient von liebreizenden „Bademädchen“. „Willst du einen Tag fröhlich sein? Geh ins Bad!“, hieß es in einer frühen Reklame. Die Kirche lief Sturm gegen das Badewesen, das freilich sehr gut in eine Zeit der Extreme passte, in der sich härteste Askese mit ausschweifender Maßlosigkeit paarte, streng bemessene höfische Minne mit dumpfer Erotik.
Irgendwie passt Agnes, die von den Chronisten immer wieder als zurückhaltender, auf die eigene Ehre bedachter „Engel“ geschildert wird, nicht recht in dieses Ambiente – ebenso wenig wie der Herzogssohn Albrecht, der als mutig, gerecht, sensibel, fromm beschrieben wird, als Gegner brutaler Strafen und als Freund der kleinen Leute. Das alles zählte nicht; wer in einer Badstube arbeitete, gehörte automatisch zur niedrigsten Schicht und zu einem verfemten Beruf.
Und ob Agnes und Albrecht 1432 tatsächlich heimlich heirateten, wie viele Forscher annehmen, oder ob Agnes immer nur die Geliebte des Thronfolgers blieb, in den Augen der feinen Gesellschaft war diese Beziehung indiskutabel, und vor allem stellte sie eine politische Gefahr dar. Eine derartige „morganatische“ Ehe zwischen völlig unebenbürtigen Partnern schloss die übliche Erbberechtigung für Gemahlin und Kinder aus (deshalb übereignete Albrecht seiner Agnes einen Bauernhof in Niedermenzing als Absicherung); mögliche Nachkommen hätten den Herzogsstuhl Bayern-München also keinesfalls übernehmen dürfen.
Blamage beim Turnier
Die eigentliche Gefahr lag woanders: Die Bindung an eine derart unmögliche Partnerin – sei es nun eine Gattin oder eine Geliebte – führte ja dazu, dass sich der bereits dreiunddreißigjährige Herzogssohn mit keiner Fürstentochter verehelichen konnte. Was sämtliche politischen Strategien durcheinander brachte und die bayerische Führungsschicht – Ratsherren, Beamte, Patrizier – derart verärgerte, dass Albrecht 1434 auf einem Turnier in Regensburg „angegriffen und geschlagen“ wurde. So formuliert es der Geschichtsschreiber Andreas; es bleibt offen, ob es sich um einen tätlichen Angriff von Standesgenossen handelte oder um den Ausschluss vom Turnier, wie ihn die „Stechordnungen“ für Ritter mit einem offen unmoralischen Lebenswandel vorsahen.
Beides war jedenfalls eine fürchterliche Blamage für das Herrscherhaus. Herzog Ernst hielt seinem Sohn eine gewaltige Standpauke und entzog ihm die Verwaltungsaufgaben in der Straubinger Nebenresidenz, wo er bisher tätig gewesen war. Urkunden und Briefe mit Albrechts Siegel stammen in der nächsten Zeit nur mehr aus dem Grafenschloss in Vohburg, wo er jetzt mit der schönen Agnes lebte. Doch Albrecht dachte nicht daran, sich von der „Badhur“, wie man sie boshaft nannte, zu trennen. Er hatte immer schon seinen eigenen Kopf gehabt und war bemüht gewesen, ein eigenes politisches Profil gegenüber dem sehr konservativen Vater zu gewinnen.
Um das Problem endgültig zu lösen, ließen sich Herzog Ernst und die höfische Elite eine teuflische List einfallen: Als Albrecht gerade in Landshut weilte und Agnes in Straubing, wurde sie verhaftet und vor dem herzoglichen Gericht in einem Eilverfahren der Zauberei und des versuchten Giftmords an Herzog Ernst angeklagt. Das Urteil stand von vornherein fest, die Zeugen sagten aus, was die Richter hören wollten. Entscheidend war aber nach Aussage der Chronisten, dass sich die Bernauerin „stolz und übermütig“ benahm, dass sie „den Herzog Ernst nicht als ihren Richter und Herrn anerkennen wollte, da sie selbst Herzogin zu sein angab“, und dass sie erklärte, „dass sein Sohn ihr Gemahl sei und sie mit keinem anderen eine Ehe eingehen wollte“.
Damit habe sich die unbeugsame Frau in den Augen ihrer Verfolger „an der Weltordnung versündigt“, fasst der Bernauer-Forscher Werner Schäfer zusammen und zitiert den Chronisten Clemens Sander: „Da sie nun durch den Henker gebunden war, um ins Wasser geworfen zu werden, sagte der Henker zu ihr, wenn sie frei bekennen wolle, dass Herzog Albrecht nicht ihr Ehemann sei, so wolle er sie nicht töten, sondern frei gehen lassen. Das wollte sie nicht tun, sondern sie sagte frei, er sei ihr ehelicher Gatte. Darum hat sie ertränkt werden müssen.“
32 000 Ave Maria wider den Bürgerkrieg
Albrecht reagierte auf den schlecht bemäntelten Mord zunächst mit blinder Wut und Putschplänen gegen den Vater. In München bestellte der Rat bei den Armen im Heiliggeistspital und bei den Klosterschwestern „32 000 Ave Maria“ – gegen großzügige Geld- und Weinspenden, versteht sich –, um den drohenden Familien- und Bürgerkrieg abzuwenden. Irgendwann siegte aber dann offenbar die Staatsraison; Vater und Sohn versöhnten sich, Albrecht heiratete brav und standesgemäß die sechzehnjährige Herzogstochter Anna aus Braunschweig. Seine Tochter Sibylla aus der Verbindung mit Agnes wuchs wohlversorgt auf, und Herzog Ernst stiftete reumütig eine wunderschöne Grabkapelle für Agnes im Straubinger Friedhof St. Peter, einem idyllischen Kirchhof mit romanischer Kirche und spätgotischem Karner.
Später ließ Albrecht seine Agnes in das Straubinger Karmelitenkloster überführen, wo ihr Grab angeblich vor einem knappen Jahrhundert im Kreuzgang wiederentdeckt wurde; der Fund wurde geheim gehalten, um keinen aufrührerischen Kult entstehen zu lassen.
Volkslieder, Dramen, Musikwerke hielten das Andenken an die Bernauerin lebendig. „Was vom Geschick bestimmt, getrennt zu bleiben, beglückend wird’s hienieden nie vereint“, reimte melancholisch der kunstsinnige Bayernkönig Ludwig I., „in das Verderben immer muss es treiben, wenn’s gleich im Augenblick besel’gend scheint.“ Otto Ludwig, Friedrich Hebbel, in jüngster Zeit Franz Xaver Kroetz brachten das traurige Geschehen auf die Theaterbühne; Carl Orff widmete der unglücklichen Herzogin ein „bairisches Stück“ mit atemlosen Stakkato-Texten und den archaischen Klängen von Trommeln, Becken, Pauken und Holzratschen; Michael Boisrond ließ das Liebespaar in seinem Episodenfilm „Les amours célèbres“ von Brigitte Bardot und Alain Delon verkörpern, das Drehbuch schrieb Jacques Prévert.
Das sehr heroische Freilichtspiel aus der Feder des völkischen Dichters Eugen Hubrich (1935) ist seither durch mehrere Neubearbeitungen ersetzt worden, die alle sachlicher und doch anrührend klingen. Alle vier Jahre werden das kurze Glück und der bittere Tod der Bernauerin im Straubinger Herzogsschloss mit zweihundert Laiendarstellern in historischen Kostümen in Szene gesetzt, und es kommen bis zu zwanzigtausend Zuschauer.

Der Herzog ist mein
Und ich bin sein;
Sind wir gar treu versprochen, ja versprochen.
Bernauerin auf dem Wasser schwamm,
Maria Mutter Gottes hat sie gerufet an,
Sollt’ ihr aus dieser Not helfen, ja helfen.
(…) Es stund kaum an den dritten Tag,
Dem Herzog kam eine traurige Klag:
Bernauerin ist ertrunken, ja ertrunken.
Auf rufet mir alle Fischer daher,
Sie sollen fischen bis in das rote Meer,
Dass sie mein feines Lieb suchen, ja suchen.
(…) So wollen wir stiften eine ewige Mess,
Dass man der Bernauerin nicht vergess,
Man wolle für sie beten, ja beten.“
Lied von der schönen Bernauerin, Autor und Entstehungsdatum unbekannt