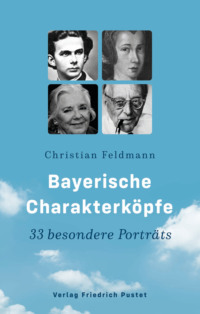Kitabı oku: «Bayerische Charakterköpfe», sayfa 5
„Ich kann nicht halb lieben, dies kalte Blut fließt mir nicht in den Adern“
„Mein Herz hat noch keine Rinde angesetzt“
Wie die letzte Kurfürstin Maria Leopoldine (1776–1848) ihre Bayern vor dem Machtpoker der Habsburger rettete
So ein prächtiges Fest hatten die Münchner wohl noch nie gesehen, wie es Graf Rumford im Februar 1795 im Englischen Garten veranstaltete: Auf dem Kleinhesseloher See gab es Lustfahrten, im Apollo-Tempel wiegten sich die neun Musen im Tanz, eine Blaskapelle lud zu einer perfekt nachgestellten Bauernhochzeit, mit Hochzeitslader, Brautzug, Festschmaus und allem, was sonst noch dazu gehört. Am Abend tauchten Tausende von Lampions den ganzen Park in buntes Licht, und ein gerade in München eingetroffener Chinese in Nationaltracht hielt eine wunderliche Gratulationsrede an den Kurfürsten und seine Gemahlin.
Um die beiden ging es nämlich bei dem Spektakel: um Kurfürst Karl Theodor und seine bezaubernde Gattin Maria Leopoldine, die gerade geheiratet hatten, in Innsbruck. Die Münchner schauten sich die neue Regentin an, wie sie in Andacht versunken vor der Muttergottes in der Herzogspitalkirche kniete, und sie waren sofort begeistert. Die Gerüchte hatten nicht gelogen, die Maria Leopoldine ein apartes Äußeres, ein fröhliches Wesen und das Fehlen jeglicher Allüren bescheinigten.
Ein ungeliebter Hochzeiter
Eine peinliche Sache war diese Eheschließung trotzdem – zählte die hübsche Braut doch erst achtzehn Lenze, während der kurfürstliche Gatte im einundsiebzigsten Lebensjahr stand, körperlich verbraucht und geistig, nun ja, schon ein wenig senil. Die Münchner Lästermäuler hatten auch gleich ein hundsgemeines Couplet parat, das sie dem ungleichen Paar an allen Straßenecken hinterhersangen:
„O lieber Herr und Heiland,
was schickt der Herr aus Mailand?
Eine schöne Frau
für unsre alte Sau!“
Was erst einmal verrät, wie wenig die Bewohner der Residenzstadt – und nicht nur die – für ihren Kurfürsten übrig hatten. Man hielt ihn für einen misstrauischen Despoten, schwankend in seinen Überzeugungen, ohne Gefühlsbeziehung zu seinem Volk, einzig und allein interessiert an Erhalt und Vergrößerung der eigenen Macht. Er war ja ein importierter Herrscher ohne altbayerischen Stallgeruch, geboren in Drogenbusch bei Brüssel, lange Zeit in Mannheim residierend, ein kleiner Provinzfürst, der von seinem Großvater Pfalz-Neuburg und die Kurfürstenwürde geerbt, durch die (erste) Heirat mit seiner Cousine die wittelsbachischen Besitzungen am Niederrhein gewonnen und nach dem kinderlos gestorbenen bayerischen Kurfürsten Max III. Joseph auch noch ein vereinigtes Kurfürstentum Pfalz-Bayern bekommen hatte.
Ein „Glücksschwein“ nannte ihn sein Zeitgenosse Friedrich der Große respektlos, weil Karl Theodor, ohne sich anzustrengen oder auch nur einen Tag Krieg zu führen, ein riesiges Territorium zusammengerafft hatte. Über Nacht war er der drittmächtigste Regent im Reich geworden, nach dem deutschen Kaiser und dem König von Preußen. Glücklich war er trotzdem nicht mit dieser Konstellation. München, das erschien ihm als Provinz, bäuerlich, rückständig, viel zu bieder, verglichen mit dem weltläufigen Mannheim, das er in seiner Ägide zu einer Art westdeutschem Weimar ausgebaut hatte.
Am meisten nahmen ihm seine Bayern übel, dass er das weißblaue Territorium allen Ernstes gegen die habsburgischen Niederlande tauschen wollte, um König eines neu zu schaffenden burgundischen Reiches mit den Städten Brüssel, Düsseldorf, Mannheim zu werden. Zum Glück stemmten sich Friedrich der Große und die anderen deutschen Fürsten mit Händen und Füßen gegen eine solche Machterweiterung des habsburgischen Imperiums.
Fairerweise muss man dem ungeliebten Karl Theodor aber auch ein paar gute Seiten zugestehen. Er milderte die damals noch allgemein übliche Folterpraxis, verbesserte die Stellung der unehelichen Kinder, machte das sumpfige Freisinger Moos für eine Armensiedlung urbar, öffnete den Hofgarten für die Allgemeinheit, legte der eigenen Zensurbehörde Fesseln an – wenigstens zeitweise.
Im Ehebett ging es „nicht ganz gut“
Sei’s drum. Der Kurfürst mag nicht der menschenverachtende Popanz gewesen sein, den man zu Lebzeiten und auch noch später aus ihm machte – für die taufrische Italienerin kam die Ehe mit dem abgetakelten Lebemann einem Fegfeuer gleich. „Was schickt der Herr aus Mailand?“, sangen die Münchner. Maria Leopoldines Vater war der Erzherzog von Modena in der Lombardei, ein Sohn der Kaiserin Maria Theresia, er residierte in Mailand und hatte dort das berühmte Teatro della Scala gebaut. Eheschließungen in diesen Kreisen hatten wenig mit Liebe zu tun, dafür umso mehr mit Politik.
Maria Leopoldine, ein aufgewecktes, manchmal wildes Kind, verbrachte eine glückliche Jugend am Mailänder Hof, musste aber früh begreifen, dass ihr junges Leben Manövriermasse in der Hand des Habsburgerclans war.

Ich ward in einer Zeit erzogen, wo man dachte, dass die Damen und besonders die Prinzessinnen nicht viel Bildung nötig hätten (…), und man vernachlässigte das Wichtigste, unser Herz und unseren Geist zu bilden. Bestimmt, Opfer des Herkommens der Politik der Höfe zu werden, verfügte man über unsere Persönlichkeit und fand es sehr bequem, über kleine sehr willige Dummköpfe zu verfügen, die unfähig waren, den Zwang zu empfinden, den man auf ihre Persönlichkeit ausübte, und folglich keinen Widerstand dagegen leisteten.“
„Gottlob, dass er schon so alt ist!“, hatte sie erleichtert ausgerufen, als sie ihren künftigen Ehemann zum ersten Mal auf einem Aquarell erblickte. Nun war die Mailänderin also Karl Theodors Gemahlin geworden, und es kam, wie es kommen musste. Worüber man in München alsbald leise tuschelte oder auch laut lachte, das formulierte der österreichische Gesandte Graf Lehrbach in seinen Berichten an den Wiener Hof mit vornehmer Zurückhaltung: Man spreche davon, „dass es im Ehebett nicht ganz gut gehe“.
Es konnte ja auch nicht gut gehen. Auf der einen Seite das quirlige, springlebendige, unverschämt junge Mädchen mit dem Temperament einer Italienerin, der Neugier einer Philosophin und den Umgangsformen eines ungebärdigen Teenagers; wenn sie aufgeregt sei, verfalle sie in einen entzückenden alpenländischen Dialekt, erzählte man sich. Klassisch schön ist sie nach den erhaltenen Porträts nicht gewesen, aber schwarze Glutaugen, eine gerade Nase, tadellos weiße Zähne und dichte dunkle Haare verliehen ihr einen eigenartigen Reiz.
Auf der anderen Seite der Kurfürst, immer noch eine attraktive Erscheinung von „kräftiger Leibesbeschaffenheit“, wie Graf Lehrbach nach Wien schrieb, aber nach einem zügellosen Lebenswandel und mehreren Schlaganfällen in seiner Gesundheit merklich beeinträchtigt. Seiner blutjungen Gattin hatte er anfangs generös zugestanden, Hauptsache, sie schenke ihm einen Thronerben, er werde nicht danach fragen, wer der Vater sei. Aber als Maria Leopoldine Gebrauch von dem freundlichen Angebot zu machen begann und sich mit hübschen Männern ihres Alters umgab, war er seine Großvaterrolle schnell wieder leid. Er machte ihr lächerliche Vorschriften, ließ jeden ihrer Schritte überwachen, doch sie trickste seine Spione aus.
Italienische Militärs hatten die besten Chancen. Aber auch dem Hofmusiker Franz Eck schenkte sie ihre Gunst. Und dem Oberstsilberkämmerer Graf von Tauffkirchen. Und dem Kämmerer Graf Carl von Arco. Und wohl auch dem Kardinal della Genga, der für seine Frauengeschichten bekannt war und auch noch später, als er zum Papst gewählt worden war, mit Maria Leopoldine korrespondierte.
Die Münchner Gesellschaft schockierte die Kurfürstin mit den skurrilsten Ideen: Glucksend vor Vergnügen informierte sie die Gäste an der Hoftafel darüber, dass sie gerade Katzen- oder Fledermausfleisch gegessen hätten. In selbstinszenierten Komödien schlüpfte sie in die Rolle antiker Göttinnen.
Eine Zweiundzwanzigjährige macht Geschichte
Doch noch viel mehr staunten die Münchner über ihre Entschlossenheit, als den Kurfürsten nach vier Jahren Ehe am 12. Februar 1799 ein letzter, diesmal tödlicher Schlaganfall ereilte – am Spieltisch, passenderweise. Außerordentlich geschickt machte Karl Theodors scheinbar so verspielt-naive zweiundzwanzigjährige Witwe in diesen schicksalhaften Tagen die komplette politische Strategie des Wiener Hofes zunichte!
Denn natürlich stand die Wiener Verwandtschaft Gewehr bei Fuß, als die Nachricht durchsickerte, der Kurfürst liege im Sterben, es gebe kein Testament und er könne in seinem Zustand auch keines mehr diktieren. Höchste Zeit, zu handeln! Der österreichische Gesandte Graf Seilern hastete in die Münchner Residenz, bei sich hatte er einen Sonderbotschafter des Kaisers, den Grafen Colloredo – und, wichtiger noch, den ominösen Tauschvertrag „Bayern gegen die österreichischen Niederlande“. Es würde ein Leichtes sein, den sprachgelähmten Kurfürsten zur Unterschrift zu bewegen, sollte er noch einmal aus dem Todeskampf erwachen.
Doch die ausgefuchsten Diplomaten hatten nicht mit der Renitenz von Maria Leopoldine gerechnet. Jetzt endlich wollte einmal sie das Gesetz des Handelns bestimmen. Die Kurfürstin pflanzte sich an der Tür zu Karl Theodors Krankenzimmer auf und verwehrte den entgeisterten Sendboten des Kaisers den Zutritt. Kaum war die Wiener Delegation unverrichteter Dinge abgezogen, schickte sie eine Depesche an den Herzog von Zweibrücken, Max Joseph; die Zweibrückener Seitenlinie der Wittelsbacher erhob ja ebenfalls Anspruch auf das Münchner Erbe. Maria Leopoldine verstand sich offensichtlich prächtig mit dem Herzog; in fliegender Hast schrieb sie ihm:

Im wichtigsten Augenblick meines Lebens wende ich mich an Sie; der Kurfürst ist in der Agonie. Der Kurier, der Ihnen diese Nachricht überbringen soll, ist in Eile; mir bleibt nur die Zeit, mich Ihnen zu empfehlen, da Sie mein einziger Rückhalt sind (…). Jetzt bin ich Ihre Untertanin und stolz darauf. (…) Ich erwarte Sie mit Ungeduld und werde mich nach Ihren Befehlen richten.“
Vier Tage später war Karl Theodor tot. Die kaiserlichen Gesandten witterten noch eine letzte Chance, den habsburgischen Einfluss in Bayern zu zementieren: Sie fragten Maria Leopoldine mehrmals eindringlich, ob sie ein Kind vom verstorbenen Kurfürsten erwarte – was sie sichtlich genervt verneinte. Dem Wiener Kaiserhof war damit jedes Recht entzogen, sich – unter dem Vorwand der Fürsorge – weiter in die bayerischen Belange einzumischen. Maria Leopoldine hatte sich endgültig von ihrer Familie emanzipiert – und Geschichte gemacht.

Es gelang ihr in der Schicksalsstunde Bayerns, eine Schlüsselstellung einzunehmen, die Einverleibung des Kurfürstentums in das Habsburgerreich zu verhindern und einer neuen wittelsbachischen Dynastie den Weg zur kampflosen Übernahme der staatlichen Gewalt in Bayern zu ebnen. Diese Leistung lässt sich in einem Jahrhundert, das vier Erbfolgekriege gesehen hat, nicht hoch genug einschätzen.“
Sylvia Krauss-Meyl, Historikerin und Archivrätin in München
Jetzt regierte also wieder ein Pfälzer in München, Max Joseph aus Zweibrücken, der jedoch im Unterschied zu Karl Theodor volkstümlich und beliebt war. 1806 wurde er König von Napoleons Gnaden. Maria Leopoldine hielt sich vom politischen Trubel der Hauptstadt fern, sorgte aber nach wie vor für kleine bis größere Skandale.
Sachverstand und Skandale
Zum Witwensitz wählte sich die Zweiundzwanzigjährige das Gut Stepperg bei Neuburg an der Donau, weit genug von den Kontrollinstanzen der Landeshauptstadt, aber nahe an der Neuburger Residenz, wo ein flirrendes Hofleben herrschte: Bälle, Gesellschaften, Liebhaber. Ein uneheliches Kind, nach sehr unwahrscheinlichen Spekulationen war es der berühmte Kaspar Hauser, musste sie auf Betreiben des Wiener Hofes im abgeschiedenen Laibach (heute Ljubljana) zur Welt bringen, damit nur ja niemand etwas mitbekam.
Die energiegeladene Witwe sanierte ihren Besitz mit Sachverstand und Verantwortungsbewusstsein, half verschuldeten Gütlern mit Renten und Spenden, war sich nicht zu schade, beim Kartoffelsammeln und bei der Heuernte selbst Hand anzulegen. „Müßiggang ist die Mutter der Langweile“, sagte sie, „und diese Krankheit wäre mein Tod.“

Powerfrau: Kurfürstin Maria Leopoldine
Der nächste Skandal ließ freilich nicht lange auf sich warten. 1804, sie war jetzt fünf Jahre Witwe, heiratete sie zum zweiten Mal – und suchte sich ausgerechnet den Sohn des prominenten Sprechers der bayerischen „Landschaft“ aus, also der Ständevertretung, der die politische Opposition gegen ihren Gatten, den Kurfürsten Karl Theodor, angeführt hatte: Graf Ludwig von Arco, nur drei Jahre älter als sie, Jurist, Hofrat, ein hervorragender Verwaltungsbeamter. Pikant, dass sie mit seinem älteren Bruder Carl bereits zu Lebzeiten Karl Theodors ein Verhältnis gehabt hatte. Und ganz unmöglich für damalige Begriffe, dass sie es war, die dem Auserwählten einen Heiratsantrag gemacht hatte, statt umgekehrt.
Richtig glücklich wurde sie auch diesmal nicht; die beiden Ehegatten waren zu verschieden. Maria Leopoldine interessierte sich immer stärker für ihre Güter und sämtliche landwirtschaftliche Detailfragen, sie machte aus ihrer Verachtung für höfisches Getändel kein Hehl und vernachlässigte demonstrativ ihre Toilette: „Stinkbüchslein“ wurde sie von der scharfzüngigen Erzherzogin Sophie genannt, weil sie sich nicht immer sauber wusch. Ihr Mann, Graf Arco, hingegen liebte den Hauch der großen weiten Welt an der Münchner Residenz, die Kunst und die Jagd.
Ihren beiden Söhnen – Louis und Max hießen sie – widmeten sich die Ehegatten gleichwohl mit großem Pflichtbewusstsein. Sie schätzten einander und fanden einen anständigen Weg, „als Freunde in der Welt zu leben“ (Maria Leopoldine), ohne sich gegenseitig mit unerfüllbaren Forderungen auf die Nerven zu fallen. Sie ging ganz in ihren Gütern und Geschäften auf, er weilte meist in München, unterzeichnete seine Schriftstücke bescheiden als „Obersthofmeister Ihrer Königlichen Hoheit der Kurfürstin Witwe“, und wenn sie sich in Gesellschaft zufällig trafen, gingen sie respektvoll distanziert miteinander um wie entfernte Verwandte.
Ein rundes Jahrzehnt nach Karl Theodors Tod kehrte Maria Leopoldine vom Gut Stepperg in die Landeshauptstadt zurück. Und sogleich zerriss man sich wieder die Mäuler über das abwechslungsreiche Liebesleben der Kurfürstinwitwe. Wie sie es wohl geschafft hatte, sich durch die Kirchenbehörde von der Gehorsamspflicht gegenüber ihrem Gatten dispensieren zu lassen? Man schätzte sie aber auch als „beste aller Mütter“. Es schien so, als suche sie an ihren beiden legitimen Söhnen gutzumachen, was sie an dem ersten, unehelichen Kind gesündigt hatte. Angeblich ist es bei einer Försterfamilie im Berchtesgadener Land aufgewachsen.
Jedenfalls ging Maria Leopoldine mit ihrem Nachwuchs erheblich aufmerksamer und herzlicher um, als es damals in ihren Kreisen üblich war. Für die Kindergeburtstage und Faschingskinderbälle engagierte sie Zauberer und lud – zum Ärgernis der vornehmen Gesellschaft – auch Handwerkerkinder ein, die sie mit Schweinsbraten und Bier bewirtete. Mit der leeren Hektik des Münchner Hoflebens konnte die Kurfürstinwitwe wenig anfangen:

Arme Sterbliche, die sich Prinzen und Prinzessinnen nennen! Ich bemitleide sie inmitten ihrer Reichtümer, von Ehren umgeben, die Langweile überwältigt sie und sie verlieren das einzige wahre Glück des Lebens, das nichts zu ersetzen vermag, wenn man dessen beraubt ist, das sind die wirklichen Beziehungen wahrer, aufrichtiger, selbstloser Freundschaft, die nur auf gleichgestellter Basis bestehen können.“
Wie es sie anödete, das Leben bei Hofe, „das alle Einfälle erstickt und den Mund nur öffnen lässt, um eine Schmeichelei oder einen Gemeinplatz zu sagen!“ Maria Leopoldine dagegen liebte es, ihre Meinung unbekümmert um gesellschaftliche Konventionen kundzutun. August Graf von Platen, Page am Königshof und Schöpfer melancholischer Sonette, schwärmt von ihrem ungezwungenen, absolut unaffektierten Benehmen.
Geizig, hilfsbereit, rebellisch
Alle Berichte der Augenzeugen durchzieht jetzt allerdings die Kritik an Maria Leopoldines sprichwörtlichem Geiz. Auf ihren Faschingsbällen froren und hungerten die – wohl nur aus Pflichtbewusstsein erschienenen – Gäste. Die Speisen wurden in atemberaubendem Tempo auf- und wieder abgetragen, die Räume waren nicht geheizt, und die Maria-Leopoldine-Forscherin Krauss-Meyl hat sicher Recht, wenn sie schreibt: „Alle waren froh, wenn die Lichter allmählich verloschen und man sich empfehlen konnte, um sich an anderem Ort aufzuwärmen und sattzuessen.“
Maria Leopoldine selbst verstand nicht recht, warum die Leute sich so über etwas aufregten, was sie für die ganz normale Sparsamkeit einer guten Hausfrau hielt. Schachern und Spekulieren war ihr ein Lebenselixier geworden. In ihren Privatgemächern stapelten sich die Geschäftsbücher, Schuldenregister und Bilanzen wie bei anderen Damen der Gesellschaft die Liebesromane und galanten Journale. Auf ihren Reisen stritt sie wie ein keifendes Marktweib um die Übernachtungstarife, so dass die begleitenden Hoffräulein vor Scham in den Boden versinken wollten.
Mit ihrem raffinierten Geschäftssinn häufte die Kurfürstinwitwe ein riesiges Vermögen an, kaufte Landgüter und Brauereien auf, unterhielt Jahrmarktsbuden und ein Textilgeschäft am Münchner Maxtor, wo sie zum Entsetzen der Hofgesellschaft bisweilen hinter dem Ladentisch stand, fuhr von einem Vieh- und Getreidemarkt zum nächsten, begleitete ihre Holzflöße in eigener Person den Lech und Inn hinab, in derben Stiefeln und resolut Kommandos gebend, jonglierte dann wieder mit Wertpapieren und Aktien wie ein mit allen Wassern gewaschener Makler. 1837 gewann sie an der Pariser Börse, wo sie mit Eisenbahnaktien spekulierte, auf einen Schlag eine Million Gulden.
Gemeinsam mit ihrem Schwager, dem Grafen Montgelas, mischte sie aber auch bei anrüchigen Finanzoperationen mit. Zwei Münchner Großbankiers mussten daraufhin Bankrott anmelden, einer der beiden beging Selbstmord. Andererseits bewies Maria Leopoldine ein soziales Bewusstsein, das weit über die Attitüde der edlen Spenderin hinausging. Sie knauserte bei Galadiners und Tanzabenden, gab aber gern beträchtliche Teile ihres Vermögens für gemeinnützige Projekte her: Den großzügigen Erweiterungsbau des Frauenkrankenhauses Neuburg an der Donau finanzierte sie aus ihrer Privatschatulle, unter der ausdrücklichen Bedingung, ungenannt zu bleiben.
Das Christentum verstand sie offensichtlich nicht als Tünche bürgerlicher Wohlanständigkeit. Eine echte Tochter der Aufklärung war die Kurfürstinwitwe, fasziniert von der Toleranzidee, der Gleichheit aller vor dem Gesetz und dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Der Französischen Revolution, die immerhin ihre Tante Marie Antoinette den Kopf gekostet hatte, gewann sie echte Werte ab. Noch in ihrem Todesjahr 1848 erklärte sie ungerührt, von ein paar revolutionären Änderungen gehe die Welt nicht unter.
Ihr letzter Liebhaber war Graf Sigmund von Berchem gewesen, fünfzehn Jahre jünger als sie und in seinen Gefühlen von einer biederen Freundlichkeit, nachdem die erste Leidenschaft vorüber war. Zeitweise schrieben sie sich dreimal täglich. Doch während die Grande Dame der Wittelsbacher seinen heruntergewirtschafteten Familienbesitz sanierte, seine Wäsche flickte und eifrig Socken für ihn strickte, vergrub sich der spröde Geliebte auf seinen Landgütern und mokierte sich am Ende gar öffentlich über ihre Anhänglichkeit.
Müde schrieb sie dem einst so zärtlichen Bettgenossen, sie könne eben nicht „halb lieben“. Gefühle nützten sich mit den Jahren keineswegs ab, denn der Geist könne frisch und jung bleiben, wenn der Körper auch altere. Ihr Herz habe „noch keine Rinde angesetzt, und obgleich ich ärgerlich und fast beschämt bin, muss ich gestehen, dass ich immer noch so liebe wie mit zwanzig Jahren.“
Zu guter Letzt heiratete der Graf (38) die hübsche, neunzehnjährige Tochter eines Staatsrats. Maria Leopoldine (54) fühlte sich überraschenderweise mehr befreit als verletzt und begegnete dem Paar fortan als mütterliche Freundin.
Am 23. Juni des Revolutionsjahres 1848 wollte sie sich mit der Kutsche auf ihr Gut Kaltenhausen bei Salzburg begeben. Als man einen steilen Berg bei Wasserburg hinauffuhr, kam der Kutsche ein Salzfuhrwerk, dessen Hemmschuhkette gebrochen war, in vollem Lauf entgegen. Beim Zusammenstoß verletzte sich die zweiundsiebzigjährige Kurfürstinwitwe schwer, zwei Rippen durchstachen die Lunge und führten zum Erstickungstod.
Im Volk lief alsbald eine andere Version um, die schön gruselig klang und auf jeden Fall besser zum abenteuerlichen Leben der alt gewordenen Dame passte: Maria Leopoldine habe in der unsicheren politischen Lage eine riesige Holzkassette mit Geld und Wertpapieren außer Landes bringen wollen. Bei dem Unglück sei die schwere, eisenbeschlagene Schatztruhe auf sie gefallen und habe ihr das Genick gebrochen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.