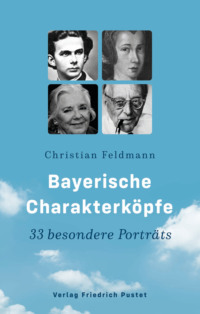Kitabı oku: «Bayerische Charakterköpfe», sayfa 4
„Das Herz, das ist ein Taubenhaus: Ein Lieb’ fliegt ein, das andre aus“
Schuhmacher und Poet dazu
Wie es der fast noch mittelalterliche Volksdichter Hans Sachs (1494–1576) auf Richard Wagners Opernbühne schaffte
Er war kein Avantgardist, sondern ein volkstümlicher Erfolgsautor, der Gedichte, Dramen und komische Bühnenstücke für ein bürgerliches Stadtpublikum machte und dessen Geschmack treffen wollte. Er verzichtete auf schneidende Kritik und boshafte Satire, aus der großen Politik hielt er sich heraus, er zeichnete die behäbigen Bürger, klatschsüchtigen Hausfrauen und dummstolzen Bauern seiner Umgebung mit gutmütigem Spott und einer stillen Liebe. Die Bilanz seines Schaffens ist gewaltig: 4000 „Meisterlieder“, 180 Spruchgedichte, 126 Schauspiele, 85 Fastnachtsstücke.
Sein Lebensmittelpunkt war Nürnberg, damals eine richtige Metropole mit 50 000 Einwohnern, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum Süddeutschlands, Drehscheibe des Fernhandels, von Patriziern regiert. Hier wurde er 1494 geboren.

Acht und zwaintzig fünff hundert Gassen, hundert sechzehen schöpffbrunnen, zwölf rörbrunnen, zwei thürlein und sechs grosse thor, eylff stayner brücken, zehen geordnete märkte, dreyzehen gemein badstuben“
Hans Sachs über Nürnberg
Sein Vater, aus Zwickau zugewandert, war zwar nur ein Schneidermeister, aber so tüchtig, dass er bald reich wurde und seinem Sohn den Besuch der Lateinschule finanzieren und zur Hochzeit ein Haus samt Werkstatt im Herzen Nürnbergs schenken konnte. Da war Hans Sachs bereits von seinen Wanderjahren durch Bayern, Österreich und den Westen und Norden Deutschlands zurückgekehrt (Kaiser Maximilian I. soll ihn am Innsbrucker Hof kurzzeitig in seine Dienste genommen haben, und er besuchte Singschulen an verschiedenen Orten). 1520 erwarb er den Meisterbrief als Schuhmacher.
Auftrag von der Kunstgöttin
Als Handwerksmeister soll er sehr fleißig gewesen sein, aber auch als Poet muss er hart gearbeitet haben: Vierunddreißig dicke Bände umfassen seine gesammelten Werke, Meisterlieder, Spruchgedichte, Fastnachtsspiele, Tragödien, Fabeln, Dialoge, alles eigenhändig aufgeschrieben und nach seinen Anweisungen schön gebunden und mit einem nach Inhalten und Formen geordneten Generalregister ausgestattet. Er hat wie ein Besessener gelesen, antike Mythen, Legenden, volkstümliche Überlieferungen, politische und religiöse Tagesneuigkeiten, und aus allem ein Gedicht oder ein Drama gemacht. Mehr als tausend Bücher soll seine Bibliothek umfasst haben. Er selbst berief sich auf eine „Kunstgöttin“, die ihm den Auftrag erteilt habe, das Leben poetisch abzubilden:

Zu straff der laster,
lob der tugendt,
Zu lehre der blüenden jugendt,
Zu ergetzung trawriger gmüt.“
Seine Figuren sind aus dem Volk genommen, sie fühlen wie das Volk, reden wie das Volk – in Sprichwörtern und einprägsamen Bildern – und haben das Volk wohl auch deshalb so fasziniert. Dabei nimmt den Löwenanteil seiner Werke der Meistergesang ein, ein eigenartiges Kunstprodukt, das komplizierten Regeln folgt und von der Alltagssprache ebenso weit entfernt ist wie von den Liedern, die in der Küche und auf der Straße geträllert wurden: Die exklusive Zunft der Nürnberger Meistersinger ermunterte die Handwerker zum Dichten und Singen, sah ihnen aber auch streng auf die Finger und überwachte die althergebrachten Regeln von Melodik, Reim und Metrik – war der bürgerliche Meistergesang doch als Nachahmung des höfischen Minnegesangs gedacht! „Silberweis“ und „Güldenton“ sind vermutlich Hans Sachsens ureigene Erfindung gewesen.
In der öffentlichen „Singschule“ nach dem Sonntagsgottesdienst wurden die Lieder vorgesungen und von den „Merkern“ peinlich genau auf die korrekte Befolgung der Regeln geprüft. Etwas freier ging es später im Wirtshaus beim „Zechsingen“ zu. Erst im 19. Jahrhundert kam der seit vierhundert Jahren in Nürnberg gepflegte Meistergesang aus der Mode.

Fleißig: Hans Sachs
Erheblich volkstümlicher wurden natürlich Hans Sachsens gereimte Schwänke mit Titeln wie „Sankt Peter mit den Landsknechten im Himmel“, „Sankt Peter mit der Geiß“, „Schlaraffenland“ und seine zahllosen Fastnachtsspiele, die „Das Narrenschneiden“ überschrieben sind, „Der schwangere Bauer“ oder „Der fahrende Schüler im Paradeiß“. Zielscheibe des milden, aber treffsicheren Spottes sind hier immer wieder die zänkische Ehefrau mit Haaren auf den Zähnen, der lüsterne Pfaffe, der blöde Bauer. Am Ende steht aber stets eine breit ausgemalte moralische Nutzanwendung, wie sie das ehrbare Bürgertum schätzte.
Durchaus selbstkritisch schildert Hans Sachs den Menschheitstraum vom Jungbrunnen, in den man als gebrechlicher Greis mühsam hineinklettert, um „schön, wohlgefarb, frisch, jung und gesund“ herauszuspringen:

Da dacht ich mir im schlaf: Fürwar,
alt bist auch, zwei und sechzig Jar;
dir geht ab an ghör und gesicht;
was zeichnest du dich, dass du auch nicht
wol bald in den jungbrunnen sitzest,
die alten haut auch von dir schwitzest?
Abzog ich alles mein gewand;
daucht mich im schlaf allda zuhand;
Ich stieg in jungbrunnen zu baden;
ab zu kumen des alters schaden.
In dem einsteigen ich erwacht,
meins verjüngens ich selber lacht;
dacht mir: ich muss nun bei mein tagen
die alten haut mein lebtag tragen,
weil kein Kraut auf erd ist gewachsen
heut zu verjüngen mich, Hans Sachsen.“
Poetische Unterstützung für die Reformation
Doch der Lieblingsautor des kultivierten Nürnberger Bürgertums erlebte einen bösen Absturz: Es gab einen Skandal, als er 1527 zusammen mit dem Prediger und Theologen Andreas Osiander ein bitterböses Pamphlet gegen den Papst schrieb; Sachs wurde mit einem dreijährigen Publikationsverbot belegt (und produzierte fortan Meisterlieder in Hülle und Fülle, denn sie durften nach altem Herkommen nicht gedruckt werden, brachten ihrem Verfasser aber literarischen Ruhm und bürgerliches Ansehen).

Wacht auf, es nahet sich dem Tag!
Ich höre singen im grünen Hag
Die wonnigliche Nachtigall;
Ihr Lied durchklinget Berg und Thal.
Die nacht neigt sich gen occident,
Der tag get auff von orient,
Die rotprünstige morgenröt
Her durch die trüben wolcken göt.
Nun das ir klerer mugt verstan
Wer die lieplich nachtigall sey
Die uns den hellen tag auß schrey
Ist doctor Martinus Lutther
Zuo Wittenberg Augustiner
Der uns auffweckt von der nacht
Darein der monschein uns hat bracht“
„Die Wittenbergisch Nachtigall“
Als überzeugter Parteigänger der Reformation, der die Freiheit des Gewissens über alles schätzte, veröffentlichte er später etliche intelligente Prosadialoge, welche die Überlegenheit der neuen Lehre zu beweisen suchten, das letzte Urteil aber – für die Zeit ungewohnt – dezent dem Leser überließen. Im Verlauf dieser fiktiven Streitgespräche werden Prälaten und Mönche regelmäßig von gewitzten Handwerkern, am liebsten wählt Sachs natürlich einen Schuhmacher, in die Ecke gedrängt und stehen am Ende als die Dummen da.
Am 19. Januar 1576 starb Hans Sachs einundachtzigjährig in Nürnberg, wo er auf dem Johannisfriedhof begraben liegt. Ganz in Vergessenheit geraten ist er nie. Grimmelshausen ließ ihn 1669 in seinem Schelmenroman „Der abenteuerliche Simplicissimus“ wiederauferstehen. Der große Philosoph Hegel kannte ihn, rümpfte aber die Nase darüber, dass er wie ein Provinzler empfunden und die Weltoffenheit und den europäischen Geist seiner Vaterstadt immer nur „vernürnbergert“ habe. Für die literarische Bedeutung des Volksdichters, der es ähnlich wie Luther fertigbrachte, aus dem Wildwuchs der Dialekte allmählich eine deutsche Sprache zu formen und das breite Publikum für die anspruchsvollere Theaterbühne zu interessieren, hatte Hegel kein Gespür.
„Hans Sachs“, so eine respektvolle moderne Einordnung, „hob den Schwank aus der Verluderung und Verzotung des 15. Jahrhunderts zur Reife der satirischen Parabel empor, die die Lustspiele der antiken Klassik besaßen. Während der mittelalterliche Meistergesang nur biblische und dogmatische Stoffe kannte, machte Sachs durch seine Beiträge auch weltliche Gegenstände, Erkenntnisse der allgemeinen Lebenserfahrung und Lebensweisheit unter den Meistersingern ‚salonfähig‘. Überhaupt war es sein Anliegen, den kleinen Mann, der wenig zu sagen hat, in die Literatur als Gegenstand wie als Konsument einzuführen. Er machte den Alltag literaturwürdig, die Schwächen des Menschen liebenswert und wurde so zu einem Vater des modernen Volks- und Unterhaltungsschrifttums.“
Die Romantik mit ihrer Vorliebe für das Mittelalter entdeckte ihn neu, nachdem ihm schon Goethe mit seinem Gedicht „Erklärung eines alten Holzschnitts vorstellend Hans Sachsens poetische Sendung“ neue Publizität verschafft hatte. Richard Wagner setzte ihm und seiner ganzen Zunft in den „Meistersingern von Nürnberg“ ein prächtiges Denkmal – das freilich wenig mit den historischen Fakten zu tun hat, das mittelalterliche Nürnberg stark idealisiert und die Traditionen und Regeln der Meistersinger mit viel dichterischer Fantasie behandelt. Hans Sachs ist hier noch ganz der Repräsentant einer eindrucksvollen, aber ziemlich erstarrten Überlieferung und noch kaum der Vermittler neuer, reformatorischer Bildungsinhalte für ein breites Publikum.
„Heilig sei dir die Freiheit des andern!“
Ketzerprozess gegen einen Bischof
Warum Johann Michael Sailer (1751–1832) in Rom denunziert, aber nicht verurteilt wurde
Irgendwo in der „Stanza Storica“, in den hintersten Archivkellern der Heiligen Inquisition, wo Dokumente aus grauer Vorzeit schlummern, entdeckte der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf an der Wende zum dritten Jahrtausend die vergilbten Spuren eines bayerischen Skandalfalls. Die Akten hatte ein verhältnismäßig liberaler Kurienprälat namens Lorenzo Nina dort deponiert oder, besser gesagt, versteckt – und dem Heiligen Stuhl damit eine Riesenblamage erspart.
Denn das Denunziationsopfer, das 1873 – vier Jahrzehnte nach seinem Tod – zum Ketzer erklärt werden sollte, hieß Johann Michael Sailer und wurde in Deutschland wie ein Kirchenvater verehrt. Heute gilt Sailer als einer der Pioniere moderner Theologie; er bereitete dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit seinem Aufbruch aus dem katholischen Getto schon den Weg, als das Erste Vaticanum, das rückwärtsgewandte Vorgängerkonzil (mit der umstrittenen Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit) noch gar nicht stattgefunden hatte.
Die Vorgeschichte des Ketzerprozesses klingt peinlich genug: 1819 sollte der angesehene Theologe und enorm produktive geistliche Schriftsteller Johann Michael Sailer nach dem Willen des bayerischen Königs Bischof von Augsburg werden. Der Päpstliche Nuntius Severoli hintertrieb die Ernennung, gestützt auf Klatsch, Gerüchte, Anklagen vom Hörensagen. Beim Wiener Redemptoristenpater Clemens Maria Hofbauer – ein begnadeter Seelsorger und liebenswürdiger Sozialapostel, aber leider auch ein schrecklich engherziger Mensch – gab er ein Gutachten in Auftrag, das Sailer den Hals brechen sollte.
„Er ist ein Christ, aber so viel ich weiß, will er von der Form nichts wissen“, entrüstete sich der biedere Ordensmann, der von Sailers zahllosen Schriften – anspruchsvolle theologische Abhandlungen, pädagogische Handreichungen, Meditationen, Gebetbücher, insgesamt 194 Titel umfasst die Gesamtausgabe – wohl nur die eine oder andere gekannt hat. „Mystizismus“ wirft er ihm vor und Freundschaft mit Protestanten.

Tolerant: Bischof Johann Michael Sailer
Hofbauer: „Ich weiß bestimmt, dass Sailer gesagt hat, die Kirche habe kein Monopol auf den Heiligen Geist, dieser wirke ebenso viel in denen, die in der heiligen Kirche sind, wie in jenen, die außer ihr sind, wenn sie nur an Christus glauben.“ Und dann: „Gesehen habe ich Sailer nur einmal und war damals nur eine halbe Stunde bei ihm; denn ich hatte Angst, länger bei ihm zu verweilen, da ich von seinen Schülern schon so viele Nachrichten hatte, die mich schaudern machten.“
Keine Belege, keine nachprüfbaren Zitate, keine Angabe von Zeugen. Eine klassische Denunziation aus Angst und geistiger Enge. Dass Sailers Schüler und Bewunderer, König Ludwig I., dem Verfemten wenige Jahre später doch noch einen Bischofsthron verschaffte, in Regensburg, gegen erbitterten Widerstand römischer und deutscher Fundamentalisten, kann als späte Rehabilitation gelten. Doch 1873, als Sailer bereits 41 Jahre tot war, sannen die Redemptoristen auf eine Seligsprechung ihres Mitbruders Hofbauer. Als Stolperstein lag sein bitterböses Statement über Sailer im Weg.
Erpresser und Arme Seelen
Um Hofbauer vom Verdacht zu reinigen, mit seinen Attacken das Gebot der christlichen Liebe und Wahrhaftigkeit verletzt zu haben, verfiel der Orden auf die famose Idee, den toten Sailer zum Ketzer (und Hofbauer damit automatisch zum prophetischen Warner) erklären zu lassen. Wie Hubert Wolf recherchiert hat, mobilisierte man eine in katholischen Traditionalistenkreisen angehimmelte Seherin namens Aloysia Beck, die sich mit Visionen von Armen Seelen, Engeln und Dämonen einen Namen gemacht hatte und abergläubische Gemüter dazu animierte, bei ihr Lebensbeichten abzulegen.
Zu den hohen Klerikern, die sich mit solchen Bekenntnissen abhängig von dem frommen Medium gemacht hatten, gehörte Sailers Nachfolger auf dem Regensburger Bischofsthron, Ignatius von Senestrey, ein ängstlicher Erzkonservativer, hoch verschuldet und wegen irgendwelcher delikater Verstrickungen, über die Kirchenhistoriker bis heute rätseln, in der Hand von Erpressern. Senestrey tat, was man von ihm wollte: Er beantragte bei Papst Pius IX. einen Ketzerprozess gegen seinen Vorgänger, und der Papst persönlich – was ungewöhnlich war – beauftragte die Inquisitionsbehörde, das Heilige Offizium, mit dem Verfahren.
Doch obwohl der Papst die Causa Sailer zur Chefsache gemacht hat, obwohl Senestreys Gutachter 105 angeblich häretische Sätze aus Sailers Werken zusammenträgt, durchschauen die Theologen, Juristen und Kardinäle der Glaubensbehörde das Spiel: Sie geben sich mit diesem Material nicht zufrieden, fordern ein neues Gutachten durch einen Zensor aus den eigenen Reihen, holen die Meinung deutscher Bischöfe ein, die zwar hundertprozentig romtreu sind, aber den toten Amtsbruder verteidigen und vor der Verurteilung eines deutschen Paradekatholiken mitten im Kulturkampf mit Bismarck warnen. Es gibt zwar keinen Freispruch, damit hätte man den Papst brüskiert, aber die Akten verschwinden ganz hinten im Archivkeller, wo sie so schnell niemand finden wird.
Ein Pionier der religiösen Toleranz
So viel hysterischen Verfolgungseifer hatte Johann Michael Sailer weiß Gott nicht verdient. Als Pastoral- und Moraltheologe und Pädagoge an den Universitäten Dillingen, Ingolstadt und Landshut baute der 1751 als Sohn eines Dorfschusters in Aresing bei Schrobenhausen geborene Vordenker dem von Aufklärern und Traditionalisten verunsicherten Katholizismus Brücken in die Zukunft. Er kämpfte gegen jene blassen Rationalisten, die Religion mit einer „Vernunftmoral“ verwechselten und in Christus bloß einen „Tugendfreund“ (Sailer) sehen wollten. Aber er kannte keine Berührungsängste gegenüber liberalen Strömungen und nahm gute Entwicklungen gern auf.
Dem Nützlichkeitsdenken der Aufklärer stellte er ein vitales, überzeugendes Christentum gegenüber. „Wo die Seele nach Totenaas riecht“, so charakterisierte er in seiner bildhaft-drastischen Sprache die blutleeren Theorien dieser Leute, „da mag ihre Kenntnis Gottes wohl nicht mehr sein als eine leere Büchse mit der Aufschrift: Gott.“ Inbegriff christlichen Glaubens war ihm vielmehr eine Liebe, „rein und sicher vor Kopfhängerei, Menschenscheu, finsterer Laune, rein und sicher vor Scheinheiligkeit und Heuchelei“.
Seinen Theologiestudenten vermittelte er die Idee der „lebendigen Überlieferung“ und ein organisches Kirchenverständnis: Die sichtbare Kirche mit all ihren Stärken und Schwächen und ihr von Christus getragenes, vom Geist beseeltes Innenleben bilden eine pulsierende Einheit. Mit solchen Gedanken sollte er die katholische Moderne prägen. Und natürlich auch mit seiner Orientierung an der Bibel, die zu seiner Zeit vielen Pfarrern und Priesteramtskandidaten – man möchte es kaum glauben – ein böhmisches Dorf war.

Lass alle Bücher fahren, auch die besten, und lies allein das Neue Testament!“
Seine Leidenschaft für die Wahrheit, wie er sie in der katholischen Tradition fand, verband Sailer mit der unbedingten Achtung vor der Religionsfreiheit: „Heilig sei dir wie dein Gewissen und unantastbar die Freiheit des andern!“ Religion sei Liebe, und die sei ihrer Natur nach liberal. „Der weise Mann in dem Seelsorger“ sehe „in jedem ehrlichen Genossen einer fremden Religion“ einen Funken der in Christus erschienenen ewigen Religion.
Wichtiger als enger Konfessionalismus war ihm eine lebendige Beziehung zu Christus. Für Sailer ist die Kirche Christi in der römisch-katholischen Kirche zwar anzutreffen, beide sind aber nicht einfach identisch. Deshalb ist die römisch-katholische Kirche ständig aufgerufen, sich zu verchristlichen. Katholisches Selbstbewusstsein kann deshalb nur jene Demut bedeuten, „die darum weiß, trotz menschlichen Versagens Treuhänderin einer Wahrheit und Gnade sein zu dürfen, die sie nicht besitzt, sondern nur dienend austeilt“. Damals, als Ökumene und interkonfessioneller Dialog noch Fremdwörter waren, machte man sich mit solchen Gedanken enorm verdächtig.

Ein Haus, viele Wohnungen, sagt Christus von dem Himmel. Ein Haus, viele Stockwerke, gilt von der Kirche.“
„Wer in seinem Stockwerke den Mittelpunkt gefunden hat, wird aufhören, für das bloße Stockwerk zu fechten, weil er genug zu tun hat, für den Mittelpunkt zu leben – und in dem Mittelpunkte.“
„Ich buchstabiere selber noch an der Wahrheit“
Ein wilder Aufklärer ist er nie gewesen. Mit dem Jahrhundert Schritt zu halten, ist für ihn kein Wert an sich. Was sind schon weltanschauliche Moden und die jeweils neuesten wissenschaftlichen Systeme? „Im Tode fahren sie auf einer Sandbank auf.“ Im stürmischen Wellengang der Zeit gebe letztlich nur ein Leuchtturm verlässliche Orientierung: das Evangelium. Sailer spöttelt über trendbewusste Gelehrte, die im alten China und im neuen Paris Perlen der Weisheit entdecken, nur nicht in Nazaret und Rom, und er wehrt sich gegen die Herabstufung Christi zu einem edlen Menschen. Nein, er ist der Retter, der unser Herz verwandelt.
Die blassen Rationalisten jagen ihm Angst ein, aber nicht die Vernunft und der Freimut ernsthafter Wahrheitssucher: „Hütet euch, das Wort Aufklärung als einen Schimpfnamen zu gebrauchen“, mahnt er, denn der Durst nach Wahrheit komme „in gerader Linie“ von Gott. Sailer verteidigt das Gewissen als letzte Instanz für menschliches Denken und Handeln. Er versteht die Skeptiker und bekennt einem zweifelnden jungen Mann in rührender Offenheit: „Ich buchstabiere selber noch an der Wahrheit.“ Das Buchstabieren mache freilich bereit zum Lesen.
1794, als seine Neider in Dillingen die schmähliche Entlassung des Professors Sailer erreichten, spielten solche Thesen und sein ungezwungener Verkehr mit Freigeistern und Evangelischen eine entscheidende Rolle. Aber auch sein „zu freundschaftlicher Umgang mit den Studenten“, wie ein Kollege zu Protokoll gab: „Professor Sailer kommunicierte ihnen Bücher, die sie nicht kennen sollten.“ Und wer immer gut Freund mit den jungen Leuten sein wolle, mache diese „stolz und unehrerbietig“ und störe Zucht und Ordnung.
Der Rausschmiss, das weiß man heute, hatte ganz banale Hintergründe: Der zuständige Bischof, der sich von Sailer seine Hirtenbriefe hatte schreiben lassen, war in Geldnöten und wurde von einem mit Sailers Intimfeinden versippten Bankhaus unter Druck gesetzt. In München, wo der ohne Pension Hals über Kopf Entlassene Zuflucht fand, war es wiederum der Nuntius, der seine Ernennung zum Hofprediger hintertrieb.
Jahre später, der nicht gerade klerusfreundliche Montgelas hatte die Zügel im Staat übernommen, berief man den vermeintlichen Aufklärer an die Universität Ingolstadt (bald darauf nach Landshut verlegt), wo er sogleich wieder zwischen die Fronten geriet: Von der Polizei wurde Sailer als finsterer „Römling“ bespitzelt, von der katholischen Reaktion als verkappter Freimaurer belauert.
Mittlerweile hätte ihn die preußische Regierung gern als Erzbischof in Köln gesehen. Doch Rom, wo man das vernichtende Gutachten von Pater Hofbauer kannte, tat nichts, um den Kandidaten zur Annahme zu bewegen. Sailer war bereits siebzig Jahre alt, als sein Schüler und Freund, Kronprinz Ludwig, seine Ernennung zum Domkapitular und Bischofskoadjutor mit dem Recht der Nachfolge in Regensburg durchsetzte – immer noch gegen erhebliche Widerstände aus Rom. Auf die päpstliche Bestätigung musste man sechs Monate warten!
In den folgenden sechs Jahren bereiste der noch recht vitale alte Herr unermüdlich das Bistum, predigte in den abgelegensten Winkeln und firmte mehr als 74 000 junge Menschen. Als Dompropst, Generalvikar und Weihbischof hatte Sailer die eigentliche Bistumsleitung inne. Bischof Johann Nepomuk von Wolf war so hinfällig und gebrechlich, dass er das Bett kaum mehr verlassen konnte. Siebenundsiebzigjährig bestieg Johann Michael Sailer 1829 für seine drei letzten Lebensjahre den Regensburger Bischofsstuhl.
„Schonen, recht schonen soll er sich!“, ließ ihm Ludwig ausrichten, der inzwischen König geworden war. Aber Sailer, dessen robuste Natur mehrere Schlaganfälle überstand, widmete sich seinen Amtsgeschäften mit Hartnäckigkeit und Freude: Er führte regelmäßige Priesterexerzitien ein, baute den Unterhaltsfonds für alte und kranke Kleriker aus. Das Wichtigste war ihm die innere Erneuerung in den Reihen der Seelsorger, an denen er Habsucht, Anmaßung und Herzenshärte kritisierte.
Am 20. Mai 1832, mit achtzig Jahren, gab er Gott sein Leben zurück.