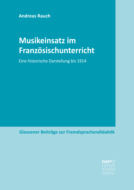Kitabı oku: «Kulturbezogenes Lernen in asynchroner computervermittelter Kommunikation», sayfa 8
2.5 Zusammenfassung und Ausblick
In der theoretischen Basis dieser Arbeit wurden die drei Bereiche der Fremdsprachendidaktik skizziert, die den Hintergrund für die empirische Untersuchung darstellen. Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Fremdsprachenlernen mit digitalen Medien und der Landeskundedidaktik, es muss aber, um dem untersuchten Unterricht in seiner Komplexität gerecht zu werden, am Rande auch auf das Forschungsgebiet des integrierten Fremdsprachen-Sachfach-Unterrichts sowie das epistemische Schreiben eingegangen werden. Es zeigt sich, dass sich diese Arbeit auf verschiedenen Ebenen auf Schnittstellen bewegt; auf theoretischer Ebene verbindet sie die Landeskundedidaktik mit der Frage, wie Fremdsprachenlehr- und -lernprozesse durch digitale Medien optimiert werden können. Darüber hinaus führt der untersuchte Unterricht als integrierter Fremdsprachen- und Fachunterricht eben auch inhaltliches und fremdsprachliches Lernen zusammen.
Zugleich wird in der theoretischen Basis ein Ungleichgewicht deutlich, das sich für die Konzeption von universitärem Landeskundeunterricht, sofern eine theoretische Verankerung angestrebt wird, als problematisch erweist: Der Einsatz von asynchroner computervermittelter Kommunikation im Fremdsprachenunterricht ist relativ gut erforscht, ebenso auch der Einsatz von CMC in anderen Szenarien, was im Abschnitt zum allgemeindidaktischen Potenzial erkennbar wurde (vgl. Kapitel 2.1.2). Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass man relativ sicher weiß, wie Aufgaben zu gestalten sind und welche Rolle die Lehrenden möglichst einnehmen sollten. Auf der anderen Seite steht die kulturwissenschaftlich orientierte Landeskunde, deren Theorielegung zwar gut fundiert ist, der es aber bislang an entsprechenden Überlegungen und Forschungsergebnissen zu geeigneten Aufgaben, ja Methoden überhaupt mangelt. Ein Desiderat im Bereich der Landeskundedidaktik ist somit die Entwicklung von Aufgaben, die helfen, die weitgesteckten Ziele der kulturwissenschaftlich orientieren Landeskunde zu erreichen. In der vorliegenden Arbeit beruhten die Aufgabenstellungen auf meinen subjektiven Theorien, wie landeskundliches Lernen gefördert werden kann – was vermutlich für das Fach symptomatisch ist. Im empirischen Teil dieser Arbeit wird sodann heuristisch vorgegangen, da für die Analyse der Aufgaben nicht nur auf die Merkmale und Gütekriterien von Aufgaben 2.0 eingegangen wird, sondern auch auf Merkmale guter historischer Lernaufgaben. Insgesamt ist es aber wünschenswert, dass die Landeskundedidaktik in einer interdisziplinären Herangehensweise auch die Frage nach geeigneten Aufgaben ins Blickfeld nimmt.
Es folgt nun ein kontextualisierendes Kapitel zur Didaktik des Landeskundeunterrichts an der Universität Stockholm. Zunächst wird das Fach Deutsch beschrieben und in groben Zügen die Verortung des Landeskundeunterrichts im Germanistik-Studiengang, wobei auch curricular vorgegebene Lernziele erläutert werden. Den Hauptteil stellen Kapitel 3.2.3 und 3.2.5 dar, da dort auf Lerninhalte, didaktische Prinzipien, die Wahl der Lernform Blended Learning und die Rolle asynchroner computervermittelter Kommunikation eingegangen wird.
3 Der Landeskundeunterricht an der Universität Stockholm
In diesem Kapitel steht das Seminar zur Landeskunde der deutschsprachigen Länder im Fokus, in dessen Rahmen die im Rahmen dieser Arbeit analysierten Daten erhoben wurden. Nach einer einleitenden Beschreibung des Faches Deutsch an der Universität Stockholm folgt eine Darstellung des Landeskundeseminars. Berücksichtigt werden zunächst in aller Kürze Lehr- und Lernziele, Prüfungsform, Erwartungen und technische Medienkompetenzen der Studierenden. Sodann wird ausführlicher auf die Themenauswahl, die Integration von sprachlichem und inhaltlichem Lernen sowie den Einsatz der Lehr- und Lernform Blended Learning und asynchroner computervermittelter Kommunikation eingegangen.
3.1 Das Fach Deutsch an der Universität Stockholm
Innerhalb des schwedischen Studiensystems sind zwei verschiedene Studienwege möglich: Neben mehr oder weniger in sich geschlossenen Studiengängen (z.B. Medizin, Jura, Lehramtsstudiengänge) kann man außerdem ‚freistehende Kurse‘ (fristående kurser) absolvieren, die in der Regel 7,5, 15 oder 30 ECTS umfassen. Die freistehenden Kurse kann man studieren, ohne einen Abschluss anzustreben, sie führen aber in relativ frei wählbaren Kombinationen auch zu B.A.- und Magister- bzw. Masterabschlüssen.
In der Germanistik werden alle Kurse als freistehende Kurse angeboten, was dazu führt, dass die Mehrzahl der Studierenden lediglich ein oder zwei Semester Deutsch studiert. Dieses System hat sowohl Vor- als auch Nachteile: So kann z.B. jede/-r, der/die die Hochschulzugangsberechtigung besitzt, freistehende Kurse belegen, ohne sich gleich für mehrere Jahre festzulegen, was zweifelsohne lebenslanges Lernen ermöglicht. Ein Nachteil ist, dass didaktische Konzepte, die sich über mehrere Semester erstrecken, nicht möglich sind und jeder freistehende Kurs möglichst in sich geschlossen konzipiert sein muss.
Oft wird Germanistik zudem aus einem allgemeinen Interesse an der deutschen Sprache und den deutschsprachigen Ländern studiert und nicht, weil man sich für das Fach Germanistik interessiert. Dies wird dadurch verstärkt, dass es an der Universität Stockholm kein Sprachenzentrum gibt, an dem Sprachkurse stattfinden, und diejenigen Studierenden, die eigentlich einen Sprachkurs belegen wollen, daher Germanistik studieren. Diese Voraussetzung wird eine bedeutende Rolle in der Datenanalyse spielen.
Die ersten 60 ECTS des Germanistik-Studiums sind geprägt von vielen sprachpraktischen Seminaren,1 von denen die meisten aber immer auch eine wissenschaftliche Perspektive beinhalten. Ab dem dritten Semester (61–90 ECTS), das das letzte Semester vor einem B.A.-Abschluss ist, finden so gut wie ausschließlich literatur- bzw. sprachwissenschaftliche Seminare statt. Es ergibt sich folgendes Curriculum für das Grundstudium:2
| Tyska I (30 ECTS) | Tyska II (30 ECTS) | Kandidatkurs i tyska (30 ECTS) |
| Grammatik (6) Angewandte Grammatik (3) Aussprache (3) Konversation (3) Schriftliche Fertigkeit (3) Landeskunde (3) Deutschsprachige Literatur I (6) nur Klausur: Schriftliche Fertigkeit (3) nur Übung: Übersetzen Schwedisch-Deutsch (-) | Grammatik (5) Sprachgeschichte (5) Mündliche Sprachfertigkeit (3) Kulturorientierung, inkl. wissenschaftliches Schreiben (5) Deutschsprachige Literatur II (8) nur Klausur: Schriftliche Fertigkeit (4) nur Übung: Übersetzen Schwedisch-Deutsch und schriftliche Fertigkeit (-) | Einführung in die germanistische Linguistik (6) Deutschsprachige Literatur III (6) Übersetzen Schwedisch-Deutsch (3) B.A.-Examensarbeit (15) |
Tab. 1:
Übersicht über die einzelnen Veranstaltungen innerhalb der freistehenden Kurse des Grundstudiums. In den Klammern sind die ECTS-Punkte angegeben.
Die in der Tabelle aufgeführten Veranstaltungen sind obligatorisch und können nicht durch andere ersetzt werden. Ein Vorteil ist dies für die Unterrichtsgestaltung, denn es ist das ausgesprochene Ziel aller Lehrenden, die verschiedenen Seminare und Übungen jeweils so abzustimmen, dass inhaltliche Verbindungen erkennbar werden. Dies kann nur erfolgen, wenn alle Studierenden alle Veranstaltungen absolvieren müssen.
Es besteht die Möglichkeit, die aufgeführten Kurse (Tyska I, Tyska II, Kandidatkurs i tyska) Vollzeit zu studieren (30 ECTS pro Semester), oder in Teilzeit, wobei dann pro Semester ca. 15 ECTS absolviert werden. Außerdem können alle Kurse auch abends (d.h. einen Abend in der Woche) studiert werden, dann werden in der Regel maximal 15 ECTS pro Semester abgeschlossen. Letztere Option wird häufig von Berufstätigen, Senior/-innen, Studierenden anderer Fächer oder Studierenden in Elternzeit wahrgenommen, so dass die Abendgruppen häufig altersmäßig (vgl. Kapitel 4.3.2) und in Bezug auf Vorkenntnisse und Motivation sehr heterogen sind. Auch die Gruppe derer, die am Tage studieren, ist heterogen, doch handelt es sich bei dieser Gruppe oft um Studierende zwischen 19 und 30 Jahren, ältere Studierende sind eher die Ausnahme.
Die Zusammensetzung der Studierendengruppen ist für den Unterricht folgenreich, denn Themen und Unterrichtsmethodik müssen so abgestimmt sein, dass möglichst alle Studierenden, egal mit welchen Vorkenntnissen, einen Nutzen aus dem Unterricht ziehen können.
3.1.1 Sprachliche Voraussetzungen der Studierenden
Die Zugangsvoraussetzung für Tyska I ist, neben der schwedischen Allgemeinen Hochschulreife, der Nachweis von Deutschkenntnissen auf dem Niveau A2. Diese werden meist auf dem schwedischen Gymnasium erworben (dort: steg 31 / Stufe 3).2 Wer diese Zugangsvoraussetzung nicht erfüllt, hat z.B. die Möglichkeit, an der Universität Stockholm die Anfängerkurse I und II zu studieren, aber auch Abschlüsse von Sprachkursen oder das „Goethe-Zertifikat A2“ werden anerkannt.
Viele Studierende besitzen jedoch Deutschkenntnisse auf einem höheren Niveau, die sie in der Schule, durch Aufenthalte in den deutschsprachigen Ländern oder durch deutschsprachige Familienangehörige erlangt haben. Zudem studieren jedes Semester auch Studierende mit Deutsch als L1 Germanistik. Insgesamt sind die Studierendengruppen also sprachlich als sehr heterogen zu bezeichnen, was eine Bereicherung des Unterrichts sein kann, zumindest aber eine Herausforderung für die Lehrenden darstellt. In Kapitel 4.3.2 wird genauer auf die Deutschkenntnisse der Studienteilnehmer und -teilnehmerinnen eingegangen.
3.2 Das Landeskundeseminar
Der Landeskundeunterricht an der Universität Stockholm (De tyskspråkiga ländernas realia) ist, wie Tabelle 1 zeigt, Teil des ersten Semesters (Tyska I) und umfasst 3 ECTS. Zur Zeit der Datenerhebung, die im Rahmen dieser Studie stattfand, waren weder aktive Mitarbeit noch Anwesenheit obligatorisch, die 3 ECTS erhielten die Studierenden für die bestandene Klausur. In der Regel nehmen ca. 80 % der registrierten Studierenden am Unterricht (9 Seminare à 90 Minuten, siehe Anhang) teil. Im Wintersemester findet der Kurs nur für die Tagesgruppe statt, es nehmen dann ca. 15 bis 25 Studierende teil. Im Sommersemester findet der Kurs für die Tages- und die Abendgruppe zusammen statt, dann besuchen ca. 30 bis 45 Studierende regelmäßig den Unterricht.
3.2.1 Lehr- und Lernziele
Die Lernziele des Landeskundeunterrichts müssen, wie die Lernziele aller Kurse an schwedischen Universitäten, nach den Richtlinien des schwedischen Högskoleverket, das das nationale Regelwerk für den universitären Unterricht festlegt, formuliert werden,1 d.h., dass sie entsprechend der übergreifenden Lernziele Kunskap och förståelse (ungefähr: „Wissen und Verstehen“), Färdighet och förmåga („Fähigkeiten und Fertigkeiten“) und Värderingsförmåga och förhållningssätt („Urteilsvermögen und Verhaltensweisen im Sinne eines Sich-Verhaltens“)2 zu formulieren. Es wird deutlich, dass diese Lernziele ausdrücklich auch generische Kompetenzen enthalten, wie es auch in den Richtlinien formuliert ist:
Dimensionerna täcker dock mer än det rent ämnesspecifika innehållet och lyfter därmed fram mer generella kompetenser, t ex analytisk förmåga, muntlig och skriftlig framställning, förmåga att arbeta i grupp, förmåga att argumentera.
Die Dimensionen decken aber mehr als den rein fachspezifischen Inhalt ab und betonen damit generelle Kompetenzen, z.B. analytische Fertigkeiten, mündliche und schriftliche Präsentation, Fähigkeit zur Gruppenarbeit, Argumentationsfähigkeit. (Übersetzung CB)
Darüber hinaus müssen die Lernziele mit „aktiven Verben“ und dem „Studierenden als Subjekt“ formuliert werden, denn so sollen die Lernziele beobachtbar und evaluierbar werden.3 Die Lernziele des Landeskundeunterrichts sind demnach wie folgt formuliert:
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
beskriva de tyskspråkiga ländernas geografi samt de politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förhållandena i dessa länder, sedda i ett historiskt perspektiv
reflektera över tolkningar av politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden i de tyskspråkiga länderna.4
Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Kurs soll der Studierende
die Geographie und die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verhältnisse in diesen Ländern [den deutschsprachigen Ländern, Anm. CB] beschreiben können,
und auch aus einer historischen Perspektive über Deutungen der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verhältnisse in den deutschsprachigen Ländern reflektieren können. (Übersetzung CB)
Das erste Lernziel erinnert an den faktenorientierten kognitiven Landeskundeunterricht, doch ist die Aufreihung klassischer Landeskundethemen als Möglichkeit zu lesen, dass die Lehrenden selbst Inhalte bestimmen. Die sogenannten Kurspläne, d.h. die Dokumente, in denen die Lernziele festgehalten werden, müssen in einem recht aufwendigen bürokratischen Prozess verabschiedet werden, so dass die Lernziele durch eine offene Formulierung möglichst eine lange Gültigkeit haben sollten.5
Im zweiten Lernziel wird schließlich angedeutet, dass es nicht (nur) um die Vermittlung von Faktenwissen geht; ebenso wichtig ist die Behandlung von Deutungen, die hinter Ereignissen und Zuständen stehen. Deutungen im Plural weist darauf hin, dass Multiperspektivität und Narrativen sowie auch geteilten Wissensbeständen eine wichtige Rolle zugesprochen wird. Deutlich wird außerdem, dass der Landeskundeunterricht als ein plurinationaler verstanden wird; die Berücksichtigung der deutschsprachigen Länder spiegelt sich auch wider in Teilkursen wie Deutschsprachige Literatur nach 1945.
Abgeschlossen wird der Kurs zur Zeit der Datenerhebung mit einer zweistündigen Klausur, in der die Studierenden auf Deutsch fünf relativ komplexe Fragen zum Kursinhalt beantworten müssen.6 Diese fünf Fragen werden aus einem Fragenkatalog von ca. 25 Fragen ausgewählt, die die Studierenden einige Wochen vor der Klausur erhalten.
Neben den vorgegebenen Lehr- und Lernzielen, dem didaktischen Konzept des Instituts bzw. des Lehrenden sollten außerdem die Erwartungen, Bedürfnisse und Wünsche der Lernenden berücksichtigt werden. Im Wintersemester 2012/13 wurde aus diesem Grund im Rahmen des Landeskundeunterrichts von dreißig Studierenden ein Fragebogen zu Vorkenntnissen und Erwartungen im Fach Landeskunde ausgefüllt. Damit wurden also nicht die Interessen und Motivationen der Studienteilnehmer/-innen abgefragt, doch können die Erkenntnisse zumindest richtungsweisend sein. Das Ergebnis war u.a., dass sechsundzwanzig der dreißig Befragten angaben, „aus Interesse“ Deutsch zu studieren,7 so dass davon ausgegangen werden kann, dass die generelle Motivation, sich mit der deutschen Sprache auseinanderzusetzen, vermutlich als eine integrative (vgl. Gardner/Lambert 1972, 132)8 bezeichnet werden kann. Andererseits plant ein Großteil einen Auslandsaufenthalt in einem deutschsprachigen Land,9 so dass auch in gewissem Maß eine instrumentelle Motivation vorliegt. Des Weiteren wurden die Befragten gebeten anzugeben, wie wichtig Landeskundeunterricht im Vergleich zum Sprachunterricht sei: Fünfundzwanzig gaben an, er sei „genauso wichtig“, weitere fünf, er sei „weniger wichtig“. Es wurde außerdem gefragt, welche Themenbereiche hinsichtlich des Landeskundeunterrichts die Befragten für relevant erachteten: Die wichtigsten Themen sind demnach die „Geschichte der deutschsprachigen Länder“, „aktuelle Themen“ sowie „Alltagsleben und Traditionen“. Inwieweit die im Fragebogen vorgegebenen Themen tatsächlich den Interessen der Befragten entsprachen, bleibt allerdings unklar. Andererseits lässt die Befragung auch die Annahme zu, dass viele entweder genau die vorgegebenen Themenbereiche relevant finden oder keine genauen Vorstellungen haben, denn auf die Frage „Welche weiteren Themen/Fragen möchtest du im Unterricht behandeln?“ wurde insgesamt nur drei Mal geantwortet, und zwar: „Philosophie“, „Dialekte“, „Popkultur“.
3.2.2 Technische Medienkompetenz
Neben inhaltlichen Wünschen der Studierenden muss, da es sich um einen Blended-Learning-Kurs handelt, auch die technische Medienkompetenz berücksichtigt werden. Im Jahre 2012, d.h. im Jahr vor der ersten Datenerhebung, nutzten 89 % der schwedischen Bevölkerung das Internet. In der Altersgruppe 16 bis 44 Jahre nutzten 89 % das Internet täglich, in der Altersgruppe 45 bis 74 Jahre war der entsprechende Anteil 62 %.1 Schweden kann also als ein Land betrachtet werden, dessen Einwohner eine hohe Internetaffinität haben. Auch wenn meines Wissens keine Daten zu den Erfahrungen mit asynchroner Online-Kommunikation in privaten oder beruflichen Situationen oder Unterrichtszusammenhängen vorliegen, kann davon ausgegangen werden, dass internetaffine Studierende keine großen Schwierigkeiten haben sollten, sich die Prinzipien asynchroner computervermittelter Kommunikation anzueignen.
Von den Studierenden, die im Sommersemester 2013 an der Studie teilnahmen und einen Hintergrundfragebogen ausfüllten, gaben alle an, dass sie gute bzw. sehr gute Internetkenntnisse besäßen, 13 von 16 gaben an, bereits mit Lernplattformen gearbeitet zu haben. Dennoch wurde im Rahmen des Unterrichts eine fakultative Einführung in die Lernplattform Mondo angeboten, auf der die Online-Phasen stattfanden: Selbst an Internet und den Umgang mit Lernplattformen gewöhnte Studierende können Schwierigkeiten mit Blended-Learning-Umgebungen haben, die sich oftmals als komplex erweisen (vgl. Kirchhoff 2008, 102). Teil dieser Einführung war eine Aufgabe zum Kennenlernen der anderen Studierenden, die zugleich in die Arbeit im Forum der Lernplattform einführte, im Rahmen dieser Arbeit aber nicht beachtet wird.
3.2.3 Themenauswahl
Inhaltlich ist der hier untersuchte Landeskundeunterricht an den in Kapitel 2.2.2 zusammengefassten kulturwissenschaftlich orientierten Landeskundeansätzen ausgerichtet. Übergeordnetes Ziel ist es, den Studierenden geteiltes Wissen zu vermitteln, das viele Deutschsprachige bewusst oder unbewusst haben. Dass dies nur exemplarisch geschieht, ist dabei selbstverständlich, ebenso auch die Tatsache, dass diese Auswahl immer eine subjektive ist, die von Interessen der Lehrenden abhängt. Die Themen wurden zusammengestellt in Absprache mit anderen Lehrenden am Institut und unter Berücksichtigung anderer Kurse von Tyska I, vor allem dem Literaturkurs, in dem deutschsprachige Literatur seit 1945 gelesen und besprochen wird, und dem Kurs Schriftlicher Ausdruck, in dem auch landeskundliche Themen behandelt werden. Im letztgenannten Kurs erhalten die Studierenden z.B. die Aufgabe, eine Rezension des Films Die fetten Jahre sind vorbei zu schreiben, der ohne Wissen über die 68er-Bewegung in Teilen unverständlich sein dürfte. Aufgabe des Landeskundeunterrichts ist daher auch die Vermittlung von Kenntnissen über die 68er-Bewegung, was jedoch nicht bedeuten soll, dass der Landeskundeunterricht lediglich die Funktion eines ‚Hintergrundwissen‘ vermittelnden Kurses hat, der die Lücken ausfüllt, die in anderen Kursen aufgrund Zeitmangels nicht berücksichtigt werden können. Vielmehr wird dieses Wissen exemplarisch verknüpft mit Wissen über Konzepte wie Identität, Mythos, Erinnerung, Nation und Kultur, so dass die Studierenden nachhaltig lernen, grundlegende kulturwissenschaftliche Fragestellungen auf Bereiche, die ihnen neu begegnen, anzuwenden (siehe dazu und dem Folgenden: Becker 2013a, Becker 2015). Die Auseinandersetzung mit der Konstrukthaftigkeit von z.B. Entitäten wie Nation, Erinnerung und Identität trägt zudem zur Entwicklung der oftmals eingeforderten generischen Kompetenzen bei. Exemplarisch werden im Folgenden einige Unterrichtsthemen beschrieben (siehe dazu auch Becker 2013a), wobei dem Thema „Gründungsmythos der Bundesrepublik“ besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, da die das Kapitel zu ausgewählten Kontextfaktoren auf der Analyse dieser zusammengehöriger Online-Diskussionen beruht (vgl. Kapitel 5). Eine Auflistung der im Unterricht behandelten Themen und verwendeten Texte findet sich im Anhang.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.