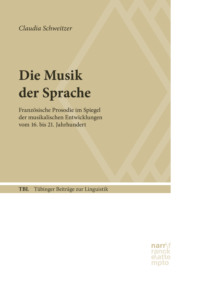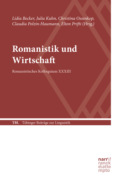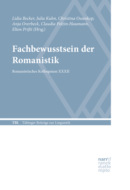Kitabı oku: «Die Musik der Sprache», sayfa 2
1 Prosodie und Musik: eine lange gemeinsame Geschichte
Die Etymologie des Wortes Prosodie weist bereits auf seine interdisziplinäre Ausrichtung hin: Im Altgriechischen bezeichnete ôdê einen Gesang mit Instrumentalbegleitung (Dodane, 2003: 28), prosôidia (griechisch) bezeichnet die melodische Akzentuierung des Altgriechischen und bezieht sich damit gleichermaßen auf Sprache und auf Musik. Die Musikwissenschaft spricht vom „Hinzusingen“ (Pöhlmann, 2016) und verweist damit ebenfalls auf beide Bereiche (je nach Auslegung ist der Text der Melodie hinzugefügt, oder umgekehrt). Der Begriff Intonation, der auf das lateinische Verb intonare zurückgeht, wurde laut Mario Rossi (1999) bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts ausschließlich verwendet, um vom Anstimmen einer musikalischen Melodie zu sprechen. Aufgrund einer falsch verstandenen etymologischen Verwandschaftsbeziehung mit dem Wort tonus wurde der Begriff intonation in Frankreich mit Beginn des 19. Jahrhunderts als Synonym für musicalité und für die mélodie der Stimme gebraucht. Damit bahnte sich eine Bedeutungsverschiebung an, die dazu geführt hat, dass in der Linguistik der Begriff Intonation heute als das Zusammenwirken von Akzent (Intensität) und Tonhöhenverlauf verstanden wird. 1993 erklärte Flo Menezes die prosodische Intonation zum deutlichsten Element, an dem sich die Verwandtschaft von Sprache und Musik unverzüglich einem jeden Hörenden erschließt.1
Jahrhundertelang waren Rhythmus und Silbenlänge Hauptthema der Poeten, und die Beschäftigung mit der antiken Poesie hat zur Herausbildung eines raffinierten metrischen Systems geführt, in dem zahlreiche Kombinationen von langen und kurzen Silben katalogisiert sind. Die ursprünglich griechischen Namen dieser Metren, wie iambe ( ᴗ – ), trochée ( – ᴗ ), spondée ( – - ), tribraque ( ᴗ ᴗ ᴗ ), anapeste ( ᴗ ᴗ – ), dactyle ( – ᴗ ᴗ ), amphibraque ( ᴗ – ᴗ ), crétique ( - ᴗ - ), péon ( – ᴗ ᴗ ᴗ ), choriambe ( – ᴗ ᴗ – ) und pyrrhique ( ᴗ ᴗ ᴗ ᴗ )2 werden heute noch in französischen musiktheoretischen Texten zur Bestimmung der Sequenzierung musikalischer Grundrhythmen verwendet.
Prosodie und Musik blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück. Diese kommt heute allerdings hauptsächlich zwischen den Zeilen zum Ausdruck, zum Beispiel durch die Wahl musikalischer Notationen zur Verdeutlichung verschiedener Intonationsmuster.
1.1 Prosodie und stimmlicher Ausdruck
Wer von Prosodie spricht, denkt an Melodie, an Rhythmus, an Tempo, Intonation, Akzentuierung und/oder an Intensität. Diese Parameter sind untrennbar von (praktisch jeder) menschlichen vokalen Äußerung. „Betrachtet man die alltägliche Konversation, ist doch die Art und Weise wie eine Person etwas sagt – die Prosodie – oft ein scheinbar besserer Spiegel ihres Inneren, ihrer Einstellungen, Absichten und Emotionen, als der eigentliche Wortlaut selbst“, so Daniela SammlerSammler, Daniela (2014). Eine Stimme, der es an Variationen eines oder mehrerer der genannten Parameter mangelt, wird als ausdruckslos empfunden. Der Diskurs wirkt statisch und der Sprecher oder die Sprecherin machen einen unbeteiligten Eindruck, denn die Prosodie übermittelt „nicht nur wesentliche sprachliche Informationen, sondern ist auch Ausdruck der emotionalen und sozialen Befindlichkeit des Sprechers oder der Sprecherin“ (SammlerSammler, Daniela, 2014). Heute existiert eine reiche Literaturauswahl1 mit Erläuterungen und Übungen um zu lernen, ausdrucksvoll (und überzeugend) zu sprechen, das heißt, seine Stimme, und damit die prosodische Gestaltung des Gesagten, zu beherrschen und so den Eindruck, den der Hörer oder die Hörerin haben wird, zu beeinflussen.
Diese Bemerkungen gelten für jegliche Art stimmlicher Äußerung wie freies Sprechen, Vorlesen, Rezitieren, Deklamieren oder Singen gleichermaßen. Damit ist die Prosodie ein von Grund auf interdisziplinäres Phänomen.2 Diese Tatsache spiegelt sich deutlich in der Definition wider, die der Trésor de la langue française informatisé (TLFI) zu diesem Terminus gibt und in der drei Disziplinen angesprochen werden: Metrik oder Poesie (verstanden als die Regeln der Verskunst, das heißt, Vokallängen, Akzentuierung und Intonation), Linguistik (in der französischen Schule verstanden als Studie der prosodischen Parameter wie Melodie, Intonation und Dauer) und Musik (im Rahmen der Wort- Tonbeziehung).3
In allen Bereichen dient die Prosodie zum Ausdruck von linguistischen wie von extralinguistischen Elementen. Zur ersten Kategorie zählen Variationen, die typisch für eine bestimmte Sprache sind (wie der Wortakzent oder die Sprachmelodie im Allgemeinen, Versmuster, oder auch musikalische Floskeln, die für einen ganz bestimmten Stil typisch sind). Die zweite Kategorie umfasst all die Stimmvariationen, die zum faktischen Inhalt der Äußerung einen affektiven oder emotionalen Gehalt hinzufügen, wie zum Beispiel der Sprachduktus oder das spontan – bewusst oder unbewusst4 – gewählte Tempo eines deklamatorischen oder musikalischen Vortrags. Der französische Grammatiker Jean-Baptiste MontmignonMontmignon, Jean-Baptiste (1785) erwähnt im 18. Jahrhundert bereits diese beiden Dimensionen, wenn er Prosodie mit der Ordnung und Struktur des Diskurses ebenso in Verbindung setzt wie mit seinem Ausdrucksgehalt.5 Daniela SammlerSammler, Daniela (2014) weist der Prosodie sogar drei sprachliche Funktionen zu: Die erste ist linguistisch und betrifft die semantische, syntaktische und lexikalische Struktur der Aussage. Die zweite ist „selbstexpressiv“ und von den Emotionen und Einstellungen der Person sowie von der Sprechsituation bestimmt. Die dritte schließlich ist pragmatisch und an bestimmte Sprechakte in einer Kommunikationssituation gebunden (Kritik, Vorschlag, …).
All die Parameter, die unter dem Oberbegriff Prosodie zusammengefasst werden, machen eine Information zu dem, was wir wahrnehmen: Die Prosodie erlaubt es uns, anhand des melodischen, intonatorischen, rhythmischen und akzentuellen Verlaufs eine mit der menschlichen Stimme zum Ausdruck gebrachte Nachricht zu interpretieren, und dies aus inhaltlicher wie auch aus emotionaler Sicht.6 Damit kann die Prosodie als das musikalische Element der (gesprochenen) Sprache bezeichnet werden, als die Musikalität, die einer jeden Sprache, einem jeden Sprecher und einer jeden Sprecherin eigen ist.
Gemeinsamkeiten von Sprache und Gesang
Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts taucht das Wort prosodie in französischen Grammatiken nur selten auf.1 Es sind vielmehr die Poeten und besonders die Rhetoriker,2 die sich für die ästhetische und affektvolle vokale Realisierung der Sprache interessieren. Dabei handelt es sich zunächst einmal nicht um freies Sprechen, sondern um die vorbereitete – und damit in einem gewissen Sinne wiederholbare – Realisierung vorformulierter Sätze und Texte.3 Claire Blanche-Benveniste (2010) bezeichnet das hier gemeinte Sprechniveau als eine sorgfältig kontrollierte und zivilisierte, für das öffentliche Reden bestimmte Sprache.4 Lange Zeit bleibt die Prosodie in Frankreich eng mit der art de (bien) parler verbunden.
Pierre de Ramée, genannt RamusRamus, Pierre de, ist der erste französische Grammatiker, der 1572 in seiner Grammaire das Wort prosodie verwendet. Dies geschieht in Gegenüberstellung zur Orthographie: Die Prosodie betrifft die Kunst des Sprechens und die Orthographie diejenige des Schreibens. Beide zusammen bilden die Grammatik.5 Rhythmus und Akzent sind lange Zeit die hauptsächlichen, die Theoretiker der verschiedenen Disziplinen interessierenden Themen. Dabei ist der Begriff rythme, Rhythmus, zunächst einmal gleichbedeutend mit quantité, Quantität, das heißt der Silbenlänge, wohingegen der Akzent eine hauptsächlich melodische Interpretation erfährt. Grammatiker wie Rhetoriker stehen hier in der antiken Tradition: Ein mit einem accent aigu gekennzeichneter Vokallaut wird in Analogie mit der in der griechischen Sprache üblichen melodischen Aufwärtsbewegung als aigu (hoch) bezeichnet, ein Vokal mit einem accent grave markiert infolge seiner melodischen Abwärtsbewegung im Griechischen einen Vokal, dessen Klang grave (tief) ist, und der accent circonflexe entspricht melodisch einer Kombination der beiden vorhergehenden Akzente und benötigt dazu eine Silbe mit einer gewissen Grundlänge oder quantité longue. Doch gegen Ende des 17. Jahrhunderts ist eine Umdeutung des Adjektivs aigu, hoch, spürbar, und der konkrete musikalische Anklang des Begriffspaares hoch–tief wird allmählich von einem Transfer in den Bereich des Vokaltimbres überlagert. Ein Vokal mit einem accent aigu (und besonders der Vokal e) wird nunmehr auch als fermé (geschlossen) und/oder masculin (männlich) bezeichnet und derjenige, der einen accent grave trägt, als ouvert (offen). Diese Tendenz, die sich bei den Autoren der Grammaire générale et raisonnée (ArnauldArnauld, Antoine & LancelotLancelot, Claude, 1660) anbahnt, ist bei François-Séraphin RégnierRégnier-Desmarais, François-Séraphin-Desmarais (1706) und Claude BuffierBuffier, Claude (1709) deutlich spürbar.6 Abbé BoullietteBoulliette, Abbé erklärt schließlich 1760 unmissverständlich, dass der französische Akzent nur in Namen und Schriftbild Ähnlichkeiten mit dem griechischen aufweise, keinesfalls aber in der Ausführung.7 Doch melodisch oder klanglich,8 der Akzent ist in jedem Fall als ein linguistisches, sprachtypisches Element betrachtet.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts bestätigt Jean-Léonor Le Gallois GrimarestGrimarest, Jean-Léonor Le Gallois die Verbindung von sprachlichem und musikalischem Ausdruck in seinem Traité du récitatif (1707). Der Terminus récitatif ist hier nicht mit der Gesangsgattung des Rezitativs zu verwechseln: Er ist direkt von dem Verb réciter (rezitieren) abgeleitet. Laut GrimarestGrimarest, Jean-Léonor Le Gallois bilden die Konversationssprache, das laute Lesen im privaten Kreis, das Sprechen in der Öffentlichkeit (Redner, Anwalt …), die Theaterdeklamation und der Gesang eine Art von Kontinuum. Stufenweise werden die ausdrucksstarken und expressiven Elemente wie das Volumen, die Betonung oder die Akzentuierung gesteigert, so dass der Gesang als letzte Stufe alle vorherigen Sprecharten enthält, aber durch die ihm eigenen zusätzlichen Ausdrucksfähigkeiten in besonderer Weise Gefühle übermittelt und hervorruft. Vokalmusik ist damit laut GrimarestGrimarest, Jean-Léonor Le Gallois „eine Art von Sprache“.9 Der Komponist kann als ein traducteur, ein Übersetzer angesehen werden, der Gedanken und Gefühle mittels seiner Kunst auszudrücken versteht.
Dass diese Bemerkung durchaus wörtlich zu nehmen ist, zeigt der bekannte Bericht, nach dem der Komponist Jean-Baptiste LullyLully, Jean-Baptiste seine Melodien genau nach der Sprechart der berühmten Schauspielerin Marie Desmares (1642-1698), genannt La Champmeslé, formte.10 Noch am Ende des 18. Jahrhunderts bestätigt André-Ernest-Modeste GrétryGrétry, André-Ernest-Modeste (1789) die Effizienz eines derartigen Kompositionsverfahrens: Für ihn gehört das Studium der Deklamation zum unabdingbaren Handwerkszeug des Komponisten.11
Knapp achtzig Jahre nach GrimarestGrimarest, Jean-Léonor Le Gallois und etwa zur selben Zeit wie GrétryGrétry, André-Ernest-Modeste bezeichnet Etienne de LacépèdeLacépède, Etienne de (1785: 32) die Musik als „la vraie langue des passions“, die wahre Sprache der Gefühle, eine Sprache, die mehr berührt als die gesprochenen Worte,12 und dies, da sie die klingenden und musikalischen Laute – das heißt die Vokale – in den Vordergrund stellt. Der gesangliche Anteil der Sprache ist damit der Kontinuität der Klänge gleichgesetzt. Noch der Grammatiker Napoléon LandaisLandais, Napoléon betont zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dass die prononciation soutenue, der gewählte und eingeübte Vortrag, eine „Art von Gesang“ ist, in dem Stimmmodulation und Silbenlänge notiert sind.13
Mischformen
Heute erinnert an diese Gemeinsamkeit die Technik des 1897 von Engelbert Humperdinck begrifflich eingeführten und besonders seit der Wiener Schule (zum Beispiel bei Arnold Schönberg und Alban Berg) entwickelten Sprechgesangs,1 bei der sich Sprech- und Gesangsstimme einander annähern. Dazu werden feste Parameter wie ein exakter Rhythmus oder eine genaue Tonhöhe für die Sprechstimme fixiert, die damit Allusionen an die Gesangsstimme erhält. Für den Vortragsstil der Grande Dame des französischen Chansons, Juliette Gréco (1927-2020), sind effektvoll eingesetzte Passagen im Sprechgesang typisch (Wicke, 2016). Bei einer im März 2021 durchgeführten Umfrage zum französischen Chanson, an der sich 35 Personen mit französischer Muttersprache und 53, für die das Französische nicht ihre Muttersprache darstellt, beteiligten, bezeichneten die Befragten ihre Eindrücke der Stimme französischer Chansonniers wie folgt (Tabelle 1, vgl. auch Bsp. 1):
| Gesangsstimme | Beinahe gesungen | Zwischen Singen und Sprechen | Eher gesprochen | |
| Georges Brassens („Le bricoleur“, 1956) | 23 | 21 | 33 | 8 |
| Léo Ferré („Les Corbeaux“, 1964) | 9 | 17 | 33 | 24 |
| Maxime Le Forestier („San Francisco“, 1972) | 65 | 12 | 2 | 5 |
| Alain Bashung („Jamais d’autres“, 2002) | 1 | 3 | 62 | 16 |
Tabelle 1:
Eindrücke zur verwendeten Stimmart in französischen Chansons (Umfrage März 2021)
Ein signifikanter Unterschied der Wahrnehmung bei den muttersprachlichen und nicht-muttersprachlichen Personen ist nicht festzustellen. Neben klaren Tendenzen (gut 77 % bewerten die Stimme Maxime Le ForestierLe Forestier, Maximes2 als Gesang und weitere 14 % als „beinahe gesungen“, während nur eine Person für Alain BashungBashung, Alain3 von Gesang und drei Personen von „beinahe gesungen“ sprechen) ist auffällig, dass oftmals eine genaue Zuordnung schwierig erscheint, und dies unabhängig von der jeweiligen Muttersprache oder der Tatsache, dass Sänger und/oder Chanson bekannt oder unbekannt sind. Georges BrassensBrassens, Georges4 spricht nicht, aber wie weit seine Stimme sich dem Gesang nähert, scheint nicht eindeutig zu sein: 21 Personen bezeichnen seinen Chansonvortrag als „beinahe gesungen“ und 33 als „zwischen Singen und Sprechen“. Bei Léo FerréFerré, Léo5 und Alain BashungBashung, Alain tendieren die Befragten zu einer von der Sprechstimme zumindest deutlich geprägten Ausdrucksweise: Für FerréFerré, Léo wählen insgesamt 69 % die Antwort „zwischen Singen und Sprechen“ und „eher gesprochen“,6 bei BashungBashung, Alain sind es sogar 92 %. Die unterschiedlichen Eindrücke erklären sich ebenso durch verschiedene persönliche Wahrnehmungen wie durch unterschiedliche Erwartungen oder sogar Definitionen für eine Gesangsstimme. Wir haben hier einen weiteren Beweis für die fließenden Grenzen zwischen den Gattungen.
1.2 Das musikalische Ausdruckspotential der Sprechstimme
Für die Wahrnehmung von Sprache und Musik mobilisiert das menschliche Gehirn ähnliche Erkennungs- und Verarbeitungsprozesse. Laut Emmanuel BigandBigand, Emmanuel und Barbara TillmannTillmann, Barbara (2020) wird Sprache vom Embryo im Mutterleib wie eine musikalische Tonfolge wahrgenommen, und Musikhören bereitet seine zukünftigen sprachlichen Kompetenzen vor. Diese Aussagen beziehen sich zunächst einmal auf die strukturellen Ähnlichkeiten von Sprache und Musik,1 denen dieselben Gliederungs- beziehungsweise Sequenzierungsmuster zugrunde liegen: Minimaleinheiten kombinieren sich in sprachlichen oder musikalischen Sequenzen, die dann durch Variationen von Dynamik, Tonhöhe, Intonation und/oder Rhythmus modelliert werden.2 Dies Phänomen spricht zu Beginn des 19. Jahrhunderts bereits der Musiktheoretiker Jérôme Joseph de MomignyMomigny, Jérôme-Joseph de (1806) an, für den die Musik aufgrund der Tatsache, dass sie ein ihr eigenes System besitzt, eine eigene Sprache darstellt.
Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass Musik, ebenso wie Sprache, semantische Prozesse beeinflussen und die Bedeutung eines Wortes bestimmen kann. In einer Studie mit 122 Versuchspersonen konnten Stefan Koelsch et al. (2004) zeigen, dass die Reaktionen auf in gesprochenen Sätzen oder in Verbindung mit musikalischen Auszügen präsentierte Zielwörter weder signifikante Unterschiede im Verhalten noch in den Auswertungen der N400-Komponente des ereignisbezogenen Gehirnpotentials (ERP) aufzeigen.3
Doch nicht nur die Kognitionswissenschaften, sondern auch Psychologen und Linguisten interessieren sich vermehrt für das Studium der Kommunikation von Emotionen durch bestimmte Verhaltensmuster, Gesten, Stimm- und Sprachmodulationen,4 von denen besonders die letzteren für diese Studie interessant sind.
Kodifikation der Emotionen
Häufig werden die durch Emotionen ausgelösten Stimm- und Sprechmodulationen anhand von Aufnahmen mit Schauspielern studiert.1 Damit stehen Untersuchungen wie die Studie zur Prosodie de l’émotion von Tanja Bänzinger (Bänzinger et al., 2002) in direkter Weise in der alten Tradition der Rhetoriker. Schon die antiken Autoren formulieren Regeln, nach welchen die Ausdruckskraft der Stimme geformt werden kann. Laut CiceroCicero, Marcus Tullio ist eine wohlklingende Stimme das wichtigste Instrument des Redners. Die musikalische Metapher ist bereits angelegt, wenn CiceroCicero, Marcus Tullio erklärt:
Jede Gemütsbewegung hat von Natur ihre eigentümlichen Mienen, Töne und Gebärden, und der ganze Körper des Menschen und alle seine Mienen und Stimmen ertönen, gleich den Saiten der Lyra, so, wie sie jedes Mal von der Gemütsstimmung berührt werden. Denn die Töne sind, wie die Saiten, gespannt, so dass sie jeder Berührung entsprechen: hohe und tiefe, schnelle und langsame, starke und schwache; zwischen allen diesen liegt in jeder Art noch ein Mittelton. Und noch mehrere Unterarten sind aus diesen entstanden: der sanfte und der rauhe Ton, der gepreßte und der gedehnte, der mit gehaltenem und der mit abgestoßenem Atem hervorgestoßene, der stumpfe und der kreischende, der durch Beugung der Stimme entweder verdünnte oder angeschwellte. (CiceroCicero, Marcus Tullio [1873]: 299)
Die Stimme als Spiegel der Gemütsbewegung wird zu einem zentralen Thema in den an Schauspieler gerichteten französischen Texten der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die Autoren sprechen ausführlich von den accents des passions, und jeder Emotion sind auf die Beobachtung realer Sprechsituationen zurückgehende,2 bestimmte stimmliche Attribute zugeordnet. Die Stimme des Traurigen ist sourde (dumpf, klanglos), languissante (schleppend), plaintive (klagend) und von häufigen Seufzern unterbrochen; diejenige des Zornigen ist aiguë (hoch, schrill), impétueuse (ungestüm) und violente (heftig) mit häufigen Atempausen. Freude macht die Stimme pleine (voll), gaie (munter) und coulante (fließend). Die Liste der kodifizierten Passionen kann problemlos fortgesetzt und die hier nach Le GrasLe Gras (1671) und Michel Le FaucheurLe Faucheur, Michel (1676) zitierten Attribute können mit Synonymen und ähnlichen Formulierungen anderer Autoren erweitert werden.3
Die Analyse der vokalen Mittel, die zum ausdrucksvollen Vortrag einer bestimmten Textstelle eingesetzt werden, war früher wie heute ein Mittel, um die vokale Übermittlung von Emotionen zu stilisieren und zu kodieren. Wenn früher allein das Ohr zur Beschreibung der Stimmmodulation eingesetzt werden konnte, so existieren heute neben Aufnahme und anschließender Reproduktion zusätzliche technische Analysemittel. Die Ergebnisse der auf der Basis dieser Möglichkeiten entwickelten Methode zur Studie der emotionsmotivierten Prosodie von Bänzinger et al. (2002) können, so die Autoren, für die vokale Synthese genutzt werden können. Am Anfang steht eine akustische Analyse der segmentierten phonetischen Einheiten, gefolgt von der Berechnung der Mittelwerte der verschiedenen akustischen Parameter (die Grundfrequenzen f°, Tondauern sowie verschiedene Verteilungs- und Proportionswerte). Zur Beschreibung der Intonation werden anschließend die Konturen der Kurven der Grundfrequenzen f° und der Energie stilisiert.
Die zur Studie der durch die Stimme ausgedrückten Emotion untersuchten Parameter entsprechen – wieder einmal – der „Musik der Sprache“, und der gewählte Ansatz erhält eine sinnvolle Begründung durch die Arbeiten im Bereich der Kognitionswissenschaft. Laut Brück et al. (2013: 265-266) scheint die Verarbeitung der emotionalen Prosodie im Gehirn einen doppelten Weg von der Signalaufnahme bis zur Verhaltenskontrolle einzuschlagen: Die explizite Sprachverarbeitung erfolgt in den frontalen Hirnregionen in drei Schritten, von denen jeder eine spezifische Aufmerksamkeitsfokussierung erfordert:
1 Die spezifischen akustischen Merkmale der emotionalen Prosodie werden herausgefiltert,
2 Die emotionalen Inhalte werden durch die Integration prosodischer Informationen der analysierten Aussage und anderer Kommunikationskanäle sowie durch Abgleich mit Assoziationen kompatibler Gedächtnisinhalte identifiziert,
3 Art und Ausprägung verschiedener, im analysierten Signal enthaltener Emotionen werden evaluiert.
Gleichzeitig werden die impliziten Signale auf einem schnelleren Weg, der Induktion emotionaler Reaktionen, in den limbischen und paralimbischen zerebralen Strukturen verarbeitet. Eine forcierte, den expliziten Sprachinhalten gewidmete Aufmerksamkeit kann allerdings die limbischen, emotionalen Strukturen hemmen „und somit zu einer Unterdrückung impliziter Verarbeitungsprozesse führen“ (Brück et al., 2013: 266). In diesem Zusammenhang ist interessant, dass das limbische System, das die impliziten Signale der emotionalen Prosodie verarbeitet, in besonderer Weise durch Musik angeregt wird. Wie Emmanuel BigandBigand, Emmanuel und Suzanne Filipic (2008) zeigen konnten, erfolgen die kognitiven Reaktionen, die emotionellen Antworten auf musikalische Ereignisse entsprechen, normalerweise unverzüglich, von der ersten Hunderstelsekunde der Wahrnehmung an, und dies bei musikalisch gebildeten oder unbedarften Versuchspersonen sowie für bekannte oder unbekannte musikalische Werke gleichermaßen.4 Die These, dass wir auf die Intonation der Sprechstimme wie auf eine fröhliche, traurige, melancholische oder anregende Melodie reagieren, und dass damit Melodien oder Intonationskurven stilisiert werden können, die automatisch und unbewusst bestimmten Emotionen zugeordnet werden, ist von Forschern wie Iván FónagyFónagy, Ivan untersucht worden.