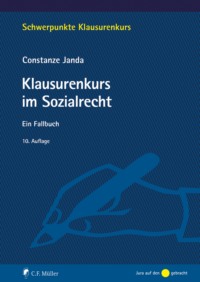Kitabı oku: «Klausurenkurs im Sozialrecht», sayfa 4
b) Verhältnismäßigkeit des Versicherungsobligatoriums
19
Die Pflegeversicherung verstößt gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Art. 20 Abs. 1 GG: Rechtsstaatsprinzip), wenn sie weder erforderlich noch geeignet ist, noch schließlich der erstrebte Zweck und die dafür eingesetzten Mittel in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen.
Seit mehr als einem Jahrhundert[9] hat die Sozialversicherung ihre Eignung für die Bewältigung der Massenrisiken erwiesen. Sie vermag einem großen Bevölkerungsteil einen angemessenen Schutz im Falle der Verwirklichung elementarer Daseinsrisiken zu gewähren. Die Sicherung bei Pflegefällen wird in vielen Staaten durch die Sozialversicherung gewährleistet, sei es als unselbstständiger Teil des Gesundheitswesens, sei es als eigener Leistungszweig oder als eine im Zusammenhang mit dem Alter stehende, ergänzende Sicherung.[10]
In der Vergangenheit zeigte sich, dass die Bereitschaft zur freiwilligen Vorsorge für das Risiko der Pflegebedürftigkeit nicht bestand. Vor Einführung der Pflegeversicherung war die Mehrzahl der Pflegebedürftigen deshalb auf die Sozialhilfe angewiesen.[11] Aufgrund der Subsidiarität der Sozialhilfe hatten pflegebedürftige Personen zudem zunächst das eigene Vermögen aufzubrauchen und Unterhaltsansprüche gegen Verwandte in gerader Linie geltend zu machen. Pflegebedürftigkeit erwies sich damit als spezifisches Armutsrisiko. Durch die Sozialversicherung Vorsorge auch für die nicht akut vom Pflegerisiko Betroffenen zu schaffen, war demnach statthaft, weil nur so eine hinreichend leistungsfähige Solidargemeinschaft gebildet werden konnte, die den Schutz der Pflegebedürftigen zu bezahlbaren Beiträgen sichert. Vergleichsweise niedrige Beiträge für möglichst viele Menschen verbürgen den Schutz für ein Risiko, dessen Eintritt regelmäßig mit erheblichen Folgen für den Einzelnen wie die staatliche Gemeinschaft verbunden ist.
20
Die Art und Weise der Ausgestaltung des Versicherungsobligatoriums ist vom traditionell weiten sozialpolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers gedeckt. Da die Versicherungsprämien im Vergleich zu den hohen Kosten eines Pflegefalls niedrig sind, ist schließlich auch die Angemessenheit im Einzelfall gewahrt.[12]
Die Regelung ist daher formell und materiell verfassungskonform. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Einbeziehung freiwillig privat gegen Krankheit Versicherter sind nicht begründet.
II. Verfassungsmäßigkeit des Beitragszuschlags für Kinderlose
21
Der in § 55 Abs. 3 SGB XI verankerte Beitragszuschlag in Höhe von 0,35% für Kinderlose könnte ungewollt Kinderlose in ihrem Recht auf Gleichbehandlung aus Art. 3 Abs. 1 GG verletzen.
1. Ungleichbehandlung i.S.v. Art. 3 Abs. 1 GG
22
Der in Art. 3 Abs. 1 GG verankerte Gleichbehandlungsgrundsatz fordert nicht die unbedingte Gleichstellung aller Sachverhalte im Gesetz. Nach der „neuen Formel“ des BVerfG liegt eine unzulässige Ungleichbehandlung vielmehr nur dann vor, wenn eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu einer anderen Gruppe unterschiedlich behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine derart substanziellen Unterschiede bestehen, welche die Ungleichbehandlung rechtfertigen könnten.[13]
Durch § 55 Abs. 3 SGB XI werden Kinderlose im Verhältnis zu den Personen ungleich behandelt, die ihren Kinderwunsch erfüllen können. Beide Gruppen unterscheiden sich jedoch dadurch, dass diese einen generativen Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung leisten, jene aber nicht. Dies begründet einen durchaus substanziellen Unterschied im Hinblick auf das Ziel der Regelung, die beitragsrechtliche Besserstellung von Beitragszahlern mit Kindern zu bewirken: Das BVerfG[14] war der Auffassung, es sei mit Art. 3 Abs. 1, 6 Abs. 1 GG unvereinbar, „dass Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung, die Kinder betreuen und erziehen, mit einem gleich hohen Pflegeversicherungsbeitrag wie Mitglieder ohne Kinder belastet werden“. Das BVerfG[15] verlangte daher, dass die Versicherten regelmäßig für den Schutz vor einem altersspezifischen Risiko durch die Sozialversicherung sowohl einen monetären, als auch einen regenerativen Beitrag leisten. Erbrächten sie lediglich den monetären, nicht aber den regenerativen Beitrag, müssten sie diesen Ausfall durch einen höheren monetären Beitrag ausgleichen.
23
Indes werden alle kinderlosen Versicherten zu einem Beitragszuschlag herangezogen. Sie werden gleich behandelt, obwohl die Kinderlosigkeit auf unterschiedlichen Gründen beruhen kann – sowohl auf einer höchstpersönlichen Entscheidung über die eigene Lebensgestaltung als auch auf der medizinischen Unfruchtbarkeit. Es ist jedoch fraglich, ob die Motivation, Kinder zu bekommen, einen derart substanziellen Unterschied zwischen beiden Gruppen begründet, dass eine Differenzierung nach dem Grund der Kinderlosigkeit geboten ist.[16] In letzter Konsequenz wird damit die Frage aufgeworfen, ob allein die subjektive Bereitschaft Kinder aufzuziehen, eine beitragsrechtliche Privilegierung im Recht der sozialen Pflegeversicherung nach sich ziehen muss. Das BVerfG hat seine umstrittene Forderung nach der beitragsrechtlichen Entlastung von Eltern auf den in Art. 6 Abs. 1 GG verankerten besonderen Schutz der Familie gestützt. Dieser Gedanke kann schlechterdings nur Personen betreffen, die als Familie leben, setzt also das Vorhandensein von Kindern zwingend voraus. Es ist daher bereits fraglich, ob überhaupt eine Ungleichbehandlung vorliegt.
2. Sachliche Rechtfertigung
24
Selbst wenn man eine Benachteiligung all jener annimmt, die aus gesundheitlichen Gründen nicht zeugungs- bzw. empfängnisfähig sind, ist diese gerechtfertigt. Problematisch wäre bereits die Ausgestaltung der verfahrensrechtlichen Nachprüfbarkeit der Motive der Kinderlosigkeit. Es bedeutete zweifelsohne einen erheblichen Eingriff in die Intimsphäre der betroffenen Personen, wenn die Pflegekasse berechtigt wäre, einen Nachweis über die medizinische Unfruchtbarkeit zu fordern. Dies wäre aber unerlässlich, um über das Bestehen der Pflicht zur Abführung des Beitragszuschlags entscheiden zu können.
Überdies stellt sich die Frage nach der Reichweite der beitragsrechtlichen Privilegierung. Wollte der Gesetzgeber Personen vom Beitragszuschlag ausnehmen, die aus medizinischen Gründen keine Kinder bekommen können, müssten womöglich auch Versicherte vom Beitragszuschlag befreit werden, die ihren Kinderwunsch nicht realisieren können, weil sie keinen Partner haben. Der administrative Aufwand wäre – insbesondere angesichts des vergleichsweise geringen Zuschlags von 0,35 Prozentpunkten – erheblich, sodass der mit der Ungleichbehandlung i.S.v. Art. 3 Abs. 1 GG verbundene finanzielle Nachteil zumindest nicht unverhältnismäßig ist.[17]
III. Beitrags- und Prämiengestaltung für Familien in der Renten- und Pflegeversicherung
25
Die von dem Elternpaar vorgetragenen Bedenken betreffen die Ausgestaltung der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Fraglich ist, inwieweit der von Eltern den Kindern geschuldete Familienunterhalt (§§ 1601 ff. BGB) bei der Festsetzung der Beitragshöhe aus Gründen des Schutzes von Ehe und Familie zu berücksichtigen ist. Hierzu müssen der Auftrag der Art. 3 Abs. 1, 6 Abs. 1 GG bestimmt (1.) und die Berücksichtigung des „generativen Beitrags“ nach dem geltenden Beitragsrecht der Rentenversicherung analysiert werden (2.).
1. Der Auftrag des BVerfG aus Art. 3 Abs. 1, 6 Abs. 1 GG
26
In seiner Entscheidung zum Beitragsrecht in der sozialen Pflegeversicherung hatte das BVerfG die Auffassung vertreten, den „Kinderlosen“ würden auf Kosten der Kindererziehenden für das „altersspezifische Risiko der Pflegebedürftigkeit“ im Umlageverfahren getragene Leistungen aus der Pflegeversicherung zuteil, ohne selbst Kinder erzogen und „damit zum Erhalt des Beitragszahlerbestandes durch Kindererziehung beigetragen“[18] zu haben. „Wenn aber das Leistungssystem ein altersspezifisches Risiko abdeckt und so finanziert wird, dass die jeweils erwerbstätige Generation die Kosten für vorangegangene Generationen mittragen muss, ist für das System nicht nur die Beitragszahlung, sondern auch die Kindererziehung konstitutiv. Wird die zweite Komponente nicht mehr regelmäßig von allen geleistet, werden Eltern spezifisch in diesem System belastet, was deshalb auch innerhalb des Systems ausgeglichen werden muss.“[19]
Die Bindungswirkung der Entscheidung erstreckt sich formal zwar allein auf das Beitragsrecht der sozialen Pflegeversicherung. Es ist jedoch zu prüfen, ob der verfassungsrechtlich gebotene besondere Schutz der Familien die Übertragung der vom BVerfG entwickelten Grundsätze auf die Rentenversicherung gebietet. Art. 6 Abs. 1 GG gebietet die Berücksichtigung der besonderen Lasten von Familien auszugleichen, verpflichtet den Gesetzgeber jedoch nicht, Eltern von jedweder (finanzieller) Belastung freizustellen. Vielmehr ist ihm – auch vor dem Sozialstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 1 GG – ein weiter Gestaltungsspielraum zuzugestehen.[20]
2. Nichtberücksichtigung des „generativen Beitrags“ in der Rentenversicherung?
27
Gegen die Privilegierung von Eltern in der gesetzlichen Rentenversicherung spricht bereits, dass – wiewohl deren Finanzierung im Umlageverfahren auf dem sogenannten Generationenvertrag basiert – keineswegs sichergestellt ist, dass alle geborenen Kinder zur Finanzierung der Rentenleistungen und damit zum Fortbestand des Systems beitragen werden. Wird aus einem Kind später nicht ein sozialversicherungspflichtig Beschäftigter, sondern Beamter, Sozialhilfeempfänger, Auswanderer oder freiberuflich Tätiger, so leisten dessen Eltern gerade keinen regenerativen Beitrag zur Sozialversicherung.[21]
Auch die Systematik des Rentenversicherungsrechts gebietet keine beitragsrechtliche Privilegierung von Eltern. Anders als die soziale Pflegeversicherung gleicht die gesetzliche Rentenversicherung bereits jetzt die mit der Kindererziehung einhergehenden Lasten und Nachteile hinreichend aus. So werden nicht nur spezifische Leistungen gewährt, die an die Kindererziehung anknüpfen, wie etwa die große Witwen- bzw. Witwerrente nach §§ 46 Abs. 2, 243 Abs. 2, Abs. 3 SGB VI oder die Erziehungsrente nach §§ 47, 243a SGB VI. Die Zeiten der Kindererziehung werden überdies auch bei der Berechnung der Rentenleistungen berücksichtigt, sei es als Beitragszeiten nach §§ 56, 249, 249a SGB VI, als Berücksichtigungszeiten nach § 57 SGB VI oder als Anrechnungszeiten nach § 58 SGB VI. Der Umstand, dass ein Versicherter Kinder aufzieht, wirkt sich also leistungserhöhend aus. Dass der Gesetzgeber keine entsprechenden Vergünstigungen im Beitragsrecht vorsieht, ist angesichts dessen von seinem weiten Gestaltungsspielraum gedeckt. Der generative und monetäre Beitrag zur Sozialversicherung kann ohnehin nie vollkommen gleichwertig berücksichtigt werden, da der generative Beitrag nicht per se an die Rentenbezieher ausgeschüttet werden kann.[22]
28
Im Übrigen würde eine beitragsrechtliche Entlastung von Eltern verschiedene systematische Fragen aufwerfen: Soll schon eine Familie mit einem Kind eine Vergünstigung erhalten, obgleich deren regenerativer Beitrag nicht zureicht? Wäre sie, da „fast“ kinderlos, nicht eher mit Beitragszuschlägen zu belasten? Sollen Adoptiv- und Pflegekinder den leiblichen Kindern sozialversicherungsrechtlich gleichstehen: Denn was soll durch die Beitragsregelung honoriert und bonifiziert werden – die Erziehung oder die Geburt eines Kindes? Und ist die Begrenzung auf die in Zukunft Kinder erziehenden Versicherten richtig oder müssen an der Beitragsvergünstigung nicht auch ebenso die Versicherten an den Vergünstigungen teilhaben, die in der Vergangenheit Erziehungsverantwortung getragen haben? Beitragsvergünstigungen für Eltern bieten allenfalls die Chance auf eine mittel- und längerfristige Linderung der demographischen Probleme der Sozialversicherung – bereiten ihr indes im Gegenzug aktuell drängende Probleme ihrer Finanzierung. Denn selbst wenn der regenerative Beitrag dadurch erhöht werden könnte, so träte der monetäre Gewinn erst in Jahrzehnten ein; der durch Verschonung eingetretene Beitragsverlust wäre jedoch durch aktuelle Beitragserhöhungen auszugleichen.
29
Die gegenwärtig in der Sozialversicherung aus dem Bruttoeinkommen des Versicherten zu entrichtenden Beiträge lassen familiäre Belastungen unberücksichtigt. Dies vereinfacht dem Arbeitgeber den Beitragseinzug. Bleibt das ganze Bruttoeinkommen die maßgebende Beitragsbasis, ist ein niedrigerer Beitragssatz eher möglich als bei einer um Unterhaltslasten verminderten Beitragsbasis. Diese Finanzierung rechtfertigt es außerdem, die sozialversicherungsrechtliche Geldleistung als einen Anteil des mit Beiträgen belegten Einkommens zu bestimmen.
30
Der generative Beitrag wird in der gesetzlichen Rentenversicherung in verschiedener Hinsicht berücksichtigt, sodass eine zusätzliche Entlastung von Familien im Beitragsrecht kraft Verfassung nicht geboten ist.[23]
Ergebnis:
31
Die Einbeziehung privat gegen Krankheit Versicherter in die Pflegeversicherung verletzt die allgemeine Handlungsfreiheit nicht.
Auch die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Ausgestaltung der Beiträge zur Renten- und Pflegeversicherung sind unbegründet.
Fall 2
Grundsicherung für Arbeitsuchende – Recht auf Sicherung einer menschenwürdigen Existenz – Bedarfssätze und Existenzminimum – Pauschalierung – Arbeitsgelegenheiten und Sanktionierung – Einkommens- und Vermögensanrechnung – Individualisierung und Sonderbedarfe
Ausgangsfälle: BVerfG, Urt. v. 9.2.2010 (1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09) = BVerfGE 125, 175. BSG, Urt. v. 17.11.2006 (B 7b AS 10/06 R) = BSGE 97, 231. BSG, Urt. v. 23.11.2006 (B 11b AS 1/06 R) = BSGE 97, 265. BSG, Urt. v. 27.2.2008 (B 14/7b AS 32/06 R) = BSGE 100, 83. BSG, Urt. v. 16.12.2008 (B 4 AS 60/07 R) = BSGE 102, 201. BSG, Urt. v. 12.7.2012 (B 14 AS 153/11 R) = BSGE 111, 211.
32
Student Sascha (S) finanzierte sich sein Studium in Leipzig mit verschiedenen geringfügigen Beschäftigungen, erwarb daraus jedoch keine Anwartschaften in der Arbeitslosenversicherung. Er lebt mit seiner ebenfalls studierenden Freundin Frida (F) und zwei gemeinsamen Kindern, der vierjährigen Tanja (T) und dem siebenjährigen Udo (U) zusammen. Mit 29 Jahren absolviert S seinen Master-Abschluss, kann aber danach keine Arbeit finden.
S beantragt beim Jobcenter Leipzig Grundsicherung für Arbeitsuchende. Als ihm der gesetzlich festgelegte Regelsatz für sich und seine Bedarfsgemeinschaft von insgesamt lediglich 1.394 € zzgl. der Kosten für Miete und Heizung überwiesen wird, fühlt sich S ungerecht behandelt. Das SGB II sei in großen Teilen verfassungswidrig, namentlich die Bedarfssätze, die Pflicht zur Annahme von Arbeitsgelegenheiten, die Absenkung der Regelsätze bei Pflichtverletzungen, die gesamte Einkommens- und Vermögensanrechnung und die Ungleichbehandlung von „Hartz IV“-Empfängern gegenüber anderen – etwa beim Kindergeld, dessen Erhöhungen an die Bezieher der Grundsicherung nicht weitergegeben werden. In diesem allen liege ein elementarer Verstoß gegen Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit.
Aufgabe:
S begibt sich zu Ihnen und erbittet eine verfassungsrechtliche Würdigung der von ihm beanstandeten Mängel. Bitte erstellen Sie ein Rechtsgutachten zu den von S aufgeworfenen Fragen.
Gliederung
33
| I. | Verfassungsmäßigkeit der Ausgestaltung der Bedarfssätze | |||
| 1. | Sicherung der physischen Existenz | |||
| 2. | Sicherung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben | |||
| 3. | Bedarfsermittlung und Bemessungsgrundlage der Regelleistung | |||
| a) | Einkommens- und Verbrauchsstichprobe | |||
| b) | Lohnabstandsgebot | |||
| c) | Grundsicherungsleistungen für Kinder | |||
| 4. | Zulässigkeit der Pauschalierung von Sonderbedarfen | |||
| II. | Verfassungsmäßigkeit der Pflicht zur Wahrnehmung von Arbeitsgelegenheiten | |||
| 1. | Begriff des Arbeitszwangs | |||
| 2. | Zulässige Einschränkung von Art. 12 Abs. 2 GG? | |||
| III. | Verfassungsmäßigkeit des Sanktionssystems | |||
| 1. | Schutzbereich des Grundrechts auf Sicherung einer menschenwürdigen Existenz, Art. 1, 20 Abs. 1 GG | |||
| 2. | Folgerungen | |||
| IV. | Verfassungsmäßigkeit der Anrechnung von Einkommen und Vermögen | |||
| 1. | Eingriff in Art. 14 Abs. 1 GG | |||
| 2. | Rechtfertigung des Eingriffs | |||
Lösung
I. Verfassungsmäßigkeit der Ausgestaltung der Bedarfssätze
34
Die Vorgaben in den §§ 20-22 SGB II zur Bemessung der Regelsätze könnten gegen das Grundrecht auf Gewährung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) verstoßen. Dies ist der Fall, wenn die nach dem SGB II zu leistenden Zahlungen nicht ausreichen, um die grundlegenden Lebensbedürfnisse des Empfängers zu decken (1) und ihm ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen (2). Um beides festzustellen, ist die Bemessungsgrundlage für die Regelleistungen ihrerseits auf ihre Angemessenheit hin zu überprüfen (3).
1. Sicherung der physischen Existenz
35
Das BVerfG hat das Recht auf Existenzsicherung, welches durch Leistungen der Grundsicherung gewährleistet wird (§ 1 Abs. 1 SGB II) als in Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG gründendes Menschenrecht anerkannt. Das verfassungsrechtlich garantierte Existenzminimum zahlenmäßig genau zu bestimmen, ist jedoch nicht zuletzt angesichts der beständigen Änderungen unterworfenen wirtschaftlichen Verhältnisse schwierig.[1] Einigkeit besteht darüber, dass die im Rahmen der sozialen Hilfe zu erbringenden Leistungen alle Aufwendungen umfassen, die zur Sicherung der physischen Existenz des Anspruchsberechtigten erforderlich sind. Die Regelsätze sind demnach so bemessen, dass die daraus ermittelten Geldleistungen dem Leistungsempfänger zumindest die Beschaffung von Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Körperpflege und medizinischer Versorgung ermöglichen.
Zwar sieht § 20 Abs. 2 SGB II i.V.m. § 8 RBEG einen monatlich zu zahlenden Betrag von lediglich 446,00 €[2] als Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts für eine alleinstehende erwachsene Person vor. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst aber auch die Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) sowie die Zahlung von Beiträgen für die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung (§ 26 SGB V). In dieser Gesamtheit dienen die Leistungen daher zumindest der physischen Existenzsicherung.[3]