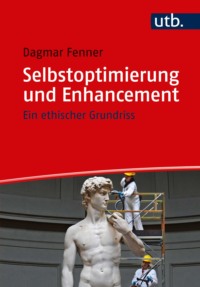Kitabı oku: «Selbstoptimierung und Enhancement», sayfa 2
1.1.2 Das „Selbst“
Das „Selbst“ ist bei Selbstoptimierungs-Handlungen sowohl das Subjekt als auch das Objekt. Allerdings ist das „Selbst“ ein sehr komplexes, aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven unterschiedlich darstellbares Phänomen, sodass es keine einheitliche Begriffsverwendung gibt. Grundlegende Voraussetzung für jedes zielgerichtete Handeln ist jedoch, dass sich das „SelbstSelbst“ in einem theoretischen Selbstverhältnis bewusst wird: Ein „Selbst-Bewusstsein“ entsteht, indem sich ein „kognitives Ich“ oder „reines Selbst“ auf seine Bewusstseins-Akte wie Meinen, Urteilen, Wünschen und Erleben zurückwendet und sich selbst zum Objekt macht. Das Sich-Wiedererkennen und Identifizieren-Können in einem Spiegel dient gerne als Symbol und Zeichen für ein „Selbst“ bzw. „Selbstbewusstsein“, weshalb in der empirischen Forschung ein sogenannter Spiegeltest eingesetzt wird. Gemäß den Sozialpsychologen William James und George Mead lässt sich das Selbst oder die Ich-Identität als ein Gleichgewicht zwischen a) dem aktiven, vollzugshaften Moment des „I“ oder „reinen Selbst“ und b) dem passiven, objektivierten Moment des „me“ oder „empirischen Selbst“ verstehen.
Das reine Selbst, das „Ich“ oder „erkennende Selbst“ (a) meint die mentale Fähigkeit, zu den charakterlichen, biographischen und situativen Gegebenheiten bewusst und reflexiv Stellung zu beziehen. Demgegenüber setzt sich das empirische Selbst (b) aus einem „materiellen Selbst“ mit Körper, Kleidung etc., dem „sozialen Selbst“ mit Status und sozialen Rollen und dem „geistigen Selbst“ mit psychischer Disposition und Charaktereigenschaften zusammen. Ein Selbst, eine Ich-IdentitätIdentität oder persönliche Identität ergibt sich aber erst, wenn die empirischen Aspekte mit den persönlichen kognitiven Deutungen und Bewertungen dieser Tatsachen vermittelt werden. Das verbindende Dritte in diesem Strukturmodell des „Selbst“ ist das „SelbstkonzeptSelbstkonzept/ -bild“ oder „Selbstbild“ eines Menschen, das erst eine gewisse zeitliche Stabilität der persönlichen Identität herzustellen vermag: In der Psychologie wird das Selbstkonzept meist deskriptiv verstanden als das auf eigenen Erinnerungen basierende Wissen davon, wer man selbst ist. Philosophen interessieren sich vornehmlich für die normative Dimension des Selbstkonzepts und sprechen von einem „normativen Selbst“ oder „normativen Selbstbild“ (vgl. KipkeKipke, Roland 2011, 61/Fenner 2007, 98f.): Das normative Selbst oder normative Selbstbild ist ein prospektiver Selbstentwurf, der auf der Grundlage einer umfassenden Interpretation und Bewertung der materiellen, körperlichen, sozialen und geistigen Dispositionen die wichtigsten Lebensziele und Ideale für die zukünftige Entwicklung festlegt.
Bei einem auf Handlungen ausgerichteten praktischen Selbstverhältnis bestimmt das „reine SelbstSelbst“ in einem solchen persönlichen Selbstentwurf, welche Anlagen, Fähigkeiten und sozialen Rollen im eigenen Leben wichtig sind und in welcher Form sie realisiert werden sollen. Wenn jemand allerdings ein völlig realitätsfremdes „normatives Selbst“ oder „Ideal-Selbst“ entwirft, wird dieses ein bloßes Phantasieprodukt bleiben. Ein erfolgreicher Selbstoptimierungsprozess vom Ist- zum Soll-Zustand setzt daher eine möglichst genaue deskriptive Analyse des bereits in Erscheinung getretenen „empirischen Selbst“ voraus. Dem Projekt der Selbstoptimierung sind aber nicht nur durch die genetischen Anlagen und die Faktizität Grenzen gesetzt, sondern auch durch kulturelle und gesellschaftliche Bewertungsmaßstäbe, Idealvorstellungen und faktische Selbsttechnologien. Schon hinsichtlich der Genese eines Selbstbilds und eines prospektiven Selbstentwurfs wäre es ein individualistisches Missverständnis anzunehmen, es handle sich um Kreationen sozial isolierter Einzelindividuen (vgl. dazu KipkeKipke, Roland 2011, 63). Vielmehr findet der Einzelne in seinem sozialen Umfeld Inhalte und Methoden der deskriptiven Selbstbeschreibung und eine Vielfalt an kulturellen normativen Selbstbildern vor, mit denen er sich auseinanderzusetzen hat. Was jemand ist und sein will ist nicht völlig abgekoppelt von anthropologischen und kulturellen Vorstellungen davon, was ein Mensch ist oder sein sollte. Natürlich können sich die Individuen zu den sozialen Deutungsmustern und normativen Standards von gelingender Selbstverwirklichung oder Selbstoptimierung verhalten und sich davon distanzieren, aber sie bleiben doch stets auf diese Maßstäbe bezogen (vgl. ebd., 65). Nicht zuletzt sind auch die Möglichkeiten und Grenzen der konkret zur Verfügung stehenden Praktiken und Techniken zur Selbstverbesserung kulturell vorgegeben. Von der anderen Seite aus gedacht erhebt der Einzelne mit seinem normativen Selbstkonzept oder seinen Selbstoptimierungszielen implizit auch immer schon den Anspruch, dass das von ihm Angestrebte und für wichtig Erachtete auch von den anderen geschätzt und als gut beurteilt werden sollte. Aufgrund der Angewiesenheit auf soziale Anerkennungsverhältnisse dürfte ein grundlegender Widerspruch zwischen einem persönlichen „Optimum“ oder „normativen Selbstbild“ zu den Menschenbildern und Wertvorstellungen im sozialen Umfeld dazu führen, dass das eigene Selbstwertgefühl mehr und mehr untergraben wird. Auf lange Sicht wird es niemanden glücklich machen, wenn er erfolgreich Selbstoptimierungs-Ziele verwirklicht, die von allen anderen Menschen als völlig wertlos eingestuft und verachtet werden (vgl. Fenner 2007, 65f.).
1.1.3 Enhancement
Der aus dem Englischen übernommene Neologismus „EnhancementEnhancement“ von „to enhance“: „Steigerung, Erhöhung“ wurde bereits in den 1990er Jahren in der Bioethik und der Technikfolgenabschätzung geprägt, als in verschiedenen Bereichen wie Humangenetik, Chirurgie und Pharmakologie neue wirkmächtige Technologien entwickelt wurden (vgl. Coenen u.a., 11). Zwar scheint beim „Enhancement“ anders als bei der „Optimierung“ die Vorstellung eines zu erreichenden „Optimums“ zu fehlen, aber wie gesehen meint auch Selbstoptimierung letztlich immer den Prozess einer schrittweisen Selbstverbesserung (1.1.1). Anders als die „Selbstoptimierung im weiten Sinn“ beschränkt sich das „Enhancement“ jedoch auf naturwissenschaftlich fundierte und technisch voraussetzungsvolle Methoden zur menschlichen Verbesserung, vornehmlich aus Medizin, Biochemie und den Neurowissenschaften. „Enhancement“ kann also mit der Selbstoptimierungenger/weiter BegriffSelbstoptimierung im engen Sinn gleichgesetzt werden und stellt eine Sonderform von Selbstoptimierung dar (vgl. Balandis u.a., 137/Röcke, 321f.). Gemäß der in der Bioethik geläufigen Begriffsbestimmung meint Enhancement im Allgemeinen bzw. das biomedizinische EnhancementEnhancementbiomedizinisches im Besonderen sämtliche Verbesserungen menschlicher Eigenschaften oder Fähigkeiten durch technologische bzw. biomedizinische Interventionen, die nicht dem Zweck einer Therapie von Krankheiten dienen, sondern über ein bestimmtes Maß an „Normalität“ oder „normalem Funktionieren“ eines Menschen hinausgehen (vgl. GesangGesang, Bernward, 4/HeilingerHeilinger, Jan-Christoph, 91f./Woyke, 21f.). Demgegenüber umfasst im alternativen Definitionsansatz der Transhumanisten (welfarist definition) „Enhancement“ alle biologischen oder psychischen Veränderungen, die zu einer Steigerung der Chancen auf ein gutes Leben der betreffenden Person führen (vgl. SavulescuSavulescu, Julian u.a., 7). Auch wenn bei dieser Betonung der allgemeinen normativen Bewertungshinsicht ohne Einschränkung der Mittel eine sehr weite Begriffsverwendung vorzuliegen scheint, setzen doch gerade Trans- und Posthumanisten auf neueste Technologien (Kap. 1.4). Im Gegensatz zur bioethischen Definition würden hingegen auch therapeutische Interventionen mit dem Resultat einer verbesserten Lebensqualität zu den Enhancement-Maßnahmen zählen, obwohl die deskriptive Abgrenzung von „Enhancement“ und „Therapie“ durchaus ethisch relevant ist (Kap. 1.3). Da sich diese Einführung auf neue technologische und insbesondere biomedizinische Verbesserungen konzentriert, kann für die thematische Gliederung die in der Enhancement-Debatte bereits gebräuchliche Einteilung in Körper-Enhancement (Kap. 3), Neuro-Enhancement (Kap. 4) und genetisches Enhancement (Kap. 5) verwendet werden.
1.2 Kulturelle Voraussetzungen und Ambivalenz des Selbstoptimierungstrends
1.2.1 Kulturelle Voraussetzungen
Individualisierung
Ideengeschichtlich betrachtet lässt sich der Trend zur Selbstoptimierung als konsequente und logische Fortsetzung verschiedener neuzeitlicher IndividualisierungsschübeIndividualisierungsprozesse verstehen: Auf gesellschaftlicher Ebene verloren traditionelle Sozialzusammenhänge wie Verwandtschaft, Nachbarschaft oder Religionsgemeinschaft immer mehr an Bindungskraft. Zu den großen sozialen und geistesgeschichtlichen Umbrüchen auf diesem Weg zählen die Reformation und die Glaubenskriege mit dem Zerbröckeln eines einheitlichen, stabilen Orientierungssystems, der besonders im Calvinismus geförderte, mit erhöhter Selbstbeobachtung und Selbstdisziplinierung verbundene religiöse Individualismus, die Idealisierung der Innerlichkeit in der Romantik und der drastische Rückgang der religiösen Sozialisierung seit den 1960er Jahren in Europa (vgl. LeefmannLeefmann, Jon, 102). Auf individueller Ebene hat sich in der Aufklärung das in der Renaissance aufkommende Selbstverständnis eines einzigartigen und autonomenAutonomie, s. Freiheit, Willens- Subjekts durchgesetzt, das sich mittels seiner subjektiven Rationalität sein eigenes Gesetz gibt. Dank des Siegeszugs der sich aus ihrem metaphysischen und religiösen Korsett befreienden Naturwissenschaften und der Technik macht sich der neuzeitliche Mensch die äußere Wirklichkeit verfügbar, um seine eigenen Bedürfnisse zu stillen. Unter Zurückweisung vorgegebener traditioneller Rollenbilder und Lebensmuster orientieren sich die Menschen zunehmend an selbst gesetzten Zielen, sodass in den 1960er Jahren ein Wertewandel weg von Pflicht- und Akzeptanzwerten hin zu ästhetischen und Selbstentfaltungswerten diagnostiziert wurde (vgl. Fenner 2003, 467). Auf wirtschaftlicher Ebene wurde die Individualisierung durch eine liberalistische Ökonomie und eine kapitalistische Kultur mit dem Prinzip des freien Marktes begünstigt, in der das individuelle Streben nach Gewinn und dem maximalen Erfüllen der subjektiven Wünsche den zentralen Motor darstellt. Neben seinen zahlreichen negativen Seiten hat der Kapitalismus den meisten Menschen in den westlichen Wohlfahrtsstaaten infolge des Wirtschaftswachstums einen hohen Lebensstandard, eine enormen Erweiterung der Lebensmöglichkeiten, mehr Freiheit, Flexibilität und Mobilität gebracht. Nicht zuletzt auch dank mehr freier Zeit wurden damit die Bedingungen dafür geschaffen, dass die Menschen sich vermehrt mit sich selbst und ihrem Leben beschäftigen konnten. Der aus der Soziologie stammende Begriff der IndividualisierungIndividualisierungsprozesse bezeichnet also den historischen Prozess eines Zugewinns an Autonomie und Wahlmöglichkeiten der Individuen, die sich aus fragwürdig gewordenen metaphysischen, religiösen und sozialen Ordnungssystemen und Strukturen herauslösen.
Je weniger der Einzelne von Gott, dem Schicksal oder der Tradition vorgegebene Aufgaben und Rollenmuster zu übernehmen gewillt ist, desto mehr rückt nun das eigene Selbst als einziger Orientierungspunkt in den Vordergrund und wird zur neuen Quelle von Normativität. Individuelle Selbstgestaltung und Lebensplanung gelten als die großen existentiellen Herausforderung des modernen Menschen, der alle Entscheidungen über Ausbildung, Beruf, Familie und Wohnort selbstreflexiv und selbstverantwortlich treffen und seinen individuellen Lebenslauf selbst entwerfen muss (vgl. Beck 2003, 216ff./SelkeSelke, Stefan 2014a, 188). Noch vor der Konjunktur des Schlagworts „Selbstoptimierung“ war in den 1970er und 80er Jahren der Begriff „SelbstverwirklichungSelbstverwirklichung“ für diese neue Innenorientierung in Mode gekommen, der gleichfalls eine Schlüsselkategorie des modernen Selbstverständnisses darstellt. Obgleich das Konzept der „Selbstverwirklichung“ von den deutschen Idealisten in die Philosophie eingeführt wurde, verhalf ihm erst die humanistische PsychologiePsychologiehumanistische in den 1970er Jahren zum Durchbruch. Selbstverwirklichung meint allgemein die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, indem man seine eigenen Möglichkeiten und Talente ungeachtet gesellschaftlicher Erwartungshaltungen ausschöpft. Dabei hat auch die Vorstellung von „Selbstverwirklichung“ eine Individualisierung erfahren, da grundsätzlich zwei Deutungsmöglichkeiten offen stehen (vgl. Fenner 2007, 92): Im essentialistischen capacity-fulfillment-ModellSelbstverwirklichungcapacity-fulfillment-Modell wird von einem bereits vorgegebenen metaphysischen oder biologisch angeborenen „Selbst“ ausgegangen, das lediglich in der Welt realisiert werden muss. Dieses von vielen humanistischen Psychologen von Goldstein über Fromm bis Maslow vertretene Entfaltungsmodell der Selbstverwirklichung wird gern mit der Analogie zum Wachstum eines Samenkorns illustriert, bei der allerdings die zentrale Rolle von Vernunft, Erziehung und Bildung in der menschlichen Entwicklung unterschätzt wird. Denn die genetischen Anlagen und Fähigkeiten sind beim Menschen so unbestimmt, dass sie zu höchst unterschiedlichen positiven oder negativen Zwecken einsetzbar sind (vgl. dazu Fenner 2003, 372; 472f.). Aufgrund dieser zweifelhaften Prämissen dominiert heute das individualistische aspiration-fulfillment-ModellSelbstverwirklichungaspiration-fulfillment-Modell, bei dem die Freiheit der Individuen viel stärker betont wird. Es gilt dann nicht ein vorgegebenes „Selbst“ zu realisieren, sondern die wichtigsten Wünsche oder Ziele eines Individuums (vgl. KipkeKipke, Roland 2011, 82f.; 209).
Subjektivierung und Psychologisierung des Glücks
Dieser vielschichtige Prozess der Individualisierung und die Suche nach neuen innerlichen Quellen normativer Handlungsorientierung haben zu einer Renaissance der antiken IndividualethikEthikIndividual-, Strebens- geführt: Nachdem Themen der individuellen Lebensführung wie die Frage nach dem Glück und guten Leben sowohl in der Philosophie als auch in der Öffentlichkeit jahrhundertelang zugunsten moralischer Belange vernachlässigt wurden, genießen sie seit den 1970er Jahren erneut hohe Aufmerksamkeit (vgl. Fenner 2007, 7). Die Dominanz der Fremdorientierung und des Ideals der Selbstlosigkeit war gebrochen, sodass Selbstorientierung und Selbstsorge nicht länger als egoistisch verpönt waren. Während allerdings in Antike und Mittelalter von objektiven Kriterien für menschliches Glück ausgegangen wurde, hat im Laufe der neuzeitlichen IndividualisierungsprozesseIndividualisierungsprozesse eine GlückSubjektivierung/Psychologisierung desSubjektivierung und Individualisierung des Glücks stattgefunden: Das Individuum soll keine vorgegebenen Aufgaben mehr im Kosmos oder einem göttlichen Schöpfungsplan erfüllen, sondern seine ganz persönlichen Wünsche und Ziele realisieren und sein Glück in der Selbstverwirklichung finden (vgl. Höffe, 19/KipkeKipke, Roland 2011, 209f.). Im Zeichen eines anhaltenden „Glücksbooms“ wird der Büchermarkt überschwemmt von einer Fülle populärwissenschaftlicher, spiritueller bis hin zu kabarettistischer Ratgeberliteratur, die zusammen mit Feuilletonbeiträgen und Blogs den Weg zum GlückGlück weisen. Es wird im Sinne des typisch neuzeitlichen Macht- und Machbarkeitsdenkens suggeriert, das Glück sei planbar und herstellbar und jeder könne sein eigenes Glück „schaffen oder aufbauen“ (Lyubomirksy, 24). In ihrer schlichtesten Form bietet die Lebenshilfeliteratur Anleitungen zum Selbermachen und gibt einfache Rezepte, wie man sein Leben zu einem glücklichen machen kann. So soll man etwa „Krisen als Chancen“ betrachten und widrige Umstände positiv deuten, „achtsam“ oder „authentisch“ leben, sich selbstgewählte Ziele setzen und sich selbst optimieren. Je aufdringlicher die Werbeindustrie den Menschen Glück durch den Erwerb bestimmter Güter oder die Nutzung spezifischer Dienstleistungsangebote verspricht, scheint das Glück selbst zur Pflicht erhoben zu werden. Kritische Zeitgenossen sprechen angesichts der omnipräsenten Glücksverheißungen von einer „Diktatur des Glücks“ und einer „Glückshysterie“, weil jedem eingeimpft wird: „Du musst glücklich sein, sonst lohnt sich dein Leben gar nicht“ (SchmidSchmid, Wilhelm 2012, 8). Das intensivierte Glücksstreben und die Betrachtung des individuellen Glücks als Indiz für eine gelingende Selbstverwirklichung und Lebensführung haben dem Selbstoptimierungstrend den Weg bereitet und ihn angekurbelt.
Nachdem in der Antike vornehmlich die Philosophie für Fragen der Lebenskunst und des Glücks der Einzelnen zuständig war, scheinen sie aber seit ihrer Renaissance in den Zuständigkeitsbereich der Psychologie gerückt zu sein: Von einer Therapeutisierung oder Psychologisierung des GlücksGlückSubjektivierung/Psychologisierung des lässt sich insofern sprechen, als sich immer häufiger Psychologen und Psychotherapeuten für Experten menschlichen Glücks erklären und Unterstützung bei einer gelingenden Selbstverwirklichung bieten. In den 1970er Jahren kam es zu einem allgemeinen „Psycho-Boom“, weil das Interesse der Bevölkerung an einer im weitesten Sinn verstandenen Therapie als sozialer Praxis wuchs und sich immer mehr Zeitungen, Zeitschriften und Ratgeber therapeutischer Konzepte bedienten (vgl. Elberfeld, 176). Einen Beitrag zur Popularisierung der Psychologie leistete auch die 1990 gegründete Positive PsychologiePsychologiepositive, die nach der ausschließlichen Beschäftigung der Psychologie mit psychischen Krankheiten bzw. Störungen die Steigerung der psychischen Gesundheit und positiver Gefühle wie Glück zum Programm erhob (vgl. Seligman, 11). Neben die psychologischen Therapie- und Beratungsangebote trat seit den 1980er Jahren das Coaching, das verschiedene Trainings- und Beratungsmethoden umfasst. Ursprünglich aus dem Sport stammend wurde das Coaching zunächst auf das Training von Führungskräften übertragen und später auf individuelle Beratung aller Menschen ausgedehnt, sodass aus dem Management-Coaching Anleitungen zum Selbstmanagement wurden (vgl. Eberfeld, 189ff.): Coaches helfen den Kunden, ihre persönlichen Potentiale, Stärken und Perspektiven besser einzuschätzen und zu entwickeln, neue Kompetenzen und Strategien zur besseren Bewältigung von Krisen zu erwerben und sich adäquater und erfolgreicher an ihren persönlichen Zielen zu orientieren. Während es beim SelbstmanagementSelbstmanagement in den frühen Phasen vorwiegend um die Steigerung der Arbeitsproduktivität mittels Zeitplanung und To-do-Listen ging, rückte mit jeder Generation mehr die Verbesserung der Lebensqualität mit Zielen wie etwa persönliches Wachstum, Erarbeiten inspirierender Zukunftsperspektiven und befriedigender Beziehungen zu anderen ins Zentrum. Ähnlich wird im Glücks-Coaching typischerweise die Stärkung des Selbstwertgefühls und Selbstvertrauens, mehr Freude in Beruf und Partnerschaft, Gelassenheit und Kreativität im Umgang mit Um- und Mitwelt versprochen. Je populärer die sich auf psychologisches Wissen beziehenden Programme zum Überschreiten des Gesunden und Normalen auf Selbstoptimierung hin werden, desto mehr avancieren therapeutische Praktiken zu „universell einsetzbaren Technologien des Selbst“ (Elberfeld, 194).
1.2.2 Ambivalenz des Selbstoptimierungstrends
1) Positive Aspekte
Das Programm des Selbstoptimierungstrends erscheint als ein grundsätzlich positivesSelbstoptimierungpositive Aspekte, da es zu einem positiven Denken, einem optimistischen Selbstverhältnis und einer auf Verbesserungen abzielenden, aktiven Lebensführung auffordert. Die Kernbotschaft lautet, dass jeder jederzeit unliebsame schädliche Gewohnheiten und Einstellungsweisen verändern, sein Schicksal in die eigene Hand nehmen und etwas für seine Gesundheit und sein Glück tun kann. Es geht bei diesem neuen gesellschaftlichen Leitbild nicht wie in vergangenen Jahrhunderten vorwiegend um den Kampf gegen Entbehrung, Leid und Krankheit, sondern um positive Zielvorstellungen wie Gesundheit, Kreativität, Produktivität und Zufriedenheit. Die allgegenwärtige Motivation zur Arbeit am eigenen Selbst und am eigenen Glück durch sukzessives Feilen an der persönlichen Lebensgestaltung fördert aus Sicht der Befürworter die individuelle Freiheit und Verantwortung der Einzelnen und bestenfalls auch ihr Wohlergehen (vgl. DuttweilerDuttweiler, Stefanie, 8). Im gegenwärtigen Streben nach individueller Selbstverbesserung komme das moderne Ideal persönlicher AutonomieAutonomie, s. Freiheit, Willens- oder Selbstbestimmung zum Ausdruck, das in der gegenwärtigen westlichen Gesellschaft als oberster Wert gilt (vgl. GammGamm, Gerhard, 47ff.): Der Einzelne versteht sich nicht mehr als Opfer der Verhältnisse und muss nicht religiöse oder traditionelle Aufgaben erfüllen, sondern tritt als selbstbewusster Autor seiner selbst und seines Lebens in Erscheinung und führt die Eigenregie bei seiner Selbstdarstellung. Während für vergangene Generationen selbstverständlich war, dass Frauen Kinder großziehen und den Haushalt führen und Männer den Beruf ihres Vaters erlernen und den väterlichen Betrieb oder Hof übernehmen, kann heute jeder zwischen schier unüberblickbaren Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten das für ihn Passende auswählen. Dank des hohen Lebensstandards steht nicht mehr die Befriedigung der materiellen Bedürfnisse im Zentrum, sondern die Suche nach einem eigenen Lebensstil hinsichtlich Bildung, Freizeitaktivitäten, Ernährung und Umgang mit dem eigenen Körper (vgl. Schimank, 2). Anstelle der ehemaligen Stände oder gesellschaftlichen Milieus hat sich eine Vielfalt von Lebensstil-Szenen zu verschiedenen Möglichkeiten der Selbst- und Lebensgestaltung ausdifferenziert, so z.B. der „Lifestyle of health and sustainability“ (LOHASLOHAS). Aus dieser Perspektive steht also das moderne Projekt der Selbstverwirklichung und SelbstoptimierungSelbstoptimierungpositive Aspekte für den Übergang von einer autoritätsgläubigen unterwürfigen Persönlichkeit zu einem emanzipierten autonomen Subjekt, der als Befreiungsschlag und höchst positive Errungenschaft bewertet wird.
Aus kritischer Distanz erscheint der hinter dem Selbstoptimierungs-Trend stehende IndividualismusIndividualisierungsprozesse und LiberalismusLiberalismus allerdings oft als einseitig und realitätsfremd. Denn Anleitungen zur Selbstoptimierung und populäre Glücksratgeber suggerieren mitunter, ein erfolgreiches und glückliches Leben sei nur das Resultat der Arbeit am eigenen Selbst oder gar von Autosuggestion (vgl. Hirschhausen, 154/Lyubomirsky, 16). Genährt werden unter Umständen sogar trügerische Omnipotenzphantasien, mit mehr Eigenaktivität, Selbstwirksamkeit und Resilienz alle äußeren Hindernisse überwinden zu können (vgl. dazu UhlendorfUhlendorf, Niels u.a., 35). Kritiker der IndividualisierungSelbstoptimierungnegative Aspekte und Psychologisierung des Glücks bezeichnen es als „kollektive Selbsttäuschung“, dass jeder Mensch als ein freies, gestaltungsfähiges Individuum allein mit den richtigen Einstellungen und Taten sein Glück in der Welt schmieden könne (vgl. Hampe, 56). Denn unbestreitbar findet er zum einen eng gezogene individuelle biologische Grenzen vor, weil auch mit Schönheitsoperationen Alterungsprozesse lediglich verzögert und ein fehlendes Bewegungstalent oder ein niedriger IQ durch Training oder Enhancement nicht kompensiert werden können. Zum anderen wird ein Mensch nach wie vor hineingeboren in bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse mit gewissen Ressourcen und Beschränkungen und kann jederzeit Opfer von Naturkatastrophen oder Gewalttaten werden. Angesichts dessen mutet die positiv-anspornend gemeinte individualistische Lesart des Sprichworts „Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied“ naiv an, jeder brauche nur positiv zu denken oder an seiner persönlichen Lebensgestaltung zu arbeiten. Das Pochen auf den Zugewinn an Chancen und Möglichkeiten dank des modernen IndividualismusIndividualisierungsprozesse und LiberalismusLiberalismus wird dann sozialethisch bedenklich, wenn es zur Verweigerung einer Auseinandersetzung mit den bestehenden sozialen, politischen und ökonomischen Verhältnissen führt. Ein naiver Optimismus Optimismus, naiver/funktionalerist aber auch individualethisch problematisch, weil eine durchgängig positive Einstellung zum Leben und zur Zukunft zu einer Überschätzung der eigenen Kontrollfähigkeit und Kompetenzen führt und gegen berechtigte Kritik immunisiert. Damit kommen Optimisten aber die Voraussetzungen für ein „lernendes System“ abhanden, weil sie nicht aus Fehlern in der Vergangenheit lernen und Gefahren und Risiken rechtzeitig erkennen und verhindern können (vgl. dazu Schmied 2012, 44/Seligman, 73). Individualethisch günstig ist nur ein funktionaler Optimismus, bei dem Probleme nicht ausgeblendet, sondern als Herausforderungen betrachtet und stets die offen stehenden Chancen in den Fokus gerückt und voll ausgeschöpft werden (vgl. Fenner 2007, 134f.).
Zur Verteidigung des Programms der Selbstoptimierung wird gern auf die KontinuitätArgumenteKontinuitäts- verwiesen, mit der die Menschen seit Jahrtausenden auf Selbstverbesserung ausgerichtet sind. In der Tat waren die Menschen noch nie einfach zufrieden damit, wie sie waren, sondern versuchten sich und ihr Leben stets mittels physischer, psychischer und mentaler Anthropotechniken zu verbessern (vgl. Leuthold, 11/WiesingWiesing, Urban 2006, 324). Das Streben nach Höherem und Besserem scheint im Menschen angelegt zu sein und bildet sozusagen seinen Lebensmotor und den Antrieb zur kulturellen Weiterentwicklung. So lässt sich der Mensch anthropologisch als „homo modificanshomomodificans“ und „das sich optimierende und normierende Lebewesen“ bestimmen (StraubStraub, Jürgen u.a., 19). Allerdings haben sich die theoretischen Zielvorstellungen und praktischen Methoden im Laufe der Geschichte stark gewandelt, und die angestrebten oder erlangten Veränderungen erscheinen von außen nicht immer als „Verbesserungen“ (vgl. ebd.). Für die Menschen der Antike war das „OptimumOptimierung, Optimum“ in der teleologischen Ordnung der Natur vorgegeben, und alle Maßnahmen sollten nur das vollenden, was in der Natur angelegt ist (vgl. WiesingWiesing, Urban 2006, 324ff.). Dieser Vorstellung immanenter Zwecke in der Natur folgte im Mittelalter der Glaube an die vollkommene göttliche Schöpfungsordnung, wobei Abweichungen des Menschen von der gottgewollten Vollkommenheit als Resultat der Ursünde verstanden wurden. Sie sollten vorwiegend mit geistigen und religiösen Anstrengungen so weit wie möglich schon im Diesseits abgeschwächt werden, auch wenn das eigentliche „OptimumOptimierung, Optimum“ erst dank Gottes Gnade im Jenseits erreichbar war. Das Streben nach Perfektionierung gewann in der Aufklärung als umfassendes Denk- und Lebensmodell mächtigen Auftrieb, weil der Mensch einerseits als grundsätzlich veränderbares und erziehbares Wesen, andererseits zugleich als mangelhaft und verbesserungswürdig galt (vgl. Glockentöger u.a., 74f.). Es wurde in der Aufklärungsphilosophie geradezu als moralische Pflicht angesehen, seine leiblichen, seelischen und geistigen Kräfte zu vervollkommnen (vgl. KantKant, Immanuel, 55f./LenkLenk, Christian, 50f.). Im Laufe der Neuzeit verloren die Vorstellungen der Naturteleologie und einer göttlichen Ordnung immer mehr an Bedeutung, sodass sich die Eingriffsmöglichkeiten nicht länger vor traditionellen Orientierungsvorgaben legitimieren mussten. Mit dieser Entgrenzung der Möglichkeiten gingen aber die normativen Kriterien für die bahnbrechenden technischen und medizinischen Errungenschaften im 19. und 20. Jahrhundert wie etwa Mensch-Maschine-Verbindungen oder Gentechnik verloren, anhand derer sich „Verbesserungen“ und ein „Optimum“ des Menschen bestimmen lassen.
2) Negative Aspekte
Der enorme Zuwachs an Wahlmöglichkeiten und individueller Autonomie im Zuge der verschiedenen Individualisierungsschübe weist offenkundig auch SchattenseitenSelbstoptimierungnegative Aspekte auf wie die Zunahme an Entscheidungszumutungen und persönlicher Selbstverantwortung (vgl. Schimank, 3). Nachdem sichere normative Orientierungsstrukturen abhanden gekommen sind und es zu jeder Handlungsoption zahllose Alternativen gibt, quälen sich viele Menschen mit ständigen Selbstzweifeln: Hätte ich es nicht vielleicht anders machen sollen und hätte es nicht noch besser laufen können oder müssen? Das sich selbst optimierende „unternehmerische SelbstSelbstunternehmerisches“ scheint notwendig ein „unzulängliches Individuum“ zu sein, das nie mit sich selbst zufrieden ist, weil es stets hinter seinen eigenen Ansprüchen zurückbleibt (BröcklingBröckling, Ulrich, 289). Als „Tragödie des Erfolgs“ bezeichnet Leon KassKass, Leon, dass die Menschen trotz enormen wissenschaftlich-technischen Fortschritten z.B. in der Medizin nicht zufriedener mit ihrem Gesundheitszustand geworden sind (vgl. 133f.). Da das Streben nach Perfektion zu Intoleranz gegenüber Fehlern und dem Unvollkommenen führe, gelte das Paradox: „Je perfekter der Mensch werden will, desto unvollkommener wird er.“ (MaioMaio, Giovanni 2018, 251) Selbstoptimierungnegative AspekteWenn individuelle Unsicherheit und Selbstunzufriedenheit mit dem omnipräsenten gesellschaftlichen Appell zur Perfektionierung und Selbstverantwortung zusammentreffen, können sie sich leicht zu einem negativen Lebensgefühl verdichten und zu Erschöpfungszuständen führen. Das erschöpfte SelbstSelbsterschöpftes ist nach Alain EhrenbergEhrenberg, Alain ein ausgebranntes Selbst, das kaum mehr Orientierungsstrukturen und Regeln im Außen vorfindet, sondern sich flexibel und mobil an eine komplexe, sich ständig verändernde provisorische Welt anpassen und dabei alles selbst entscheiden und verantworten muss (vgl. EhrenbergEhrenberg, Alain, 141; 222; 277). Die in westlichen Ländern steigende Zahl von Burn-outBurnout-Vorkommnissen, Depressionen und Angststörungen wird in direkten Zusammenhang gebracht mit den gegenwärtigen Welt- und Selbstdeutungen mit ihren maßlosen Perfektionsidealen. In vielen Bestsellern wie etwa Ariadne von Schirachs Du sollst nicht funktionieren (2015) oder Arnold Retzers Miese Stimmung (2012) wird daher eine radikale Abkehr vom Optimierungswahn und dem Diktat des positiven Denkens gefordert, wohingegen Pessimismus und negative Gefühle aufzuwerten seien. Der Perfektionierungsthese wird von Philosophen wie Harry FrankfurtFrankfurt, Harry und Michael SloteSlote, Michael die Suffizienzthese entgegengesetzt, derzufolge eine Haltung der zufriedenen Selbstbescheidung und Mäßigung rationaler ist als eine unbegrenzte Optimierung der Lebenssituation (vgl. SloteSlote, Michael, 10/Knell, 368f.).