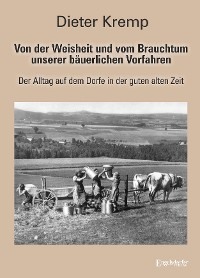Kitabı oku: «Von der Weisheit und vom Brauchtum unserer bäuerlichen Vorfahren», sayfa 2
Hausschlachtungen früher
Früher waren Hausschlachtungen ein fester Bestandteil des bäuerlichen Jahresablaufes. Traditionell waren November und Dezember die Monate der Schlachtfeste, um genügend Fleisch und Wurst für den Winter zu haben und weil die Lebensmittel in der kälteren Jahreszeit besser haltbar waren. Am Vortag wurden umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Man brauchte Töpfe, Schüsseln, Schürzen, Tücher, Gewürze und Kräuter. Auch die Leitern zum Aufhängen der Schlachthälften durften nicht fehlen.
Am Schlachttag selber wurden viele helfende Hände benötigt, denn Fleisch, Eingeweide und Blut mussten noch im warmen Zustand zu verschiedenen Wurstsorten verarbeitet werden. Leberwurst, Schwartenmagen, Presskopf und Blutwurst fehlten auf keiner Schlachtplatte. Es wurde Fett ausgelassen, eingesalzen, gepökelt und geräuchert. Im ganzen Dorf roch es nach Kesselfleisch und Wurstsuppe.
Nach getaner Arbeit standen die Schweinehälften senkrecht an Leitern gebunden zum Auskühlen an der Hauswand. Hing das Schwein an der Leiter, wurde nach alter Tradition eine Runde Korn ausgeschenkt. Alle Helfer wurden mit Naturalien in Form von Fleisch und Wurst vom frisch geschlachteten Schwein bezahlt.
Hatte man am Kalender einige günstige Tage für die Schlachtung ermittelt, wobei der nächste Neumond den Ausschlag gab, dann bestimmte der bestellte Hausschlachter den genauen Termin und die Stunde, wann alles bereit sein musste. In den Tagen um den Neumond herum durfte nicht geschlachtet werden, man wusste aus alter Erfahrung, dass sich dann das Dauerfleisch nicht gut hielt. Es musste morgens sehr früh geschlachtet werden, um viel Zeit zum Auskühlen zu gewinnen, denn noch am gleichen Tage abends erschien der Schlachter zum zweiten Male, um das Schwein zu zerlegen.
Zu den Vorbereitungen der Schlachtung gehörte es zunächst, dafür zu sorgen, dass das zu schlachtend e Schwein einen Tag lang vorher nicht gefüttert werden durfte, denn das erleichterte sehr die Schlachtarbeiten. Die Hausfrau und die Mägde hatten einen ganzen langen Tag Arbeit, um ordnungsgemäße Vorbereitungen zu treffen. Erfolgte das Schlachten in der Waschküche, so wurde diese zuerst geschrubbt, fehlte es aber an einem passenden Raum oder war die Temperatur im Hause zu warm, so machte man draußen im Hof eine Stelle sauber und bedeckte den Boden mit einer Schütte Roggenstroh als Unterlage beim Schlachten.
Ein Knecht musste dem Schlachter helfen. Er ergreift das Schwein am Sterz und hält es fest, bis der Schlachter den Strick um ein Hinterbein geschlungen hat, so haben die beiden das Schwein in der Gewalt und führen es an den Ort, an dem es geschlachtet wird.
Über die Tötungen gab es ganz früher keine Bestimmungen. Das Schwein wurde auf eine Seite gelegt, Knechte und Schlachter knieten sich darauf, und dann machte der Schlachter mit seinem langen Messer einen Schnitt in die Kehle und durch die Drossel, eine Magd fing das ausströmende Blut mit einer Pfanne auf und schüttete es in einen Topf, in dem es mit einem langstieligen hölzernen Löffel so lange gerührt wurde, bis das Schwein ganz ausgeblutet war. Das Rühren erfolgte deshalb, um Klumpenbildung im Blut zu verhindern. Während der ganzen Prozedur des Schlachtens schrie das Schwein ganz unbändig laut, dass man es weithin hören konnte.
Am späten Abend setzte der Schlachter seine Arbeit fort. Ein Hauklotz auf drei Beinen, ein großer Tisch und eine Reihe großer Töpfe standen in der Waschküche bereit. Die Hausfrau gab nun dem Schlachter Anweisung, wie die Zerteilung erfolgen sollte. Die großen Stücke wie Beine und Speckseiten wurden im Keller im Pökelfass eingesalzen, Rippen-, Nacken- und Bratenstücke wurden zunächst auf dem Fleischboden zum Trocknen einige Tage aufgehängt, dann eingekocht.
Alle Mettwürste und alle im großen Kupferkessel gekochten Leber- und Blutwürste wurden zunächst einige Tage zum Trocknen aufgehängt und dann in der stockdunklen Räucherkammer im Speicher geräuchert. Der Rauch des Backofens wurde zu dieser Zeit dann durch die Räucherkammer geleitet. Manche Stücke blieben hier monatelang hängen, bis sie zum Verbrauch heruntergeholt wurden. Nach zwei Wochen wurden auch die Schinken und die Speckseiten aus dem Pökelfass herausgeholt, abgewaschen, getrocknet und ebenfalls zum Räuchern in der Räucherkammer aufgehängt.
Wie Großmutter noch Sauerkraut einlegte
„Eben geht mit einem Teller
Witwe Bolte in den Keller,
Dass sie von dem Sauer’kohle
Eine Portion sich hole,
Wofür sie besonders schwärmt,
Wenn er wieder aufgewärmt.“
Wie Wilhelm Buschs Darstellung zeigt, war Sauerkraut auch schon früher recht beliebt – und der Oktober mit der weißkrauternte bietet sich wie kein anderer Monat an, einige Portionen für den Eigenbedarf selbst herzustellen. Das Einsalzen von Sauerkraut ist nicht nur eine recht einfache und vergnügliche Arbeit für die private Vorratshaltung, sondern beschert dem winterlichen Küchenzettel eine gesunde Bereicherung.
Sauerkraut entsteht, weil Hefepilze und Milchsäurebakterien im Weißkohl eine Gärung bewirken. Sie wandelt den Großteil der vorhandenen Kohlenhydrate in Milchsäure um. Diese desinfiziert regelrecht den Darm, bekämpft Fäulnisvorgänge und wirkt im Körper ähnlich gesund wie Sauermilch und Joghurt. Dazu kommen noch die Vitamine des roh verzehrten Sauerkrauts- und seine bekannte Bedeutung als Schlankmacher oder Schlank-Erhalter. Am selbst eingelegten Sauerkraut wird besonders Großmutters „Hausmachergeschmack“ gerühmt: Durch kleine Veränderungen in der Würze und bei den Zutaten erhält jedes Kraut seinen unverwechselbaren Geschmack. Sauerkraut mit Kasseler und Bier - ein deftiger Schmaus, der den Deutschen den Spitznamen „die Krauts“ eingebracht hat, aber immer eine genussvolle Mahlzeit verspricht.
Die zum Einlegen von Sauerkraut bestimmten Steintöpfe werden gründlich gescheuert, mit heißem Wasser ausgespült und getrocknet. Feste, frische Weißkrautköpfe werden von der äußeren, unansehnlichen und losen Blättern befreit. Je nach Rezept werden die entsprechenden Zutaten hergerichtet, ein Leintuch wird in klarem Wasser ausgekocht und ein größerer Stein besorgt.
Einmachen: Die gesäuberten Weißkohlköpfe fein hobeln – auf 5 kg Weißkraut ca. 100 g Salz zugeben – das Kraut abwechselnd mit Salz in den vorbereiteten Steintopf stampfen ( mit der Hand, der Faust oder einem Holzstampfer lagenweise so fest einstampfen, dass der Saft jeweils über dem Kohl steht) – am Schluss alles mit dem Tuch abdecken, mit Brett und Stein beschweren – zugedeckt ca. 4 bis 6 Wochen an einem kühlen Ort gären lassen.
Hinweise für Veränderungen: 1. Möglichkeit: auf 5 kg Weißkraut ca. 1 Pfund geviertelte Äpfel oder Apfelscheiben einschichten (Apfelkraut).
2. Möglichkeit: Wacholderbeeren, Lorbeer- oder Weinblätter mit einschichten (Würzkraut). Hinweis: Manche bevorzugen es, Lorbeer und Wacholder erst beim Kochen dazuzugeben, wodurch der Würzgeschmack weniger intensiv wird.
3. Möglichkeit: Eine böhmische Variante für die Herstellung einer größeren Menge ist: Auf 50 Pfund Kraut 250 g Salz, 1 Päckchen Kümmel, 5 Pfund geschälte Zwiebeln mit in das Kraut hobeln; dazu 4 bis 5 Pfund geschälte, entkernte Äpfel in die Achtelstücken lagenweise einschichten (Böhmisches Kraut).
Kontrollen: Spätestens alle zwei Wochen Tuch, Brett und Stein sauber abspülen – falls die Salzlake im Winter das Kraut noch mehr bedeckt, erkaltete Salzlösung nachfüllen (10 g Salz pro Liter Wasser) – das Kraut möglichst nicht mit Metall-, sondern mit Holzgabeln oder Holzlöffeln aus dem Steintopf herausnehmen.
Als Großmutter noch den „Laxem“ rührte
Die Septemberkirmes war früher in meinem Heimatort die „Quetschekerb“: Drei Tage lang gab es „Quetschekuche“ (Zwetschgenkuchen). Und war die „Quetschekerb“ vorbei, dann rüstete man sich überall auf das „Quetschemuskoche“, das „Laxemriehre“. Es war schon eine Heidenarbeit für meinen Großvater, einige Zentner Zwetschgen „abzumachen“ oder vom Baum zu schütteln. Wir hatten eine „Wildnis“ auf dem „Wääleberg“ (Wääle = Heidelbeeren), die voller alten Zwetschgenbäume stand. Dort musste ich natürlich auch als kleiner Bub helfen.
Aber eine weitaus größere Arbeit war das „Auskäären“ (entsteinen) und das „Einschäle“. Da musste alles helfen, was Hände hatte. Da saßen am Abend bis tief in die Nacht hinein alle „Weibsleit“ im Hause auf den „Stühlchen“ und entsteinten die blauen Früchte. Großmutter war die „Chefin“. Aber da halfen auch die Tante und die „bas“ (Cousine), die „Goth“ (Patentante) und die Nachbarin. Da gingen die Hände sowie die Mäuler geschmiert und schnell. Da wurde getratscht und „lawadscht“, geplaudert und „gemait“. So ein paar Zentner Zwetschgen wollten entsteint, Körbe voller Birnen geschält sein. Denn was ist „Latschriehre“ („Laxemrühren“) ohne Witz und Scherz! Mein Großvater gab gerne einen Krug „Süßen“ oder „Bitzler“ aus, neuen „Biere- oder Traubenwein“ zum Besten. Da schaffte es sich noch einmal so leicht, wenn ein bisschen Humor die sonst langweilige Arbeit würzte.
Kaum waren die letzten Körbe van der Reihe, richtete Großmutter schon den Kupfer- oder Emailkessel her, sorgte für gutes Brennmaterial und einen guten „Rührer“. Da herrschte dann Hochbetrieb in der „Worschdkich“ (Wurstküche) oder in der „Wäschkich“ (Waschküche). Die Luft war geschwängert vom Dunst und Musgeruch. Da brotzelte es Tag und Nacht. 24 bis 48 Stunden dauerte die Arbeit des Einkochens. Da musste die brodelnde Masse dauernd gerührt werden, damit das Mus nicht anbrannte. Hier zeigte sich die gute Nachbarschaft, die alte Dorfgemeinschaft allzeit hilfsbereit. Etwas Gutes zu essen und zu trinken gab es, Bohnen- oder Zichorienkaffee und Zwetschgenkuchen gehörte dazu.
In fein gesäuberte und gesüßte „steinerne Hawe“ (Töpfe) wurde der Laxem nun eingetopft und sorgsam verschlossen. Jede Hausfrau hatte eine „Spezialität“ beim Einkochen. Meine Großmutter nahm recht viel Gewürze, Nelken und Ingwer, meine „Tilchegoth“ Mathilde vermengte die Zwetschgen mit Nüssen oder Holunder, die „Annagoth“ mit recht vielen Mostbirnen.
Wir Kinder bekamen am nächsten Morgen eine große „Laxemschmeer“ mit zur Schule. Nach der Pause hatten die meisten einen saftigen braunen „Schnorres“ (Schnurrbart). Die größte Freude der Kinder aber war dann das Auslecken der geleerten Latwergkessel. Da pappten Gesicht und Hände von der süßen „Schmeer“ (Mus, Marmelade).
Laxem heißt auch „Latwerg“ oder „Latwerich“. „Latwerg“ ist eigentlich ein eingedickter Heilsaft, der „geleckt“ wurde. So wurde der „Huf-Lattich“ als Brustsirup eingedickt und „geleckt“.
Als es noch Eichelkaffee und Bucheckerferien gab
Zwei uralte Rezepte, die bei den Großmüttern im Herbst auf dem Küchenplan standen, waren Apfelringe und Eichelkaffee. Die Äpfel wurden in Scheiben geschnitten, die auf einem Backblech ausgelegt und im Backrohr bei niedrigster Wärme leicht angetrocknet wurden. Jetzt wurden die Apfelringe einzeln an einem langen Faden aufgereiht und an der Luft zum Trocknen aufgehängt. Aber nicht in der prallen Sonne! das zerstörte Geschmack und Vitamine. Die getrockneten Apfelringe wurden in Papiertüten verpackt und für den Winter im Vorratsschrank aufbewahrt. Unsere Vorfahren nutzten alles, was die Natur im Herbst hervorbrachte. Selbst die Baumfrüchte des Waldes waren gefragt: Eicheln, Buchecker, Haselnüsse, Hagebutten und Kastanien.
Nur noch den Ältesten ist der Eichelkaffee bekannt. Die Eicheln wurden geschält, das Fruchtinnere klein geschnitten. Es wurde in einer Pfanne ohne Fett braun geröstet. Es durfte nicht anbrennen oder sogar schwarz werden. Die braun gerösteten Teile wurden in einem Mörser zu Pulver zerstoßen. Auf eine Tasse Kaffee kam ein gestrichener Teelöffel Eichelpulver. Kurz aufgekocht, abgeseiht, mit Zimt etwas gewürzt und mit Milch gemischt, war Eichelkaffee ein beliebtes Getränk auf dem Land.
Mein Großvater Ludwig erzählte mir noch von den Schweinehirten auf dem Dorf, die im Spätherbst zur Zeit der Eichelmast die Schweine in den Eichenwald trieben und dort wochenlang hüteten. Eichelmast war wohl das beliebteste Futter für die Schweine.
Aus Rosskastanien stellten unsere Vorfahren Mehl her. Kastanien schmecken bekanntermaßen recht bitter. Und so trieben unsere Vorfahren die Bitterstoffe aus den Rosskastanien heraus: In einem Feuer stark erhitzte Steine wurden in ein Erdloch gelegt. Da hinein schüttete man die Kastanien und deckte sie mit heißer Asche zu. Nach einem Tag waren die Kastanien gegart und wurden mit einem Stein zerstampft. Der Mehlbrei kam in einen engmaschigen Korb, der in einen klaren Bach gestellt wurde. Zwei Tage lang floss das Wasser durch den Korb. Dann wurde das Mehl ausgedrückt. Auch ein Klebstoff steckt in den Kastanien. Buchbinder und Tapezierer haben früher einmal daraus Leim hergestellt. Aus den geschälten Kastanien hat man sogar Seife gewonnen.
Im Krieg und in den Hungerjahren danach hat man sackweise Bucheckern gesammelt. Es gab damals sogar Bucheckerferien, damit Mutter und Kinder gemeinsam die ölhaltigen Früchte sammeln konnten. Buchecker schmecken gut, doch sollte man nicht zu viele davon knabbern. Vorsicht ist geboten, denn roh enthalten sie den giftigen Inhaltsstoff Fagin. Meine Mutter und ich schleppten den vollen Sack mit den Bucheckern zur benachbarten Ölmühle nach Fürth im Ostertal, wo Öl daraus gepresst wurde. Aus 100 Kilogramm Bucheckern gewann man 12 Liter Speiseöl. Das Öl ist nach dem Erhitzen frei von giftigen Stoffen. Meine Mutter hat sich immer übe r den Ölmüller beschwert: „Wir wurden mal wieder beschess („geneppt“).“ So war es wohl auch.
Im Krieg und in den beiden Hungerjahren danach gab es auf dem Dorf auch Kartoffelferien. Zusammen mit den Eltern und Großeltern mussten dann die Kinder bei der Kartoffelernte helfen.
Wenn die Zeit eilt
Die Jahre drehen sich im Kreise,
die Zeit pocht leise.
Immer schneller wird der Schritt,
der ins Alter tritt.
Das Rad der Zeit steht nie still,
weil Gott es so will.
Es dreht sich
unaufhörlich.
Die Uhr tickt,
das Leben strickt
seine irdischen Fäden.
Spinnen gehen auf die Reise
im Herbst des Lebens.
Doch der Winter kommt ganz leise,
unaufhaltsam, nicht vergebens.
Dreifach ist der Schritt der Zeit:
Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen,
zögernd kommt die Zukunft angezogen,
ewig still steht die Vergangenheit:
Herr, es ist Zeit!
Falten, wie Jahresringe im Gesicht,
walten
über das Leben.
Die Zeit ist reif:
Jetzt ist es Pflicht,
eine Antwort zu geben,
denn langsam werden die Hände steif.
Je älter wir werden, um so stärker tauchen die Erinnerungen an unsere Kindheit in uns auf. Und oft schwelgen wir in längst vergangenen Zeiten – und unstillbare Wehmut lässt uns Tränen vergießen.
Spinn- und Strickabende unserer Vorfahren
Dornröschen fiel in einen hundertjährigen Schlaf, nachdem es sich mit der vergifteten Spindel gestochen hatte. „Was ist eine Spindel?“, würde heutzutage ein Kind fragen, dem man das Märchen vom Dornröschen erzählt.
In den Märchen spinnen die Königstöchter, in den Sagen die Göttinnen. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gehörte das selbstgesponnene und selbstgewebte Leinen zum hochgeachteten Aussteuerschatz.
Spinn- und Strickabende gehören der Vergangenheit an. Erinnerungen an Spinnstuben und Bratäpfel werden wach. Die Bratäpfel brutzelten auf der heißen Ofenplatte. Aus der schwarzgebrannten Schale tropfte dicker, brauner Saft. Süßer Duft erfüllte den Raum.
Spinnen und Stricken waren die wichtigsten Winterarbeiten der Frauen. Zum ersten Spinnabend traf man sich in der Regel am letzten Donnerstag im November. Das konnte der Katharinentag sein. Die heilige Katharina ist die Patronin der Spinnerinnen.
In manchen Orten war es eine bestimmte Bäuerin, die die Spinnstube abhielt. In anderen Gemeinden wanderten die Spinnerinnen von einem Haus zum anderen. Man sparte in den Dörfern. Kerzen waren teuer, und auch das Petroleum war ein Luxus. Aber wenn man sich abwechselnd in einer Stube zum Spinnen, Singen und Spielen traf, dann konnte man in allen anderen das Licht sparen. Oft bildeten die Mädchen und Frauen der verschiedenen Jahrgänge Spinngruppen, die über die Winterarbeit hinaus zusammenhielten.
Die Spinnstube war auch eine „Erzählstube“. Beim Spinnen des Garns und beim Stricken der dicken Winterstrümpfe erzählten die Frauen Geschichten, Märchen und Sagen und tauschten Neuigkeiten aus. Spinnstubenlieder wurden gesungen.
Meist trafen sich die Frauen am Nachmittag. Sie brachten Spinnrad, Flachs und Netzetopf mit, ein Wassergefäß zum Benetzen der Finger. Sie tranken zuerst Kaffee und aßen Kuchen, spannen dann bis zur Dämmerung. Zu Hause wurden dann Kinder und Vieh versorgt. Mit den Männern kehrten sie in die Spinnstube zurück. Wurst und Brot, Branntwein oder Bier standen als Spätimbiss bereit.
Junge Mädchen schwärmten in den Arbeitspausen auch gern aus, hielten heimlich Umschau nach ihrem Liebsten. Die jungen Burschen durften erst später kommen, brachten Dörrobst und gebackene Süßigkeiten mit.
In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Spinnabende nach und nach zu reinen Strickabenden. Warme Pullover, Socken und Strümpfe für den Winter wurden gestrickt.
Was aber hat der alte Bauernspruch „Spinne am Morgen, Kummer und Sorgen. Spinne am Abend, erquickend und labend“ mit der Spinne zu tun? Die Spinne kann gar nichts dafür, dass man ihr solche Sachen nachsagt. Die Bauern meinten einst, wer schon am frühen Morgen mit Flachs – oder Leinspinnen anfangen müsse, der habe Kummer und Sorgen, die es mit den Einnahmen aus dieser Arbeit zu bannen gelte. Am Abend zu spinnen bedeutete aber, dass man es sich gemütlich machen konnte, dass die Spinnerei eigentlich keine Arbeit, keine auf dringenden Gelderwerb gerichtete Beschäftigung war, sondern eine liebevolle Unterhaltung und Entspannung. Man konnte Sorgen und Kummer vergessen, Lieder singen, sich necken und vielleicht spann sich sogar manche Liebe an.
Nostalgische Erinnerungen an die „gute, alte Zeit“! Kommt sie wieder? Auf jeden Fall ist Stricken wieder zur Mode geworden.
Als es noch Eisblumen am Fenster gab
Wie sich die Zeiten geändert haben! Damals gab es noch keine Zentralheizung. Der Kohleofen brannte in der Küche und in der „gudd Stubb“, wenn Festtage waren. Dann wurde auch mit Scheitholz geschürt. Wenn wir Kinder morgens aufstanden, ging der erste Blick auf die Fenster, um die Eisblumen zu bewundern. Wenn es draußen bitter kalt war, offenbarte sich eine Wunderwelt am Fenster.
Eisblumen am Fenster! Welche Illusionen werden in dem stillen Beschauer geweckt! Er unternimmt eine Traumreise in eine ferne fremdländische Landschaft oder in einen längst versunkenen Urwald aus der Steinkohlenzeit. Vor seinen Augen verschwimmen die zarten Eis- und Schneekristalle. Die mit allerlei Formen und Mustern grauweiß überspielte kalte Glasfläche wird für Minuten zu einem Märchenwald aus Tausendundeiner Nacht. Seltsame Bäume und Sträucher mit bizarren Ästen und knöchernen Zweigen, schwert- und lanzenförmigen Schachtelhalmen, geöffneten Elchblättern, lilienschlanken Blumen in verschiedener Größe und Vielfalt, längst ausgestorbene gefiederte Farnkräuter – und zwischen den wiegenden Lianen sitzen Papageien mit eckigen Schnäbeln: Ein tropisches Bild mitten im Winter, von klirrendem Frost wie von einer künstlerischen Zauberhand auf die Fensterscheiben gemalt.
Und am schönsten ist es abends, wenn das gedämpfte Kerzenlicht warm durch die Fenster in die dunkle Kälte strahlt. Da werden sie lebendig, all die Blumen und Gestalten und tanzen in magischen Spiralen Ringelreihen.
Eisblumen am Fenster
Zarte Kristalle am Fenster schwimmen
in spielenden Mustern grau und weiß.
Bizarre Äste und Zweige klimmen
und lilienschlanke Blumen aus Eis.
Auf wogenden Lianen sitzen Papageien
und tanzen in Spiralen Ringelreihen.
Ein Märchenwald aus Tausendundeiner Nacht
verzaubert die Scheibe in tropischer Pracht.
Mitten im Winter bei klirrender Kält
sich öffnet eine wundersame Welt.
Bei gedämpften Kerzenlicht
schwingt eine Symphonie in Weiß.
Doch ach, die Dunkelheit das Glas zerbricht,
all die Blumen in Frost und Eis!