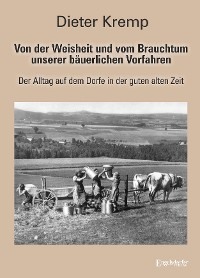Kitabı oku: «Von der Weisheit und vom Brauchtum unserer bäuerlichen Vorfahren», sayfa 5
Vom „Strohpatt“ und der „Binsegoth“
In unserem Dorf wurde das neugeborene Kind innerhalb acht Tagen getauft. Bis zu diesem Tage war es ein „Hädekend“ (Heidenkind). Je nachdem, ob es ein Bub oder ein Mädchen war, erhielt es früher den Vornamen des Vaters oder der Mutter. Waren schon Kinder in der Ehe vorhanden, so wählte man gern die Vornamen der Paten. Pate und Patin (Patt und Goth) wurden, wenn irgend angängig, der näheren Verwandtschaft entnommen. Die Frau des Paten war die „Binsegoth“, der Mann der Patin der „Binsepatt“. Pate und Patin zu werden, wurde als besondere Ehre empfunden, die aber auch zu Patengeschenken verpflichtete. Ein solches Geschenk, Zuckersteine oder auch Bargeld, erhielten vor allen Dingen der taufende Pfarrer und die Hebamme. Auch pflegten Pate und Patin an die vor der Kirche schon sehnsüchtig wartenden Kinder Zuckersteine auszuteilen. Bis zur Konfirmation waren Pate und Patin verpflichtet, ihre Patenkinder am Neujahrstag und an Ostern zu beschenken. In der Regel hatte früher ein Kind drei Paten. Diese wurden an Ostern und an Neujahr reihum aufgesucht. Die Pflicht der Paten war es auch, den Wein zu bezahlen, der bei der Kindtauffeier getrunken wurde. Zeigte sich der Pate knauserig, so wurde er zeitlebens den Namen „Strohpatt“ nicht mehr los.
Uralte Wiegenlieder wurden dem Kleinkind von der Mutter gesungen:
„Schlaf, Kindchen, schlaf!
Dein „Babbe“ hüt die Schaf.
Dein „Modder“ hüt die Lämmercher,
in den dunkeln Kämmercher,
schlaf, Kindchen, schlaf“
Oder die Großmutter sang:
„Guten Abend, gute Nacht,
mit Rosen bedacht,
mit Näglein besteckt,
schlupf unter die Deck.
Morgen früh, wenn Gott will,
wirst du wieder geweckt.“
Bei Krankheiten glaubte meine Urgroßmutter noch an einen Erfolg durch „gesundbeten“. Die „Gesundbetersch“ sollte durch „Sympathie“ heilen. Brave Kleinkinder wurden auf dem Schoß der Mutter reiten gelehrt. Dazu sang man:
„Reite, reite Rösschen!
Dort oben steht ein Schlösschen;
Da unten steht ein Glockenhaus,
da gucken drei schöne Jungfern raus!“
Aus meiner Kinderzeit kann ich mich auch noch an ein Neckliedchen erinnern:
„Miller, Miller, Maler
hatt de Sack voll Daler,
hat de Sack voll Haselness
Miller, miller, Maler!“
Oder es hieß:
Miller, Miller, Maler
Hatt de Sack voll Daler.
Miller, Miller, Plaschderschess,
die Dieter hat en die Hos geschesss.“
Den weinerlichen und ungehorsamen Kindern drohte man: „Pass off, der ewig Judd kommt und steckt dich en de Sack!“ Oder „Der schwarze Mann kommt und holt dich mit!“ oder „Der Bautz kommt!“ In der Zeit vor dem ersten Schulgange ängstigte man unverständigerweise das Kind mit den Worten: „Du musst noch in die glühend Kett beiße.“ In die Schule nahmen wir dann die „Greffelbichs“ (Griffelbüchse) und die „Lai“ (Schiefertafel) mit. Wenn der Saft im Frühjahr wieder in die Sträucher stieg, stellten wir Jungen uns Blasinstrumente aus der Rinde von Haseln und Weiden her: „Schalmeien, Huppen oder Hippen, Pfeifen, Tuten oder Tratschen. Kam dann der Herbst, dann verbrannten wir Kinder auf den Äckern das welke Kartoffelkraut und brutzelten die Kartoffeln im Kartoffelfeuer.
Von der „Katzenmusik“ bis zum „Leichenimbs“
Ein besonderer Tag im Leben des Kindes war bei uns im Dorf der Konfirmationstag und der Kommunionstag. Die Familie gab dann ein großes „Imbs“ (Imbiss). Die Verwandtschaft wurde eingeladen, Pate und Patin wurden nie vergessen. Nach der Entlassung aus der Volksschule zählte sich das Kind schon gern zu den „Großen“. Damals war es auf dem Dorf höchst selten, ein Kind auf die „höhere Schule“ zu schicken. Ich war 1949 der erste Junge im Ort, der auf die „höhere Schule“ ging. Ich war in der Volksschule der beste Schüler. Vor allem Deutsch, Naturkunde („Biologie“), Erdkunde („Geographie“), Heimatkunde, Religion und später Französisch waren meine Lieblingsfächer. Ich träumte schon damals im Geheimen vom Studium der Botanik. Doch wie sollte ich auf die „höhere Schule“ kommen? Meine Eltern waren wahrlich nicht begütert. Sie waren schon auf der Suche nach einer Lehrstelle für mich. Ich sollte Kürschner werden. Als das mein Lehrer Zwalla hörte, war er bitterböse. Er besuchte meine Eltern und bat sie inbrünstig darum, mich auf das „Saarländische Lehrerseminar“ in der benachbarten Stadt Ottweiler zu schicken. So geschah es also: Die Aufnahmeprüfung bestand ich mit sage und schreibe 20 Punkten. Im Saargebiet wurde damals nach folgendem Punktsystem bewertet: 18 bis 20 Punkte war die Note „sehr gut“, 16 bis 17 Punkte war „gut“, 13 bis 15 Punkte war „befriedigend“, 10 bis 12 Punkte war „ausreichend“, 6 bis 9 Punkte war „mangelhaft“ und null bis 5 Punkte war „ungenügend“.
Die Verlobung war bei uns auf dem Dorfe keine so einfache Sache, wie sie es heute ist. Die Eltern hatten bei der Auswahl des Ehegatten ein sehr gewichtiges Wort mitzureden. Die Verlobung erfolgte durch Handschlag, auch Handstreich genannt. Den Hochzeitszug eröffnete, mit der Braut am Arm, der Brautführer. Dieser war auch standesamtlicher und kirchlicher Zeuge. Beim Hochzeitsmahl ging es immer lustig zu. Wie bei allen bäuerlichen Schmäusen gab es früher zuerst Rindfleischsuppe, dann Rindfleisch mit Meerrettich, Rotrüben und Gurken als Beilage und hierauf Schinken mit Kraut. Es war auch Brauch, dass während der Hochzeitsfeierlichkeiten der Braut der Schuh geraubt und dann versteigert wurde. Am Spätnachmittag zog die Hochzeitsgesellschaft in die Wirtschaft, wo getanzt wurde. Vor dem Haus des Bräutigams wurde am Abend mit allen möglichen Gegenständen eine „Katzenmusik“, „Schariwari“ genannt, gemacht. Sie hörte erst dann auf, wenn der Bräutigam sich bereit erklärte, etwas Trinkbares zu stiften.
Wenn jemand in der Familie oder in der nahen Verwandtschaft gestorben war, stelle meine Mutter die Uhr ab, „damit der Tote in seiner Ruhe nicht gestört werde.“ Sie verhängte den Spiegel, um dem Toten nicht die „zweite Leich“ zu zeigen. Die Leiche wurde gewaschen und mit einem Totenhemd bekleidet. Des Mittags oder des Abends läuteten die Totenglocken. Um den Sarg stellte man vielfach brennende Kerzen. Abends kamen die Nachbarn und Verwandten zusammen, um zu beten. Ganz früher wurde auch Nachtwache gehalten. Am dritten Tage nach dem Tode wurde der Verstorbene beerdigt. Mit einem Pferdefuhrwerk wurde der Tote im Zug zum Friedhof gefahren. Nach der Beerdigung fand in der Wirtschaft das „Leichenimbs“ statt. Dazu gehörte vor allem Zuckerkuchen und Kranzkuchen.
Als noch das „Heimsje“ auf dem Bauernhof auf der Pirsch war
Mit dem Schwinden der bäuerlichen Struktur nahm die Zahl der Hauskatzen in den letzten Jahrzehnten bei uns rapide ab. Früher spielten sie auf dem Bauernhof eine wichtige Wächterrolle. Mit dem Anlocken „Heimsje oder Heimiche komm“ verband man die enge Beziehung der Hauskatze zu Haus und Hof. Daher kommt auch der liebevolle Name „Heimiche“: „Zum Heim gehörend“. Ein „Heimchen“ war früher auch die Hausgrille, ein kleiner Hausbewohner, auf dessen erstes Zirpen man im Sommer wartete. Und schließlich war eine gute Hausfrau ein „Heimchen am Herd“.
Einst war die Hauskatze der Wächter auf dem Hofe. Von großen Weizen-, Gerste- und Roggenhaufen wurden Mäuse und andere Nager geradezu magisch angezogen. Ganze Heerscharen taten sich oft an den Körnerbergen gütlich, solange keine Samtpfote einen Abschreckungseffekt erzielte. Mehr noch: Der Mäusekot und die schimmelnden Essensreste galten als höchst ungesunde Beimischungen für den Getreideschrot, der ja schließlich an Rinder und Schweine verfüttert werden sollte. Mit reichem Hunger und Jagdfieber ausgestattet, bewachten die Katzen auch die Futterübenhalde vor Mäusen und größeren Nagern, verscheuchten Ratten schon alleine durch die geschickt platzierten Duftmarken vom Komposthaufen und hielt zuweilen sogar im Gemüsegarten Wacht, um beispielsweise Amseln von den Beeten abzuhalten.
Auch kundige Obstbauern wussten die Arbeit des Schnurrers zu schätzen, denn kräftige Kater waren in der Dämmerung in den Obstanlagen auf der Pirsch, verharrten mucksmäuschenstill vor dem Eingang ins Reich einer Wühlmausfamilie und erwischten an einem Abend gleich drei der Schrecken. Kater „Tom“ hatte sich allein an diesem Abend schon bezahlt gemacht. Die wenigen nächtlichen „Gesangsarien“ der „Miezen“ wurden leicht verziehen.
Allerlei Schabernack trieben wir Jungen abends auf dem Dorf. Konnten wir einen Hausbewohner nicht leiden, so legten wir frische Baldrianwurzeln vor die Haustür. Dass Baldrianduft Katzen magisch anzieht, wussten wir. Die sich dann auf der Treppe tummelnden Katzen miauten so laut, dass der Hausherr nicht schlafen konnte. Meine Mutter brachte die erste Katze in unsere Familie mit. Es war eine schwarze Katze, und obwohl schwarze Katzen damals noch als Unglücksbote galten, waren wir hochzufrieden mit unserer „Mieze“. Meine Mutter Berta war mit meiner Tante Lina und der „Tilchegoth“ an einem Sonntagnachmittag den weiten Weg über den Berg von Steinbach nach Ottweiler ins Kino gegangen. Es war mitten im Winter. Auf dem Rückweg mitten in der Nacht fing es an zu schneien. Da kamen sie an einem kleinen Wäldchen vorbei und hörten ein klägliches Miauen. Es war ein schwarzes Kätzchen, das ihnen entgegenkam. Meine Mutter hatte Leid mit dem Kätzchen und nahm es mit nach Hause.
Der „Pfingstquak“ im Ostertal
Alljährlich zu Pfingsten findet in Werschweiler im Ostertal (Saarland) auch heute noch der uralte Brauch des Pfingstquakes statt. Was bedeutet „Pfingstquak“ und woher stammt dieser Brauch?
Sehr wahrscheinlich war der Quak ursprünglich ein Vegetationsdämon. Die Germanen glaubten, in diesem sei der Dämon selber und er würde so das Wachsen und Gedeihen der Natur günstig beeinflussen. Sie hüllten jemanden aus ihrer Mitte in das grüne Laubwerk des jungen Frühlings und schmückten ihn mit den ersten Blumen. Durch das Herumtragen von Haus zu Haus sollte er Segen spenden. So war wohl unseren Vorfahren dieses Umhertragen des Quakes eine sehr ernste, aber auch feierliche Angelegenheit.
Heute ist der Pfingstquak in Werschweiler nur noch ein Kinderbrauch. Das Wort „Quak“ wird unterschiedlich ausgelegt. Der Quak kommt außer in einigen Gegenden des Saarlandes noch im Hunsrück, Elsass und in der Pfalz vor. Man bringt damit etwas Junges, noch Unentwickeltes zum Ausdruck. Der Jüngstgeborene ist der Nestquak, unreife Kirschen werden ebenfalls als „Quaken“ oder „Quakerte“ bezeichnet. Der Pfingstquak wäre demnach das junge frische Maiengrün, die erste Gabe der überreichen Natur.
Jedes Jahr, wenn um Pfingsten die Natur sich zu entfalten beginnt, sich im Walde die ersten zarten Blätter zeigen, der Ginster am Wegrand und auf den Höhen seine goldenen Farben erstrahlen lässt und der Frühling sich in seiner schönsten Pracht zeigt, dann schenkt er der dörflichen Schuljugend den herrlichen Laub- und Blumenschmuck zum Pfingstquak.
Schon zehn oder auch vierzehn Tage vor Pfingsten, wenn die Rotbuchen ihr erstes zartes Grün zeigen, ziehen die älteren Jahrgänge der Schulbuben unter der Führung des Abschlussjahrganges – das sind die „Quakherren“ – mit zwei Handwagen hinaus in den Wald. Die Quakherren dürfen in den Handwagen Platz nehmen und werden in den Wald und später auch wieder nach Hause gefahren.
Im Wald angekommen, werden nun junge Buchen ausgesucht und die Äste, die sich gut zum Flechten eignen, abgeschnitten. Damit werden die beiden Handwagen voll geladen und noch ein Dach darüber geflochten, unter dem die Quakherren Platz nehmen.
Bei dem zweitältesten Quakherren zu Hause wird dann der Quak hergerichtet. Die Buchenreiser werden jetzt nochmals zurechtgeschnitten und damit das Gestell des Quakes umflochten. Das Gestell ist etwa 80 cm hoch, oben ist ein rundes Brett mit etwa 40 cm Durchmesser, am Rande sind 12 Löcher im gleichen Abstand gebohrt, in welche Haselnussstöcke gesteckt werden. Am unteren Ende sind die Stöcke an einem Blechreifen befestigt, der einen Durchmesser von 50 cm hat.
Ist das Gestell bis auf ein kleines Guckloch vollständig umflochten, wird der Quak bis zu seiner Vollendung in den Keller gestellt, damit er sich frisch hält. An Pfingstsonntag schon in aller Frühe sieht man ein emsiges Treiben der gesamten Schulbuben. Die gehen von Haus zu Haus und sammeln Blumen, die in den Dorfgärten wachsen. Die so gesammelten Blumen werden nun zum Quak getragen, denn mittlerweile haben die Quakherren den Quak auf einen provisorischen Tisch aufgebaut und jeder von ihnen ist mit einem kleinen Holzspieß bewaffnet, mit denen Löcher in das Quakgeflecht gebohrt werden. In diese Löcher steckten dann die Buben die Blumen hinein.
Ist das Flechtwerk nun vollends mit all den bunten Blumen behangen, kommt als Abschluss ein kleines Fichtenkrönchen obendrauf, das in dem runden Brett befestigt wird. Dieses kleine Krönchen wird nun ebenfalls mit Blumen und bunten Bändern geschmückt. Der nun fertige Quak strahlt die ganze Kraft der bäuerlichen Blumengärten aus; besonders herrlich wirkt er, wenn Pfingstrosen, Flieder und Schneeball verwendet worden sind.
Am Nachmittag ziehen die vier ältesten Jahrgänge noch einmal in den Wald, aber diesmal ohne Handwagen. Jetzt werden die letzten Vorbereitungen für den nächsten Tag getroffen, die Anfertigung der „Taratschen“ (Schalmeien, Rindenflöten). Dazu müssen die Erlen herhalten, die sich besonders dafür eignen und an Waldbächlein gut gedeihen. Für jeden Schulbuben wird ein solches Instrument von den Erlen abgeschält.
Sobald sie mit ihren „Taratschen“ im Dorf erscheinen, stehen schon die jüngeren Buben, die nicht mitgehen duften, um ihre „Taratschen“ in Empfang zu nehmen. Nun sind alle Vorbereitungen getroffen, den Quak nach alter Sitte den Dorfbewohnern aufs Neue vorzustellen. Die beiden ältesten Jahrgänge bewachen in der Nacht den Quak, damit er nicht gestohlen wird.
Am zweiten Pfingsttag, schon früh beim Morgengrauen, werden alle Schulbuben des Dorfes durch d en Klang einiger „Taratschen“ geweckt. Die Töne, die man diesem Rindeninstrument entlocken kann, sind kaum zu beschreiben, den Dorfbewohnern aber bleibe n sie ewig in Erinnerung. Wenn sich die Buben alle bei den Quakherren versammelt haben, dann geht das Konzert richtig los. Einer trägt jetzt den Quak von Haus zu Haus, gefolgt von den „Taratschenmusikanten“.
Vor dem Zuge, aber hinter dem Quak, marschieren die Quakherren mit einem Eierkorb, einem Eimerchen für Speck und Butter und der Zigarrenkiste, die zum Aufbewahren des gespendeten Geldes benötigt wird. In diesen Geräten werden die Gaben eingesammelt. Es wird vor jedem Hause so lange musiziert, bis die Hausfrau oder der Hausherr an die Haustür kommen und ihnen etwas Essbares oder Geld geben.
Manchmal lehnt sich der Bauer neugierig über die Stalltür hinaus, da um diese Zeit das Vieh gefüttert wird und sagt mit einem ernsten Gesicht: „Ihr Buwe, es langt mit dem Krach“. Dabei kann er aber ein Lächeln kaum verbergen und denkt an seine eigene Schulbubenzeit zurück. Der Bauer nebenan, dem der Schalk schon von weitem aus dem Gesicht lacht, sagt: „Ihr Buwe, aber jetzt mal ordentlich geblasen.“
Sind die Buben mit ihrem Umzug durch das Dorf fertig, so geht es zum Haus des ältesten Quakherren. Hier werden jetzt die Eier entweder mit Butter oder mit Speck gebacken und von sämtlichen Quakbuben verspeist. Das Geld und den Rest des Speckes und der Eier teilen sich die Quakherren untereinander auf. Zu einem gewissen Ritual gehört auch das Zerstören der „Taratschen“ nach dem Umzug.
Das Quakgestell bleibt erhalten. Der nächstjährige Quakherr nimmt es mit nach Hause und bewahrt es auf. So endet jedes Jahr mit dem Eieressen an Pfingstmontag der schöne Brauch des Werschweiler Pfingstquakes.
Als die Frösche noch quakten
Erinnerungen werden wach, wenn wir an das „Märchen vom Froschkönig“ denken. Im richtigen Leben können Frösche und Kröten sich nicht wie im Märchen in Prinzen verwandeln, um die Sympathie des Menschen zu gewinnen. Im Mittelalter wurden sie als Teufelswesen verdammt und zu geheimnisvollen Salben und Tinkturen verarbeitet. Vor allem die Kröte galt in den volkstümlichen Vorstellungen unserer Vorfahren als Unglücksbote. Sie war das verfluchte Tier schlechthin, das Tier der Schatten, das Tier des Satans, der sich den Menschen häufig in dieser „hässlichen“ Gestalt präsentierte. Das Bild von der „hässlichen Kröte“, vor der man sich „ekelte“, ist zum Teil bis in unsere heutige Zeit erhalten geblieben.
Die Kröte war zum einen wichtiger Bestandteil der unheilvollen Absude und Tränke der Hexen, zum anderen aber auch – und das seit frühesten Zeiten bis Anfang des 20. Jahrhunderts – bedeutsam für die Behandlung von Rheuma oder Geschwüren. Man band sie lebend auf den erkrankten Körperteil. Zur Fieberbekämpfung schloss man sie in einem kleinen Säckchen ein, das man um den Hals trug.
Den Fröschen ging es bei uns ganz besonders „an den Kragen“: Sie galten als Delikatesse in der Landbevölkerung. Noch in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts hat man die Teich- und Wasserfrösche im Frühjahr zur Zeit der Laichwanderungen massenhaft gefangen, ihnen bei lebendigem Leib die Schenkel abgerissen, um sie zu verspeisen. Der obligatorische Feuerlöschteich im Dorf war immer der Froschteich. Hier vor allem trieb man das grausame Spiel. Ich habe als Kind miterlebt, wenn in meinem Heimatdorf Anfang März die „Froschjagd“ begann. Bei Einbruch der Dunkelheit – Frösche wandern bei Regenwetter nachts zu ihren Laichtümpeln – versammelten sich die jungen Männer an der Hanauermühle im Bereich der Oster, um die umherziehenden Frösche zu sammeln. Einmal war auch ich dabei und noch heute denke ich mit Grausen zurück, wenn man ihnen die Schenkel aus dem Leib riss. Und das passierte in einer Nacht Hunderten von Fröschen. Ich erinnere mich, wie mein Patenonkel daheim Froschschenkel in der Pfanne briet. Und da sah ich was Unfassbares: Die Schenkel zappelten in der heißen Pfanne. Ich habe nie Froschschenkel gegessen. Heute stehen alle Frösche und Kröten unter Schutz; trotzdem werden die Froschlurche immer seltener, und manche Arten verschwinden sang- und klanglos.
„Froschkonzerte“ gehören der Vergangenheit an. „Wo Frösche sind, da sind auch Störche“, heißt es in einem alten Sprichwort. Das war einmal! Und da im Volksglauben „der Storch die kleinen Kinder bringt“, muss man sich nicht wundern, dass die Geburtenrate bei uns so niedrig ist.
Ich erinnere mich auch an den Laubfrosch, der gerne als Wetterprophet gehalten wurde. Seiner leuchtend smaragdgrünen Hautfarbe und seines „netten“ Gesichtsausdrucks wegen, war er früher der Liebling unter den Fröschen. Der Klettermaxe rutscht auch auf glatten Fensterscheiben nicht ab und springt mit einzigartiger Geschwindigkeit durchs Blättergewirr. Als Wetterpropheten siechten früher unzählige Laubfrösche in Einweckgläsern vor sich hin. Eine Leiterchen war die einzige Ausstattung. Das Geheimnis ihrer Wetterfühligkeit ist einfach zu lüften: Sie stiegen in die Höhe, wenn es ihnen im engen Behälter zu heiß wurde und sie unten keine Luft mehr bekamen. Dann sollte „schönes“ Wetter bevorstehen. Blieben sie im Glas unten sitzen, sollte Regen im Anmarsch sein. Und eine alte Bauernregel besagt: „Wenn im Mai die Laubfrösche knarren, magst du wohl auf Regen harren.“
Das Verhalten der Frösche und Kröten spielte bei unseren bäuerlichen Vorfahren als Wetterprophezeiung eine große Rolle. Besonders im Frühjahr, wenn Frösche und Kröten als „Frühaufsteher“ aus ihrer Winterstarre erwachten, wurden diese Amphibien als Wetterkundschafter angesehen, wobei häufig zwischen Fröschen und Kröten kein Unterschied gemacht wurde. Dies beweist auch die Redensart „einen Frosch im Hals haben“, vielfach bei uns abgewandelt „eine Kröte (Krott) im Hals haben“, wenn einer heiser spricht und nur noch „quaken“ kann.
Als die „Kersche“ noch „bockich“ waren
Wenn „Kersche“ „bockisch“ oder „wormisch“ sind, dann ist kein „Bock“ (im Volksmund beinlose Insektenlarven) und auch kein „Wurm“ drin, sondern die Made der Kirschfruchtfliege. Also sind solche Kirschen „madig“. Unreife Kirschen heißen im Volksmund „Quake“ oder „Quakerte“. Wer noch „grün“ hinter den Ohren ist, ist noch „unreif“, eben nicht erwachsen. So sollte auch der Pfingstquak, der heute noch im Ostertal (St. Wendel) nach uralten Riten gefeiert wird, den noch jungfräulichen Sommer herbeilocken.
„Kirschen in Nachbars Garten“ wurden früher von Jungen „gestrebbt“ oder „gestranzt“ („gestohlen“), weil sie eben besser schmeckten als die eigenen. Dabei musste man immer auf der Hut „vorm Schitz“ sein, der als Feldhüter die Fluren bewachte oder vor Frevlern „schützte“. Mit dem Dorfschütz war eben „nicht gut Kirschen essen“. Wurde man dann vom „Schitz“ erwischt, konnte man vor lauter Angst nur noch „quaken“, weil einem die Angst den Hals „zudrückte“. Wurden wir Buben beim Kirschenstranzen erwischt, kam am anderen Morgen der „Schitz“ in die Schule und „zeigte uns beim Lehrer an“. Hin und wieder gab es dann auch mal eine „Tracht Prügel“.
Die „Meikersche“ (Maikirschen) waren bei uns Jungen besonders beliebt, waren sie doch schon Ende des Monats reif. Es waren die ersten Kirschen, die uns anlockten. Doch da gab es auch einen „Kirschendieb“, der uns die Maikirschen immer „abpickte“. Es war der Pirol, der Pfingstvogel, dessen Lieblingsspeise eben Kirschen waren. Reife Kirschen wurden „gebrochen“, was pflücken bedeutet, aber „abbrechen“ heißt. Und sicherlich waren oben auf dem „Kerschbaam“ (Kirschbaum) noch ein Vogelnest mit einem „Quakerchen“ oder „Quakelchen“, was das Jüngste der Nestjungen war, eben das „Nesthäkchen“. Der Stein in der Kirsche ist im Volksmund der „Kerschekääre“, obwohl es kein Kern ist. Die „Kerschekääre“ wurden „ausgespauzt“ oder ausgespuckt. Im pfälzischen Dorf Altenkirchen gab es früher sogar einen Wettbewerb mit dem „Kirschenkern-Weitspucken“.
Die „Spatze- und Molkekersche“ schmeckten uns Jungen am besten und eben die schwarzen hoch oben im Baum, die von der Sonne „gebrannt“ waren. „Rote Kirschen ess ich gern, schwarze noch viel lieber …“
Die Kirschreife fiel früher immer mit der Heuernte zusammen, die oft zum Leidwesen der Bauern von schweren Gewittern begleitet wurde: Dann regnete es „Heigawwele“ (Heugabeln).