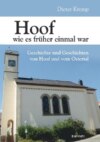Kitabı oku: «Von der Weisheit und vom Brauchtum unserer bäuerlichen Vorfahren», sayfa 6
Mit der Schelle unterwegs: „Pass off, de Schitz kommt meddem Stecke“
„Es wird bekannt gemacht, dass Hausschlachtungen nur dann vorgenommen werden dürfen, wenn der Besitzer das Tier mindestens drei Monate im eigenen Stall gehalten und gefüttert hat. Jede Schlachtung bedarf andernfalls der Genehmigung.“ So wanderte der „Dorfschitz“ mit der „Schell“ in der Hand von Straße zu Straße im Dorf und rief seine Bekanntmachungen an die Bevölkerung aus. Die Menschen öffneten Fenster und Türen, um jedes Wort richtig verstehen zu können. Im Juli 1940 war es in Werschweiler „Feldschitz“ Karl Müller, der von 1933 bis ausgangs der 50er Jahre dieses wichtige Amt als Feldhüter und Ortspolizeidiener ausübte.
Dessen Vorgänger, so erinnern sich heute noch ältere Werschweiler Bürger, war Konrad Stoll. Im Februar 1953 „schellte“ Karl Müller weithin durch das Dorf, dass „aufgrund der letzten Untersuchung des staatlichen Instituts für Hygiene und Infektionskrankheiten das Trinkwasser hygienisch einwandfrei ist. Die bisherige Anordnung, das Wasser vor dem Genuss abzukochen, ist damit hinfällig.“
Der Dorfschütz von Niederkirchen machte am 9. Oktober 1952 den Tag der Obstversteigerung bekannt, der in früheren Jahren immer ein besonders Ereignis für die Ostertaler Bevölkerung war. Der Termin fiel immer auf den Selchenbacher Kirmessonntag. An der Gemarkungsgrenze in Werschweiler war vormittags Treffpunkt. Dann wurde Baum für Baum an den Meistbietenden versteigert. Natürlich war auch der Schitz dabei, der auf den regelmäßigen Ablauf der Versteigerung achten musste. Am Nachmittag war man dann in Selchenbach angelangt, und die Teilnehmer verbrachten dann den Rest des Tages auf der Kirmes.
Übrigens wird auch heute noch der Brauch der Obstversteigerung auf der Werschweiler Gemarkung durchgeführt, organisiert vom Obst- und Gartenbauverein. Vor dem „Schitz“ hatten die kleinen Dorfbuben auch Angst und einen Heidenrespekt. Mit dem „Schitzestecke“ (Stock) in der Hand, der Schirmmütze auf dem Kopf und dem Hund hinterdrein durchwanderte er Tag für Tag die Flure und achtete peinlich genau auf das, was sich aufc den Feldern, Äckern und Wiesen abspielte. „Pass off, de Schitz kommt mit dem Stecke“, wurden die Jungen von ihren Eltern bedroht, wenn sie was angestellt hatten. „Schitz“ kommt von „schützen“. Er war als Ortspolizeidiener auch zuständig für den Schutz der Felder, Wälder, Bachauen und Obstpflanzungen, eben der Gemeindefeldhüter. Feldfrevel wurde von ihm streng geahndet. Auch ich habe heute noch Erinnerungen an meine Kindheit, wenn uns Buben der „Schitz“ erwischte und dann verfolgte. Besonders zur Kirschenzeit waren wir vor ihm nicht sicher. Wir Jungen „stranzten“ besonders gerne die ersten „Maikirschen“.
Noch viel später, als ich als Junglehrer 1959 nach Hoof kam, wurde ich vom Leitersweiler „Schitz“ erwischt, als ich auf Leitersweiler Gemarkung auf der „Fröhn“ Brombeeren pflückte. Das durfte man nicht, so meinte jedenfalls „de Herrgott“, wie der Leitersweiler „Schitz“ im Volksmund genannt wurde. Als junger Mann war der spätere Werschweiler „Schitz“ Karl Müller, Feldhüter von 1933 bis 1959, Bergmann unter Tage. Er war dort im „Schlafhaus“ und als Koch berühmt. Natürlich war Karl Müller bei der jährlichen Bachschau als Feldhüter anwesend. Jeder Anlieger musste nach der Heuernte den Bach von Gestrüpp freimachen. Zur Inspektion kam eine Kommission mit dem Amtsbürgermeister, dem Ortsgendarmen und dem Feldhüter. Letzterer kannte die Parzellen genau. Wehe, wenn der Bachsaum nicht in Ordnung war! Der wurde gemaßregelt und musste binnen weniger Tage für eine Nachbesserung sorgen. Das Gebot, dass die Wiesen „zu“ waren, galt vom 1. April bis zum 24. Juni, dem Johannistag.
Auch bei der Aufteilung der „Rodhecke“ war der „Schitz“ der wichtigste Mann im Dorf. Er teilte sie in Schneisen auf, die er mit Stangen abmaß und kennzeichnete die die Schneisen mit Nummern. Der „Schitz“ achtete darauf, dass bis zum Johannistag die eingeteilten Parzellen in der „Rodheck“ als Stangenholz und „Fache“ (Reisigbündel) abgefahren wurde. Dann ging der Förster mit dem Feldhüter durch die „Rodheck“, ob auch die Wurzelstöcke ordnungsgemäß herausgeschlagen waren.
Ganz früher hatte der Dorfschütz auch die Aufgabe, darauf zu achten, dass bei der Bekanntmachung im Dorf die Fuhrwerke mindestens 60 Meter vor ihm anhielten, damit der Lärm nicht störte. Im Krieg hatte der Feldhüter eine weitere Aufgabe: Tag für Tag kloppte er die Kartoffelkäfer ab und passte auf, dass keine „Grombiere“ (Kartoffeln = Grundbirnen) geklaut wurden. Er musste auch bei der Zwangsablieferung von Kartoffeln beim Verladen in den Waggon dabei sein. Im Herbst 1944 wurden auf dem Werschweiler Bahnhof 212 Zentner Kartoffeln abgeliefert. Im Krieg musste der „Schitz“ auch das Getreide nach dem Dreschen abwiegen, denn ein bestimmter Prozentsatz musste abgeliefert werden. Bei den Hausschlachtungen wog er das Fleisch. Pro Person war ein bestimmtes Kontingent für den eigenen Hausverbrauch erlaubt. Was darüber hinausging, musste abgeliefert werden. Und am frühen Morgen ging der „Schitz“ durchs Dorf und schellte lauthals aus: „Heute Mittag um zwei Uhr gibt es in der Wirtschaft Ulrich die Lebensmittel- und Kleiderkarten.“ Immer gab es für den „Schitz“ einen Trunk Wein dazu, wenn er im Dorf ausschellte, zum Beispiel sein Getreide gegen Hagel versichern zu lassen. Am Dorfende stand er dann oft auf wackeligen Füßen.
Vom Großknecht und vom Kleinknecht auf dem Bauernhof
Der Großknecht war die erste Kraft und der Vertreter des Herren auf dem Bauernhof. Wenn er „gedingt“ (gemietet) wurde, dann musste er ein gesetztes Alter haben. Er durfte nicht unter 25 Jahre alt sein, und musste länger schon als Klein- oder Mittelknecht auf Höfen gedient haben, bevor von ihm erwartet werden konnte, die ihm obliegenden Arbeiten zum Vorteil seiner Herrschaft auszuführen. Wer geistig oder körperlich etwas zurückgeblieben war, konnte natürlich den Platz als Großknecht nicht einnehmen, er musste seine arbeitsfähige Zeit als Kleinknecht dienen. Bei dem Großknecht war es sehr wichtig, dass er morgens pünktlich wach wurde. Nicht jeder hatte damals schon eine Weckuhr. Der Großknecht hatte nach dem Erwachen für Licht und Feuer zu sorgen. Dafür hatte er einen Zunder, einen Feuerstein, Stahl- und Schwefelsticke. Fing der Zunder durch Streifschläge auf dem Feuerstein, als aus einem Funken an zu glimmen, dann hielt man einen Schwefelsticken daran, und daraus bildete sich eine Flamme. Diese wurde an den in Rüböl getränkten Docht des anzusteckenden Lichtes gehalten, bis das Öl zum Sieden kam und sich zur Leuchtflamme entfaltete. Petroleum war damals noch sehr rar, es gab es erst so seit 1920. Hatte der Knecht nun licht, dann musste er für die Pferde das Futter auf der Lade, auch Zappelbock genannt, am ganz frühen Morgen schneiden. In dieser Zeit fütterte er auch die Pferde und weckte den Kleinknecht zum Putzen der Pferde und die Mägde zu ihrer Morgenarbeit.
Beim Pflügen hatte der Großknecht sämtliche Ackerstücke zu furchen. Seine Aufgabe war es auch, das gesamte Korn auf die Furche breitwürfig auszusäen. Der Bauer selbst und sein Kleinknecht hatten mit Eggen zu tun. In der Ernte musste der Großknecht vorweg mähen und vor Sonnenuntergang mit der Sense schon einen Teil zu Boden gelegt haben. Im Winter wurden abwechselnd Mist, Erde und Holz gefahren. Es wurde aber die meiste Zeit mit dem Flegel gedroschen.
Abends wenn die Frauen und Mägde spannen, der Kleinknecht die Pferde fütterte und das Kuhfutter schnitt, musste der Großknecht auf der Rolle Stricke aus Grobhede spinnen. Man benötigte sehr viele Stricke zum Anbinden der Kühe und Pferde, sowie für Stränge an Wagen-, Pflug- und Eggenschwengel.
Der Knecht ging sogar an den langen Winterabenden mit Rolle und Hede ins Dorf. Zugleinen, Gartenstricke, Sackbänder, Garnstricke für die Egge, Kuhstricke sowie sämtliche Pflug- und Eggenschwengel wurden an den Sonntagnachmittagen gemacht. Das war eine Arbeit für drei Personen, gewöhnlich für den Bauern, den Groß- und den Kleinknecht. Mittagspause gab es nur während der Mähtage in der Ernte. Selbst an Feiertagen, außer der Zeit d es Gottesdienstes, wurde gearbeitet. In der Mittagspause während der Ernte tranken die Mägde ihren Ziggoriekaffee. Der Bauer trank in der Regel ein Malzbier.
Meine Mutter war als Magd beim Bauer Nauhauser beschäftigt. Dort arbeitete in den letzten beiden Kriegsjahren eine polnische Magd, die von den Nazis deportiert worden war. Die Polin war eine sehr fleißige Magd. Meine Mutter sagte mir viele Jahre später, dass sie wohl merkte, was sich da hin und wieder in der Tenne abspielte. Bauer und Magd hatten eine Liebelei, damals durfte das natürlich bei Strafe nicht sein. Polinnen waren ja keine Arier. Und wie es dann der Zufall wollte: Kurz nach dem Krieg heirateten die beiden.
Ganz früher wurde noch das Korn in der Winterzeit mit dem Flegel gedroschen, der Roggen mit Hilfe der Tagelöhner. Die Abend- oder Abarbeit des Kleinknechtes bestand darin, dass er die Schafe abfütterte und den Stall verschloss. Darauf musste er Stroh, Heu und Spreu für das Vieh für den nächsten Tag aus der Scheune hereinholen und auch ein paar Bunde Sommerstroh zum Abfüttern den Kühen vorgeben.
Der Kleinknecht war wirklich der Sündenbock auf dem Hofe, denn nicht nur der Bauer, sondern auch der Großknecht hatte ihm zu befehlen. War aber mal was beim Fahren in Unordnung geraten oder passierte hier und da mal ein Malheur, so hatte der Junge Schuld, obwohl er in manchen Fällen unschuldig war.
Vom Aberglauben im Ostertal
Das sittliche Leben der Ostertäler war von jeher ein ziemlich gutes zu nennen, auch im 17.Jahrhundert. Weltliche Vergnügen, wie Tanzen, Kartenspiel, Kegeln waren durch Friedrich Ludwig strengstens verboten. Die Ostertäler wussten sich gemäß zu helfen, da ihnen in den benachbarten nassauischen Orten Werschweiler und Dörrenbach, wie in den kurpfälzischen Orten Frohnhofen und Altenkirchen die Tanz- und Kegelplätze offen standen. Dort waren solche Vergnügungen erlaubt.
Die Schulbildung im Ostertal war bis zur Einführung des Schulzwanges (Anfang des 19. Jahrhunderts) sehr mangelhaft. Die wenigsten Gemeindeglieder genossen Unterricht. Besonders das „weibliche Geschlecht“ war fast durchweg ohne Kenntnis des Schreibens und Lesens.
Noch in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde im Ostertaldorf Hoof „gebraucht“. Der Arzt wurde nur im äußersten Notfalle zu Rate gezogen, fast immer, wenn es zu spät und der Kranke nicht mehr zu retten war. Besonders häufig wurden kranke Kinder „gebraucht“, wenn sie im Winter unter fieberhaften Erkältungen litten.
Auch unsere Ahnen in Hoof versuchten mit alten Hausmitteln, mit „Brauchen“ und anderen geheimnisvollen Zaubertränken die Krankheiten zu vertreiben.
Fast in jedem Dorfe, so auch in Hoof und in Niederkirchen, gab es jemand, der das „Brauchen“ verstand. (Anmerkung: Ich selbst erinnere mich noch an meine frühe Kindheit in den Kriegsjahr en des Zweiten Weltkrieges in Steinbach bei Ottweiler, als noch das „Brauchen“ auch an mir ausgeübt wurde. Wenn ich Fieber hatte, Bauch- oder Kopfschmerzen, ging meine Mutter mit mir zu meiner Urgroßmutter. Sie legte ihre Hände auf meine Schläfe und sprach einige für mich unverständliche Worte. Und seltsam! Nach dem „Brauchen“ fühlte ich mich gesund.)
Im Ostertal war es in den 1880er Jahren noch so, dass ein Mann das „Brauchen“ am Vieh und eine alte Frau das „Brauchen“ am Menschen ausübte. So wird auch in der Pfarrchronik in Niederkirchen berichtet, dass eine Marther Mutter mit ihren zwei Kindern nach Hoof ging, wo eine alte Frau in der „Aacht“ das „Brauchen“ pflegte. Nach einiger Zeit kam das heraus und der Pfarrer in Niederkirchen verhängte die Kirchenzensur an die Marther Frau.
Auch von alten Hausmitteln wird berichtet. Hilfe vor „blöden Augen und Ohren“: „Nimm ein rein Blatt von Zinn oder Kupfer, beräuchere es, schreibe darauf mit Milch von einer Frau, so ein Knäblein geboren und den 7. Tag im Kindbette liegt, also. „Ein Ohr, dass da höret, ein Auge, dass da sehet, werden beide von Adonay gemacht.“ „Lasse es von sich selbst trocknen, dann wische es ab mit reinem Mandelöl, salbe damit die Augenlider oder lasse es in die sausenden Ohren tropfen, tue es sieben Tage, siebenmal am Tage und Du wirst Wunder erleben.“
Für die Gelbsucht bei Menschen: „Nimm Holderwurzeln, die mittlere Rinde, schabe sie und siede sie und gib den Menschen alle zwei Stunden zwei oder drei Esslöffel voll und sechs Morgen und Abend hintereinander.“
Um gestohlenes Gut wieder zu bringen: „Schreib auf 2 Zettelchen folgende Worte, lege das eine über die Tür und das andere unter die Türschwellen, da kommt der Dieb am dritten Tag und bringt den Diebstahl: „Abraham hat gebunden, Isaac hats erlöst, Jakob hats heimgeführet, es ist so fest gebunden als Stahl und Eisen, Ketten und Banden.“
Aus der Pfarrchronik in Niederkirchen wissen wir, dass auch mit Wünschelruten nach verborgenen Schätzen gesucht wurde. Am 4. April 1693 wurden mehrere Gemeindeglieder von Hoof und Marth von der Kirchenzensur zu Niederkirchen bestraft, weil sie in der Wiesenaue des Betzelbachtales zwischen Hoof und Marth mit einer Glücksrute auf Schatzsuche waren.
Am 2. August 1671 wurde von der Censur vorgebracht, „dass Junge unter den Zuhörern das abergläubische „Gurgelfingerhalten“ praktizierten.“ Es wurde ihnen geboten, sich für solchen abgöttischen Wahn in Zukunft straff zu hüten.
Der Glaube an Zauberei und Hexerei war natürlich ebenso verbreitet. Am 3. Februar 1697 wurde Jakob Becker aus Hoof exkommuniziert, weil er „einer Zauberei nachgegangen war“, und weil er seinen Wahn nicht einsehen wollte. Als er aber um Verzeihung bat, wurde er am 3. Mai 1697 „absolviert“. Dementsprechend gab es auch Hexen im Ostertal. . Einmal wurden in einem Hexenprozess drei Sitzungen abgehalten, bei denen zum Teil alles in ziemlicher „confussion“ vorgebracht wurde. Die „Deliquenten“ mussten zu guter letzt „dygnocieren“ (Abbitte leisten). „Die Klägerin, der ihr Kleid an einigen Ecken war verschnitten worden, und die Stücke zu zauberischem Beruf verwendet worden, sich nachträglich beim Oberamt beschwerte, das die Schuldigen um 5 Fladen strafte, so ist das für eine einzig boshaften und unersättlicher Boshaft an der Klägerin gehalten worden.“
Von der Bullenzucht früher im Bauerndorf
Noch heute erinnern sich die ältesten Hoofer Bürger an die Zeit zurück, als der Landwitrt Reinhard Koch als Bullenzüchter weithin bekannt war. der „Stierstall“, im Dorfmund auch „Bockstall“ genannt, befand sich an seinem Bauernhaus auf dem „Nebenhügel“, wo Reinhard Koch bis Ender der 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts die Bullenzucht betrieb. Und sein Sohn Kurt Koch muss heute noch schmunzeln, wenn er an diese Zeit zurückdenkt: „Natürlich waren wir kleine Jungen auch neugierig, was sich dort abspielte. Wir haben immer wieder „gespitzt“, doch verjagte man uns. Und bestialisch hat es dort gestunken.“
Am 2. April 1935 schloss das Bürgermeisteramt Niederkirchen mit dem Landwirt Reinhard Koch einen „Zuchtstierhaltungsvertrag“ (Faselhaltungsvertrag; Fasel = junges Zuchttier) ab. Unterschrieben wurde der Vertrag von dem legendären Bürgermeister König in Niederkirchen, dem Tierhalter Reinhard Koch und den Mitgliedern des Gemeinderates. Der Vertrag wurde vom Bezirksamt Kusel staatsaufsichtlich genehmigt: „Der Landwirt Reinhard Koch in Hoof beschafft und hält auf eigene Kosten zwei Zuchtbullen für die Gemeinde Hoof.“
So wurde unter anderem genau vorgeschrieben: „Der Bulle muss in einem hellen, gut gelüftetem, geräumigen, reinlichen Stall aufgestellt, sauber gehalten und seiner Zweckbestimmung als Zuchttier entsprechend in der Hauptsache mit gutem Heu und Hafer unter Beigabe von Salz (ein Esslöffel voll auf drei Mahlzeiten) kräftig gefüttert werden. Mastige, aufschwemmende und sonst ungeeignete Futtermittel (Schlempe, Treber, Kartoffeln u.dgl.) dürfen dem Bullen nicht verabreicht werden; ausschließliche Grünfütterung ist unstatthaft.“ In Paragraf 3 des Vertrages heißt es: „Der Tierhalter hat die Einrichtungen zu treffen, die für die Vornahme des Deckgeschäftes notwendig sind. Insbesondere ist ein geeigneter Sprungplatz (mit Sprungstand) bereitzustellen. Auch ist Sorge zu tragen, dass bei dem Sprunggeschäft eine Gefährdung des Wärters und der Zuchttiere sowie eine Verletzung der Sittlichkeit vermieden wird.“ Eine übermäßige Verwendung des Zuchttieres zum Deckgeschäft war verboten. In der Regel sollte es an einem Tage nicht öfter als zweimal zum Sprung zugelassen werden. Bei jeder Bedeckung durfte nur ein Sprung stattfinden; die sofortige Wiederholung des Sprunges, der sogenannte Nachsprung, wurde nicht zugelassen. Oder es heißt weiter: „Bei mehrmaliger Benutzung des Zuchttieres van einem Tage ist nach jedem Sprung eine mindestens zweistündige Pause einzuschalten. Zum Belegen sichtbar kranker, auffällig hustender oder mit Scheidenausfluss behafteter Tiere darf das Zuchttier nicht verwendet werden, ebenso zum Belegen von Tieren, die nicht 15 Monate alt sind. Der Tierhalter braucht das Zuchttier in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März nur früh von 7 ½ Uhr bis 9 Uhr, mittags von 12 bis 1 Uhr und abends von 4 bis 6 Uhr; in der Zeit vom 1. April bis 30. September nur früh von 5 bis 7 Uhr, mittags von 12 bis 1 Uhr und abends von 7 bis 9 Uhr zum Sprung vorzuführen und darf außerhalb dieser Stunden das Belegen versagen. An Sonn- und Feiertagen kann er die Vorführung des Zuchttieres zum Sprung außer in den erwähnten Morgen-und Abendstunden ablehnen.“
„Durch Weidegang, mäßige Verwendung im Zuge bei Bullen, Aufenthalt in einem Tummelplatz oder durch Führ en soll das Zuchttier womöglich täglich Gelegenheit erhalten, sich mindestens eine Stunde im Freien zu bewegen. Dagegen darf das Zuchttier ohne ausdrückliche Genehmigung des Gemeinderates mit weiblichen Tieren nicht gemeinsam geweidet oder auf Tummelplätze gebracht werden. Der Bullenhalter ist verpflichtet, jede Kuh vor dem Deckakte auf das Vorhandensein von ansteckendem Scheidenkatarrh zu untersuchen und jede kranke oder krankheitsverdächtige Kuh bis zu ihrer Heilung vom Deckakte auszuschließen.“
Der Tierhalter wurde aber auch verpflichtet, das Zuchttier an den Körort zu bringen und es auf Verlangen des Gemeinderates bei Tierschauen oder ähnlichen Veranstaltungen auszustellen. (Kören = küren,; männliche Haustiere zur Zucht auswählen).
Ferner war der Tierhalter verpflichtet, den Mitgliedern des Gemeinderates und des Körausschusses jederzeit die Prüfung der Haltung und der Verwendung des Zuchttieres zu gestatten, das Deckverzeichnis vorzulegen und alle erforderlichen Aufschlüsse zu geben.
Die Gemeinde Hoof gewährte dem Bullentierhalter Reinhard Koch für die Erfüllung seiner Verpflichtungen folgende Vergütungen: 1.) Eine jährliche Barentschädigung von 800 Reichsmark; 2.) Den Nutzgenuss folgender Grundstücke auf der Gemarkung Hoof: Wiese an der Hirtenwiese, Wiese und Acker zwischen den Gärten und 3.) Endlich 30 Zentner Hafer pro Jahr. Vorstehende Naturalleistungen entsprechen einem normalen jährlichen Anschlagswerte von 700 Reichsmark.“
In dem Vertrag wurde ausdrücklich betont, dass der Zuchttierhalter keine Sprunggelder erheben durfte. Die Zuchtstiere wurden auf Gemeindekosten bei der Versicherungskammer, Abteilung Tierversicherung, in München versichert.
Der Hahn, der Ritter im Dorf
Die Hähne waren eine Zierde auf dem Bauernhof. Mit stolzem, gemessenem Schritt stolzierten sie durch die Hühnerschar. Sie hatten meist dieselbe Farbe. Sie hatten einen leicht gebogenen, hellfarbigen Schnabel und über demselben auf dem Kopf einen purpurroten, kronenartigen Kamm, welcher mit Würde getragen wurde. Der etwas gebogene Hals war bekleidet mit einer bronzefarbenen, gemischt mit hochroten Federn geschichteten Pelerine, hängend bis über die Brust. Der übrige Teil des Körpers bestand aus einem Behang aus bronzefarbigen Federn. Nicht minder zierte den Hahn der hoch geschwungene, mit tiefblau glänzenden Federn geschmückte Schweif.
Der Hahn wurde als Symbol bei manchen Feierlichkeiten benutzt. Auch bei Haus- und Scheunenrichtfesten durfte der Hahn auf der Spitze des Kranzes, der beim Umzug im Dorf von zwei Jungfrauen zum Takt der Musik getragen wurde, nicht fehlen. Er war aus Pappe geschnitten und mit Goldschaum bedeckt.
Die Hähne waren aber auch die Ritter im Dorf. Sie blieben nicht in ihrem Heim, sondern passierten andere Höfe und befehdeten stets einander. Ergötzlich war solch ein Duell anzusehen, wenn man es nicht vorzog, sie auseinander zu scheuchen. Wenn die beiden kampfbereiten Hähne sich forderten, gingen beide etwa 15 Schritte rückwärts auseinander. Auf ein beiderseitiges Zeichen, indem sie sich aufbauschten, flogen sie gegeneinander. Das Ziel war ein Teil des Kammes. Beim ersten und zweiten Anflug wurde er gewöhnlich verfehlt, indem sie gegeneinander abpurzelten. Die Hähne, je der seinen Platz wieder einnehmend, wiederholten den Anflug solange, bis einer, der einen schmerzlichen blutenden Hieb erhalten hatte, um die Ecke lief. Der Gewinner flog auf den höchsten Gegenstand, der in der Nähe war, und verkündigte seinen Sieg durch kräftiges Schreien.
Der Hahn war auch ein willkommener Gast im Hause, da er morgens den nahenden Tag durch sein lautes Krähen ankündigte. Die Hähne krähten morgens pünktlich um drei Uhr. Dann jede Stunde, so pünktlich und zuverlässig, dass man annehmen sollte, vor Jahrtausenden sei die Tageszeit danach eingeteilt worden. Dem Großknecht auf dem Hofe kam das Krähen morgens sehr zustatten, da derselbe derzeit der erste auf den Beinen war im Haus. Er hatte für Licht und Feuer zu sorgen, und er musste das Futter für die Pferde auf der Handlade, dem Zappelbock, schneiden. Dann oblag ihm noch das Wecken des übrigen Gesindes.
Überhaupt war das damalige Hühnervolk sehr rührig. Die Hühner flogen mehr, als sie gingen. Wurden sie ausnahmsweise mal gefüttert, so kamen sie auf den Zuruf nicht angelaufen, sondern über Zäune und Hecken angeflogen. Auch die Hühner untereinander stritten sich oft. Sie bauschten sich auf und flogen kerzengerade voreinander hoch. Augen in Auge tobten sie durch Schnabelhiebe ihren Sinn aus, bis sie sich blutig verließen.