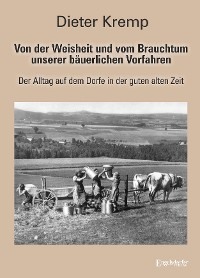Kitabı oku: «Von der Weisheit und vom Brauchtum unserer bäuerlichen Vorfahren», sayfa 7
Als der „Grombierekewwer“ noch von Schulklassen auf den Kartoffelkäfern abgesammelt wurde.
Der 9. Juni 1938 war ein denkwürdiger Tag in Hoof im Ostertal. Da erscheint die erste Fundmeldung über den Kartoffelkäfer auf der Gemarkung Hoof. Es heißt in der Schulchronik in Hoof: „An dem außerordentlich bekannten Kartoffelkäfersuchtag beteiligte sich auch unsere Schule. Die Suchzeit war auf den Vormittag festgesetzt und dauerte von 7 bis 9 Uhr. Die ausgefallenen Stunden wurden am gleichen Tage nachmittags nachgeholt. Drei Schüler fanden den Käfer, der staunend betrachtet wurde.“
Doch schon am 19. Juni 1934 erschien in der Hoofer Schulchronik zum erstenmal eine Eintragung über eine Kartoffelkäfersuche: „81 Schüler der Jahrgänge vier bis sieben unter Schulamtsbewerber Gilcher suchten Kartoffelfelder ab. Ergebnis: Keine Funde!“ Ein Jahr später, am 18. September 1935, erscheint eine Notiz im Schultagebuch: „Auf die Gefahr des Kartoffelkäfers hingewiesen!“ Im Juni und Juli 1936 fanden Feldbegehungen mit Absuchen der Kartoffelfelder statt, doch wurden damals noch keine Käfer gefunden.
Bei allen Einbrüchen des Käfers in Mitteleuropa wurde er erfolgreich bekämpft. Befallene Kartoffelfelder wurden mit Petroleum übergossen und alle Pflanzen restlos verbrannt. Doch 1922 fasste der Schädling endgültig Fuß auf dem europäischen Festland. Er trat bei Bordeaux in Westfrankreich bereits in einem Ausmaß auf, das seine restlose Vernichtung praktisch unmöglich machte. Von da an eroberte der Kartoffelkäfer in 15 Jahren ganz Frankreich. Um ein Übergreifen auf Deutschland zu verhindern, setzte man 1935 an der deutschen Westgrenze den Kartoffelüberwachungs- und – abwehrdienst ein. In zwölf von deutschen Gemeinden befiel er in jenem Jahr 18 Kartoffeläcker.
Seinen Erfolgszug hat der Kartoffelkäfer seiner Signalfarbe und einem übelriechenden Sekret, das er bei Gefahr ausscheidet, zu verdanken. Zudem hatte sich die heimische Vogelwelt noch nicht auf den Fremdling eingestellt. Ich erinnere mich, wie ich als kleiner Junge in den Jahren kurz nach dem Krieg mit unserer Schulklasse „Grombierefelder“ absuchte, um damit dem gehassten Schädling den Garaus zu machen. „Grombiere“ kommt von „Grundbirnen“, wie die Kartoffel nach ihrem ersten Anbau im Jahre 1650 in Deutschland noch genannt wurde. Und der Kartoffelkäfer war dann später eben der „Grombierekewwer“.
Wir Schüler gingen in Reih und Glied nebeneinander die Furchen des Kartoffelackers ab, schauten genau auf und unter die Blätter, um den gefräßigen Schädling zu finden. Jeder von uns hatte eine kleine Dose in der Hand, worin die Käfer und ihre Larven gesammelt wurden. Waren wir am Ende des Feldes angelangt, dann machte unser Lehrer ein Feuer, übergoss es mit Öl, und die Käfer wurden verbrannt.
Ich weiß auch noch, welche Mär die Nazi-Propaganda in den Kriegsjahren verbreitete. Demnach hätten die Amis aus ihren Flugzeugen die Käfer auf die Kartoffeläcker abgeworfen. Das war natürlich nicht war. Ganz schlimm war es dann, als in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts das erste chemische Schädlingsbekämpfungsmittel auf den Markt kam. Es war ein hochgiftiges weißes Puder, das wir auch in den Garten auf die Kartoffelbeete streuten. Aber wir wussten das ja noch nicht. Wenn wir dann im Herbst die Kartoffeln aßen, schmeckten sie ganz unangenehm nach dem Pudergift.
Übrigens erscheint in einer Notiz in der Pfarrchronik in Niederkirchen im Ostertal, dass die „Grundbirnen“ erst 1731 bei uns hier angebaut wurden.
Von Bauerntrachten im Dorf
Der Bauer im Ostertal trug ehemals im Sommer einen blauen Leinenkittel. Dieser war selbst gesponnen, gewebt, gefärbt und genäht. Als Kopfbedeckung diente eine Zipfelmütze. Im Winter trug der Bauer ein kurzes Wams aus Wollstoff. Die Mütze („Kapp“) war ebenfalls aus Wollstoff, schön gewattet und mit einem Glanzlederschirm versehen. Solche Mützen aus schönem blauem Wollstoff wurden selbst am Hochzeitstag getragen. Das Hemd war aus Leinen gewebt. Es trug angenähte „Vatermörder“. Als Halsbinde diente ein großes, seidenes Tuch, das um die Vatermörder herumgeschlungen und mit einem Knoten befestigt war.
Die Hosen (Latzhosen) waren ganz früher bis zum Knie reichend, später lang. Sie wurden durch einen Gürtel festgehalten, später dann durch Hosenträger, die den Spottnamen „Galljer“ (Galgen) bekamen. Bei Hochzeiten und anderen feierlichen Anlässen trug der Hausvater einen langen, schwarzen Rock. Auch Holzschuhe wurden vielfach im Winter getragen. Die Frauen trugen ein ärmelloses Leibchen, das unten mit einem Wulst versehen war, worüber die langen, faltigen Röcke befestigt waren. Über das Leibchen kam eine dunkle Jacke. Des Sonntags bediente man sich eines größeren, farbigen Halstuches, das als Dreieck den Rücken bedeckte.
Unsere Großmütter vergaßen im Winter gewiss nicht die dicken, gesteppten Wattröcke, während im Sommer ein dünner Unterrock genügte. Der Oberrock war gewöhnlich auch dünn und mit Blümchen bedruckt. An Festtagen war das Tragen einer sogenannten „Doppelschal“, eines großen schwarzen Halstuchs, das, doppelt übereinandergelegt, mit der Spitze den Boden fast berührte und den ganzen Rücken bedeckte. Zur Vervollständigung der Tracht durfte im Sommer die weiße und im Winter die schwarze Haube nicht fehlen.
Das alte Bauernhaus
Die alten Bauernhäuser waren zweistöckige Einhäuser, also Bauten, bei denen sich Wohnung, Stall und Scheune, unter einem Dach befanden. Sie kehrten der Dorfstraße die Längsseite zu, waren vom Sockel bis zum Dach aus Bruchsteinen gebaut und zum Schutze gegen Verwitterung mit Mörtel verputzt. Vereinzelt sah man auch, dass die Wetterseite außerdem noch mit Teer gestrichen oder mit Blech oder Brettern geschützt war. Gedeckt waren die Häuser zumeist mit Biberschwänzen. Der Torbogen der Scheune war gewöhnlich halbkreisförmig. Die Einfassungssteine der Türen und Fenster waren einfach und doch schön. Besonderen Schmuck wies in der Regel nur der Türsturz auf. Er zeigte die Anfangsbuchstaben der Namen des Hauserbauers und seiner Ehefrau, ferner das Erbauungsjahr und manchmal auch einen stilisierten Baum oder eine Blume.
Das Haus machte wirklich einen gediegenen Eindruck, wenn die Einfassungsmauern von Türen, Fenstern und Scheune geweißt oder farbig gestrichen waren. Belebt und gegliedert wurde der lange bau oft durch einen am Hause sich emporrankenden Rebstock. Geranien- und Fuchsienstöcke zierten im Sommer die Fenster; ein mächtiger Hofbaum, eine Linde oder ein Walnussbaum, beschattete das Haus. Unter dem Baum war der Amboss, auf dem im Sommer über zu den Erntezeiten die Sensen gedengelt wurden. Weniger schön war der Misthaufen vor dem Haus. Toiletten im Innern des Gebäudes gab es noch nicht, da war auf dem Hof ein sogenannter „Plumpsklo“ eingerichtet, in dem Zeitungspapier zum Abputzen des Hinterns immer bereitlag. Im Winter bei strenger Kälte war es nicht leicht sein „Tagewerk“ hier zu verrichten. Neben der Dungstätte war Platz für den Wagen, daneben stand der Pflug. Dazwischen tummelten sich die Hühner und Gänse und bevölkerten den Hof. Hinter dem Hause war der Bauerngatten, der vor allem der anheimelnde Ort der Bäuerin war. Auch neben dem Garten stand oft ein Walnussbaum, unter dem eine Ruhebank war: eine gemütliche Stätte der Erholung an lauen Sommerabenden. Oft grenzte eine einfache Laube den Garten ab.
Überall gleich war auch die innere Einteilung des Hauses. Die Entwicklung haben wir und wohl so zu denken, dass die ersten sesshaft gewordenen Bewohner unserer Heimat nur eine Hütte mit einem fensterlosen Raum und einem offenen Rauchfang bauten. Zum Aufbewahren der Vorräte bedurften sie eines Kellers und eines Speichers. Nach der Zähmung von Tieren wurde ein Stall angegliedert. Zum Unterbringen der Wintervorräte für diese Tiere wurde der Anbau einer Scheune an den Stall erforderlich. Die zunehmende Kultur verlangte mehrere Wohnräume. So entstanden dann neben der Küche Stube und Kammern.
Die Küche war der Mittelpunkt des Bauernhauses unserer Vorfahren. In ihr flackerte früher unter dem großen Rauchschornstein ein offenes Herdfeuer.
Hausbau und Richtfest
Im Dorf wurde früher ein Haus von allen gemeinsam und unentgeltlich gebaut, selbst die Kinder halfen und reichten Ziegel zu und bekamen als Dank eine Hausbrezel. Ein Haus gehörte Generationen lang derselben Familie, und deshalb tat der Hausherr den ersten Spatenstich beim Bau, schlug den ersten Pfahl ein, legte den Grundstein, oft einen Bruchstein, den er selbst herbeigeschleppt hatte und schlug im First den ersten Nagel ein.
Eine kleine Messe war in manchen katholischen Gegenden der Beginn der Arbeit, auf jeden Fall knieten die Hausleute auf dem untersten Balken und baten um Segen beim Bau und für das Leben in diesem Haus.
Das Richtfest war ein Dank für alle, die beim Bau geholfen hatten. Im Dorf wurden früher von den Nachbarn Geschenkkörbe zum Richtfest ins Haus geschickt ; wer genug Geld hatte, lud selber alle ein.
Der Bauherr wurde acht Tage vor dem Richtfest von den Kindern im Dorf gefragt, ob er feiern wolle, dann machten sie ihm das Krönchen.
Das Richtfest wurde gefeiert, sobald das Dachgebälk aufgerichtet war. Auf die höchste Spitze des Hauses setzten die Zimmerleute dann ein bunt geschmücktes Tannenbäumchen oder brachten den Richtkranz an. Das erinnerte an den Maien, den grünen Birkenzweig, der dem Haus mit seiner Fruchtbarkeit und Lebenskraft Segen bringen sollte.
Das Richtkrönchen war oft geschmückt mit Bändern, seidenen Tüchern, Schnupftüchern, Pfeifen, Brezeln, Münzen oder Blumen. Manchmal hingen auch noch ein Glas und eine Flasche Wein am Richtbaum, und wenn der Zimmermann auf das Dach stieg und seinen Segensspruch gesagt hatte, trank er e in Glas Wein auf das Wohl des künftigen Hausbesitzers und seiner Familie. Dabei gab es allerhand Aberglauben: In Schlesien musste der Zimmermann den Wein in drei Zügen austrinken und danach musste er das Glas auf den Erdboden werfen, weil man einen Gegenstand, den man für eine Weihe benutzt hatte, im Alltagsleben nicht mehr benutzen sollte. Deshalb brachte es Glück, wenn das Glas zersprang.
Wenn der Richtkranz reich behängt war, so warf der Zimmermann das Gebäck oder die Brezeln für die Kinder hinunter, pflückte Tücher und Münzen ab und brachte sie mit hinunter, wo sie denen, die beim Bauen geholfen hatten, verteilt wurden: wenn ein Bursche einem Mädchen eins von den Seidentüchern geschenkt hatte und es dieses sich gleich umband, so war das ein Zeichen dafür, dass es den ganzen Abend lang seine Tanzpartnerin sein wollte.
Wenn Kinder den Richtkranz geschmückt hatten, so liefen sie mit den Sachen herum und versuchten, sie gegen Geld oder Essgeschenke einzutauschen.
Das Essen beim Richtfest war früher so ausgiebig, wie man es sich leisten konnte. Manche luden schon zum Frühstück mit Weißbrot und Butter ein, mittags gab es Fleisch und Bohnen, als Nachtisch Eierstich, Kaffee und Kuchen, dazwischen immer Schnaps und Brezeln für die Kinder. Es wurden auch gerne Erbsensuppen und deftige Eintöpfe serviert.
Das Fest am Abend eröffnete der Zimmermann; er tanzte mit der Kranzjungfrau, dann gab es ein Abendessen, Tanz und Schnaps.
Am ersten Sonntag nach dem Einzug wurden Verwandte und Nachbarn zum Kaffee eingeladen.
Der Einzug fand meistens in einem festlichen Rahmen statt. Freunde oder Nachbarn umkränzten die Tür, ein Nussbaum wurde vorm Haus gepflanzt, weil er vor dem Blitzschlag schützen sollte. Im Garten wurde ein Apfelbaum gepflanzt, am Hausgiebel ein Holunderstrauch, die lebendige Hausapotheke unserer Vorfahren.
Freunde oder Nachbarn backten ein Brot und trugen es mit Salz über die Schwelle, was Segen für das Haus bedeutete und vor Hunger schützte.
Beim Überreichen des Richtkranzes wurde immer ein Segens- oder ein Heischegedicht gesagt, und wenn der Zimmermann oder seine Kameraden geschickt im Reimen waren, so grüßte er die versammelte Gesellschaft der Handwerker, Nachbarn und Freunde mit einem schönen Gedicht.
Der Einzug in das neue Haus und die damit verbundenen Bräuche
Sehr tief verwurzelt ist im Volksglauben die Vorstellung, dass den, der als erster ein neu errichtetes Gebäude betritt, ein Unglück treffen wird. Merkwürdig dabei ist, dass das Haus nur dieses einzige Mal dämonische Züge an den Tag legt und erst, wenn es völlig fertiggestellt ist. Dieser Fluch betrifft somit in keiner Weise die Handwerker, die unablässig am Haus beschäftigt waren. Sie können ihre Arbeit in aller Ruhe ausführen; der Fluch, so glaubt man, kann nur die neuen Bewohner treffen. Das fertiggestellte Haus muss also feierlich eingeweiht werden, so wie der Grundstein zu Baubeginn geweiht werden musste. Nun, da das Haus fertiggestellt und von außen an verschiedenen Punkten durch Zeichen und Gegenstände geschützt ist, muss man, so scheint es, eine Art Blutzoll entrichten, um es auch von innen benutzen zu können. Anlässlich des Einzugs werden nun eine ganze Reihe von Riten notwendig, die, ähnlich wie bei Baubeginn, mit einem Opfer eingeleitet werden. Das der Teufel sich der Seele des Wesens bemächtigt, das als erstes ein neues Haus betritt, musste man ihm ein Opfer darbringen, um die zukünftigen Bewohner des Gebäudes zu schützen. Man ließ deshalb eine Katze ins Haus hin einlaufen und schloss sie darin ein, bis sie verhungert war und damit den Fluch auf sich gezogen hatte. War das Haus so durch den Opfertod geweiht, konnte man unbesorgt einziehen. Mit diesem lange Zeit üblichen Brauch verbinden sich Sagen vom geprellten Teufel, der sich mit diesem Tier – das konnte auch ein Hund oder ein Hase sein – begnügen musste, während er doch auf ein menschliches Wesen gelauert hatte. Aber häufig reichte es keineswegs aus, dass das Tier ins Gebäude hineinlief. Fast immer war ein Blutopfer erforderlich. Für gewöhnlich musste ein Hahn, eine schwarze Henne oder eine Ente diesen Tribut darbringen. Man hackte ihnen auf der Hausschwelle den Kopf ab und besprengte mit ihrem Blut die Mauern oder den Boden rund um das Gebäude. Das so geopferte Tier wurde meistens verzehrt. Es bestand auch der Brauch, dass ein schwarzes Huhn, bevor man es schlachtete, mit zusammengebundenen Beinen und Flügeln über das Hausdach zu werfen. Offensichtlich wollte man den Dämon vom Haus entfernen, indem man das Opfertier oder einen Teil davon außerhalb des Hauses fortwarf. In manchen Fällen konnte man sich das Tieropfer sparen, indem man ein bebrütetes Ei zerschlug.
Für gewöhnlich schlachtete man Hahn, Huhn oder Ente auf der Hausschwelle, doch konnte man diese Opferung auch auf der Steinplatte vor dem Feuer vollziehen. Der Herd als Symbol des Familienlebens wurde durch dieses Blut gegen jeden Angriff des Bösen immunisiert. In den Gegenden, in denen die Reinigung des Herdes durch das Blut nicht üblich war, begnügte man sich damit, ein paar Tropfen Weihwasser darüberzusprengen, bevor man das erste Feuer darin entzündete. Aber im allgemeinen besprengt man das ganze Haus sowohl von innen wie außen herum mit Weihwasser, um alle dämonischen Kräfte daraus zu vertreiben. Dieser Brauch muss wiederholt werden, falls das Haus aus irgendeinem Grund längere Zeit hindurch unbewohnt war, falls sich ein Unglück darin ereignet hat und vor allem natürlich, falls man glaubt, dass es darin spukt. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch und noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein wird das Weihwasser erst in zweiter Linie, nach den anderen reinigenden Elementen, eingesetzt.
Auf jeden Fall fanden die Riten zur Hauseinweihung ihren Abschluss in einem Festmahl, zu dem sich die Familie und ihre Freunde zusammenfanden. Das Opfertier wurde häufig bei dieser Mahlzeit verzehrt. Der Festschmaus, den man zur Feier der ersten Aufhängung des Kesselhakens ansetzt, ist ein Symbol für die offizielle Inbesitznahme der Räumlichkeiten durch die neuen Bewohner. Der Kesselhaken ist somit Symbol für die endgültige Übernahme des Hauses. Sein geweihter Charakter wird noch deutlicher, wenn man ihn gen Himmel wirft, in Richtung auf die Wolken, um das Unwetter zu vertreiben.
Räumte man Möbel und Hausrat ins neue Haus ein, so musste man dabei eine gewisse hierarchische Ordnung beachten. Zum Beispiel musste vor allen anderen Dingen Brot und Salz ins Haus hineingetragen werden. Das Salz, das man im übrigen in allen häuslichen Riten verwendet, um die Dämonen zu vertreiben und um den bösen Blick abzuwenden, schützt hier das Brot, das früher das wichtigste Nahrungsmittel des Bauern war und zugleich besondere Verehrung genoss, weil es zeigte, dass die Arbeit des Menschen Gottes Zustimmung gefunden hatte.
Der eigentliche Einzug mit dem gesamten Mobiliar war mit einer ganzen Reihe von Bräuchen verbunden, die noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts eingehalten wurden. Bei einem frisch verheirateten Paar war der Augenblick, in dem der Schrank ins Haus getragen wurde, der in Zukunft stets alle kostbaren Gegenstände der Familie bergen würde, von einem ganzen aufwendigem Ritual begleitet, an dem die engsten Freunde teilnahmen. Dieses Möbel, das von nun an einen wichtigen Platz im Leben der Familie einnehmen würde, wurde mit großem Beifall empfangen und feierlich an seinem endgültigen Platz aufgestellt.
Von der Errichtung bis zur endgültigen Inbesitznahme eines Gebäudes muss ein ganzer Komplex von mehr oder weniger wichtigen Riten beachtet werden, die nicht nur die jeweilige Familie angehen, sondern auch die meisten Dorfbewohner. Die Einfügung eines neuen Gebäudes in die dörfliche Siedlung darf nicht das Gleichgewicht stören, in das dieses bereits bestehende Gebilde eingebunden ist. Auf keinen Fall darf dieses neue Gebäude als völlig selbstständiges Gebilde betrachtet werden; es steht in unmittelbarer Abhängigkeit von den anderen Häusern, so wie von ihm wiederum eine gewisse Wirkung auf das Dorf ausgeht.
Zwei alte Bräuche zeigen sehr gut die Wechselbeziehung zwischen den Häusern und natürlich mehr noch die zwischen den einzelnen Familien. Der erste betrifft die jährliche Segnung der Häuser. Kein einziges Haus durfte dabei ausgelassen werden, weil sonst das ganze Dorf darunter hätte leiden müssen. Man konnte deshalb nicht zulassen, dass sich auch nur ein einziger Dorfbewohner nicht an die Regel hielt. Der zweite Brauch war noch zu Anfang des 20.Jahrhunderts lebendig. Sobald ein Haus fertig gestellt war, fanden sich in der Nacht zum Sonntag eine Reihe von Freunden der Besitzer vor dem Haus zusammen, gaben unter den Fenstern des Hauses einige Gewehrschüsse ab und fragten die Bewohner, ob sie einen Scheiterhaufen wollte, Am darauffolgenden Sonntag errichtete man vor der Haustür einen Holzhaufen, aus dem ein langer Mast herausragte; man setzte ihn in Brand, und alle Bewohner des Dorfes tanzten darum herum. Diese Willkommenszeremonie für die neuen Dorfbewohner zeigt sehr gut die Bedeutung, die der Aufnahme neuer Mitglieder in die Dorfgemeinschaft beigemessen wurde.
Gegenstände mit schützenden Eigenschaften im und am Bauernhaus sowie heilige Tiere und Pflanzen
Das Tier, ob domestiziert oder wild, ob nun fern vom Haus oder mehr oder weniger ständig darin wohnend, fungiert im Alltagsablauf unserer bäuerlichen Vorfahren als Träger von Zeichen, als Todes- oder Freudenbote. Der Bauer teilte die magisch bedeutsame Tierwelt in die glückbringenden Tiere und andererseits in die unheilbringenden Tiere ein.
Katze, Kröte und Kauz gelten in den volkstümlichen Vorstellungen als Unglücksbringer. Zu allen Zeiten glaubte man, dass vor allem die schwarze Katze vom Bösen besessen sei. Sie war das Tier des Teufels, das Tier, das bei den Sabbaten zugegen ist. Auch ist das Erscheinen einer Katze unter gewissen Umständen ein unheilbringendes Vorzeichen. Die Hauskatze ist in gewisser Weise der gebannte Zauber, der gezähmte Dämon. Ein Aufnahme- und Reinigungsritus erlaubt, sie ins Haus und in den Familienkreis aufzunehmen. Wie dem auch sei, die Katze symbolisierte in den meisten Gegenden die Seele des Hauses. Ihr Tod, vor allem wenn er sich im Innern des Hauses ereignet, wird als Vorzeichen großen Unglücks für die Familie betrachtet. Die ambivalente Natur der Katze spiegelt sich auch in dem zwiespältigen Schicksal, das ihr bestimmt ist. Selbst wenn sie ins Haus hineindarf – sie ist häufig das einzige Tier, dem dies erlaubt wird – bleibt sie dennoch eines der Tiere, die beim Hausbau und bei rituellen Festen geopfert wird. Noch im späten Mittelalter wurden Katzen oft in das Johannisfeuer geworfen. Mit Hunden ging man meist glimpflicher um. Nur der schwarze Hund flößt echte Furcht ein. Man empfahl, einen solchen Hund zu töten und mit seinem Blut die Mauern des Hauses zu besprengen, aus dem man die Dämonen vertreiben wollte.
Der Hahn, Symbol der Wiederauferstehung und der Wachsamkeit, von dessen morgendlichem Krähen man glaubte, dass es die Dämonen und die Geister der Nacht vertreibe, fand man häufig als Wetterhahn nicht nur auf Kirchtürmen, sondern auch auf Bauernhäusern.
Ein Unglücksbringer ersten Ranges ist die Kröte. Sie ist das verfluchte Tier schlechthin, das Tier der Schatten, das Tier des Teufels, der sich den Menschen häufig in dieser Gestalt präsentiert. Es gab den Brauch, eine Kröte unter der Schwelle des Hauses einzumauern. Die Kröte war auch ein wichtiger Bestandteil der unheilvollen Absude und Tränke der Hexen, zum anderen aber auch bedeutsam für die Behandlung von Rheuma oder Geschwüren. Man band sie lebend auf das erkrankte Körperteil; zur Fieberbekämpfung schloss man sie in einem kleinen Säckchen ein, das man um den Hals trug.
Die schwarzen Vögel, Rabe und Elster, hatten unter den magischen Tierbräuchen zu leiden. Ihre Opferung – sie wurden im allgemeinen mit einem Bein an einer Kordel in der Mitte des Hofes aufgehängt – entspricht dem tödlichen Drama, das sie mit ihrem Erscheinen in der Nähe des Hauses angeblich ankündigen.
Der Storch und die Schwalbe dagegen – die man auch Gotteshuhn nannte – galten überall als Symbole für Wohlergehen, Glück und Erfolg von Haus und Hof. Ihre regelmäßige Rückkehr zur schönen Jahreszeit, ihre Treue zum Nest mögen der Grund für diese Vorstellungen sein. Sie waren die vom Volk verehrten Tiere schlechthin, man schützte sie und half ihnen, sich auf dem Bauernhaus niederzulassen. Besonders dem Storch sagte man nach, dass er um jeden Preis die Tugend der Hausfrau schütze, wenn es sein muss, auch gegen ihren Willen. Storch und Schwalben symbolisieren auch die soziale Eintracht, die Dauerhaftigkeit der Beziehung des Paares.
Das Ei genoss bei unseren bäuerlichen Vorfahren im religiösen Brauchtum ganz besondere Verehrung. Es steht im magischen Arsenal der traditionellen bäuerlichen Welt an vorderster Stelle. Es ist ein Werkzeug des Hexers, der sich seiner bedient, um die Ernten zu zerstören: findet man zerschlagene Eier an den Rändern eines verwüsteten Feldes, so darf man Hexenwerk darin sehen. Aber das Ei stellt seine Macht auch in den Dienst des Guten: Je nach Gegend, glaubt man von den Eiern, die am Gründonnerstag oder am Himmelfahrtstag gelegt worden sind, dass sie niemals faulen und mit zuverlässiger Gewissheit Gewitter, Feuersbrunst, Krankheiten und Zauberei abwenden. Damit sie diese schützende Rolle übernehmen konnten, legte man sie aufs Fenstersims, in einen Türwinkel oder man fügte sie gar ins Mauerwerk ein.
Das Hufeisen gehörte wie der Spiegel oder die Nägel zu den magischen Hilfsmitteln, die das Haus vor den Übergriffen des Bösen schützen sollten.
Pflanzen hatten seit jeher eine schützende oder heilende Kraft. Die Haus- oder Dachwurz, auch Donnerwurz genannt, und all die kleinen, ihr verwandten Fettgewächse, wie etwa auch der Mauerpfeffer, bewahren seit undenklichen Zeiten die Gebäude und besonders die so gefährdeten Strohdächer vor Gewitter. Die Distel, die Sonnenpflanze schlechthin, eine magische und dekorative Pflanze, nagelte man in Berggegenden häufig an die Haustüren. Die Ährenbüschel wiederum, die zu kreuzen gebunden über den Scheunentoren, über dem Rauchfang oder gar über dem Ehebett als Glücksbringer und Unterpfand für künftige Ernten hängen, sind eine echte Opfergabe an die Mächte der Natur.
In vielen Gegenden genossen die in der Johannisnacht (24. Juni) gesammelten Pflanzen eine besondere Verehrung. Aufgrund ihrer ausgeprägten magischen Kraft werden Farn, Nussbaumblätter und vor allem Johanniskräuter deshalb zu Kränzen geflochten, gebündelt und über den Türen und Fenstern des Hauses aufgehängt, sowie in Scheunen und Ställen. Die katharische Kraft des Johannisfeuers, über das die ganze Dorfbevölkerung in der Johannisnacht sprang, erstreckte sich übrigens auch auf die Herdentiere; in manchen Gegenden rieb man den Schafen oder den gehörnten Tieren mit der Asche des Scheiterhaufens die Seiten ein. Die Wirksamkeit des zur Sommersonnenwende verbrannten Holzes ist auch dem zur Wintersonnenwende verbrannten eigen. Als Mittel gegen Gewitter pflegte man auch Johanniskräuter ins Feuer zu werfen und sie an Scheunen aufzuhängen.
Seltsamerweise soll der Maibaum, den man in den Mist stellt, die Schlangen vertreiben können. Man sagte: „Er hindert die Schlangen, den Kühen die Milch abzusaugen.“
Es gab auch eine Reihe von Gegenständen, die man mit großem Respekt behandelte. Auf den ersten Blick unerklärbar erscheint die Gleichsetzung der Steinaxt oder der Pfeilspitze mit Donner und Blitz. Doch trug bei den Germanen schon Thor, der Donnergott, Sohn Odins, diese Axt. Man glaubte lange Zeit hindurch, dass der Donner durch den Zusammenprall zweier kugelförmiger Steine aus konzentriertem Staub entstehe, und dass die so seltsam geformten Steine als Überbleibsel dieses „Unfalls“ auf die Erde herabfielen.
Ebenso wie das prähistorische Werkzeug als Gegenstand gedeutet wird, der die verschiedensten magischen Eigenschaften besitzt, unterlegt man in manchen Fällen auch den Werkzeugen und Geräten des täglichen Lebens apotropäische Eigenschaften. So stellte man vielerorts, wenn ein Gewitter drohte, eine Sense mit der Schneide gen Himmel gerichtet auf die Schwelle des Hauses, um es vor dem Blitz zu schützen; in manchen Gegenden nahm man dafür eine Axt. Man muss in diesem Fall hervorheben, dass diese Werkzeuge, abgesehen davon, dass sie aus Eisen, dem magischen Metall, sind, einen speziellen Symbolcharakter haben. Die Sense ist das Zeichen des Todes und die Axt das Utensil des Donnergottes.
Der Holzschuh war seit eh und je eng mit der Fruchtbarkeitsvorstellung verbunden, deswegen befestigte man ihn auch am Hochzeitsbaum. Jene Holzschuhe, die man so häufig aufgehängt an den Hauseingängen findet, sind vielleicht die Hochzeitsschuhe, die das Paar sorgsam bis zur Geburt des ersten Kindes aufbewahrt und sogar weitervererbt.
Das Rad ist seit den frühesten Zeiten der Menschheit ein Sonnensymbol. Es war auch früher Bestandteil vieler bäuerlicher Bräuche. Das Wagenrad wurde früher häufig an Bauernhäusern als zusätzliche Hofeinfassung benutzt. Manchmal waren es regelrechte Zäune aus Wagenrädern, die den Hof eingrenzten.
Ein sehr geachteter Beruf war früher der Hufschmied, und so ist es auch wohl zu verstehen, dass das Hufeisen ein Glückssymbol darstellte. Es zierte die Wände der Bauernhäuser – auch Schutzzeichen, die in die Mauern eingemeißelt wurden.