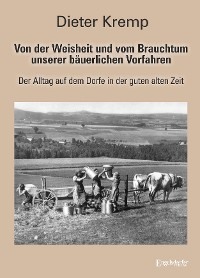Kitabı oku: «Von der Weisheit und vom Brauchtum unserer bäuerlichen Vorfahren», sayfa 8
Sitten und Bräuche der Volksgemeinschaft im Wandel eines Jahres
Gehen wir die vier Jahreszeiten durch, so stoßen wir immer wieder auf Ruhe- und Haltepunkte, die Volksfeste, deren Verlauf sich in altgewohnten Formen bewegt.
Der Jahreswechsel ist nicht nur ein Markstein im Leben des einzelnen, sondern auch im Leben der Dorf- und Volksgemeinschaft. Nach dem Abendgottesdienst, in dem Gott der Dank für die Wohltaten des abgelaufenen Jahres gespendet wird, begibt sich der größere Teil der Jünglinge und Männer in die Wirtschaft. Wenn die Kirchenglocken das neue Jahr einläuten, wünscht man sich gegenseitig Glück und Gesundheit im neuen Jahr. Die jungen Burschen haben schon rechtzeitig vorher die Dorfwirtschaft verlassen, um ihrer Braut „das neue Jahr anzuschießen“. Auf die drei Schüsse folgt ein Spruch, der folgendermaßen lautet: „Ich wünsche euch ein glücklich neues Jahr, neues Glück und neues Leben, darauf soll es Feuer geben.“
Die Kinder wünschen ihren Eltern und ihren Paten am nächsten Morgen das neue Jahr an mit folgenden Worten: „Guten Morgen im neuen Jahr! Euch wünsche ich ein glückseliges neues Jahr, lang zu leben und glücklich zu sterben und den Himmel zu erwerben.“
Es gibt aber auch den Neujahrsspruch: „Ein glückselig neues Jahr, eine Brezel wie ein Scheunentor, ein Lebkuchen wie eine Ofenplatt, dann essen wir uns alle satt.“
Die Paten schenken ihren Patenkindern eine große Brezel oder einen Kranzkuchen. Die Leute, die sich auf der Straße begegnen, rufen sich zu: „Prost Neujahr!“ oder „Viel Glück im neuen Jahr!“
In manchen Gegenden hat sich der Brauch des „Dreikönigssingens“ oder des „Sternsingens“ bis heute noch erhalten. Ein wichtiger Tag im Leben des Bauern ist der 2. Februar, Mariä Lichtmess. Dieser Tag ist für ihn das Ende der Winterarbeit. Ein alter Bauernspruch lautet: „Mariä Lichtmess, das Spinnen vergess!“
Maria Lichtmess war in katholischen Gegenden früher ein allgemeiner Feiertag, an dem die Kerzen geweiht wurden. Zu gleicher Zeit segnete der Priester den Hals der Gläubigen, weil am 3. Februar der Tag des Heiligen Blasius ist, dessen Fürsprache gegen Halskrankheiten schützen soll.
Im Februar beginnt auch die Fastenzeit. Ihr voran gehen Maskenfeste, Maskenumzüge am Fastnachtssonntag. Die Kinder laufen an den Fastnachtstagen verkleidet, „verboozt“, auf der Straße herum. Der größte Trubel herrscht am Fastnachtsdienstag in den Wirtschaften. Am Aschermittwoch wird in vielen Dörfern die „Fastnacht begraben“. Die Burschen ziehen mit einer Strohpuppe, der Fastnacht, durch das Dorf, abwechselnd Trauerlieder oder lustige Litaneien singend. Dann wird auf einem freien Platz vor dem Dorfe eine Leichenrede gehalten und die Puppe unter großem Hallo verbrannt. In ähnlicher Weise wird auch mancherorts die „Kirmes begraben“. Während der Fastenzeit herrscht im Dorf große Stille.
Neues Leben bringt erst der Palmsonntag, wenn in der Kirche „Palmen“ (Buchsbaum) geweiht werden. Manche Bauern stecken noch heute einen geweihten Palmzweig in die Scheune, in den Stall oder auf jedes seiner Ackerstücke. Als Vorbote des Osterhasen erscheint dann auch der „Palmhase“, der den Kindern in ein vorbereitetes Nest seine im Kaffee gefärbten Eier legt.
Vom Gründonnerstag ab läuten die Kirchenglocken nicht mehr, es sei denn, es ist im Dorf jemand gestorben. Die Glocken „sind in Rom“ und kehren erst am Ostersonntag wieder zurück. Die Gläubigen müssen daher auf andere Weise vom Beginn des Gottesdienstes in Kenntnis gesetzt werden. Dies besorgen die „Klepperbuben“. Mit Holzklappern laufen sie durchs Dorf und rufen: „Wer in die Kirche geht, der läuft jetzt.“ Wenn das Kleppern am Ostersamstag zu Ende ist, gehen die Klepperbuben von Haus zu Haus, sammeln Eier und Geld ein und verteilen die Gaben unter sich. Dann kleppern sie noch einmal am Ostersonntag morgen s in der Frühe und rufen dazu im Sprechchor: „Auf – auf! Zum heiligen Grab!“
In der Nacht vom Ostersamstag auf Ostersonntag kommt der Osterhase und bringt den Kindern die Ostereier.
Nun ist die Fastenzeit zu Ende und frohe Feste können wieder beginnen. In der Walpurgisnacht, der Hexennacht, der Nacht zum 1. Mai, ist der Dorfjugend reichlich Gelegenheit geboten, sich übermäßig auszulassen. Türen werden ausgehängt, Pflüge, ja selbst ganze Kleinwagen auf die Dächer gesetzt, Puppen in den Hausflur gestellt und ähnlicher Hexensabbat getrieben. In einigen Ortschaften errichten die Burschen ihren Liebsten in der Walpurgisnacht Maibäume, in anderen Orten wiederum schmücken sie die Dorfbrunnen mit Birkenreisern.
Pfingsten ist das beliebteste Fest. In einigen wenigen Dörfern schmücken die Burschen den Pfingstquak. Dies ist ein hölzerner großer Zylinder, der von außen mit frischem Laubwerk geziert wird. Mit diesem Pfingstquak zieht die junge Welt von Tür zu Tür und sammelt Eier und Speck. In anderen Gegenden, ehe dort eine Wasserleitung bestand, reinigten die Mädchen in der Nascht auf Pfingstsonntag den Dorfbrunnen, und die Burschen errichteten den Pfingstbaum, den sie mit bunten Bändern schmückten.
Die altdeutschen Sonnwendfeiern haben sich in unseren Johannisfeuern erhalten. Selbst in den Städten sind Sonnwendfeiern wieder aufgelebt und haben beim Volk viel Anklang gefunden. In einigen Orten ist auch noch das Radbrennen Brauch. Nach den Tagen fröhlichen Schabernacks und ausgelassener Festesfreude kommen Tage der ernsten Besinnung: Allerseelentag und Totensonntag. Alt und jung zieht an diesen Tagen zu den Friedhöfen, um in ganz besonderer Weise der Toten zu gedenken. Früher gab es auch noch Trauerkundgebungen an diesen Tagen mit dem Gedenken an die im Weltkrieg Gefallenen und in fremder Erde Ruhenden.
Noch einmal kommt die Volksfreude zum Durchbruch an den Kirmestagen. In der Regel ist der Tag der Kirchweihe der Kirmestag. Auf dem Lande wird die Kirmes sehr ausgiebig gefeiert. Es war früher vornehmlich ein Fest in der Familie für die Verwandten aus den Nachbardörfern. Es wird ein großes „Imbs“ gehalten mit Rindfleischsuppe, Rindfleisch und Meerrettich. Später gibt’s Kaffee und reichlich Kranzkuchen. Die kleineren Kinder haben ihre Freude an den „Reitereien“, am Kirmeskarussell und an den Zuckerbuden auf dem Kirmesplatz. Die Jugendlichen gehen zum Tanz. In der gleichen Weise wird der Martinitag gefeiert, der für manche katholische Gemeinden der allgemeine Kirchweihtag ist. Der Bauer schlachtet sein erstes Schwein und veranstaltet ein großes Schlachtessen, zu dem auch der Dorfschulmeister eingeladen wird.
An Kirmestagen wird auch in manchen Ortschaften der Hammel („Hammelskerb“) oder ein Kranz herausgetanzt. In einigen Dörfern führt man auch den Quak herum und begräbt am Kirmesdienstag die Kirmes.
Am 5. Dezember kommt der Nikolaus. Er zieht von Haus zu Haus und verteilt an die braven Mädchen gebackene Puppen und an die braven Knaben Hasen, dazu Äpfel und Nüsse. Oft zeigt sich auch in der Begleitung des Nikolaus die sogenannte „Himmelsgeiß“. Sie wird dargestellt von zwei Personen, die sich in ein Leintuch hüllen und als Hörner eine Heugabel zeigen.
Wenn Weihnachten naht und der Abendhimmel golden strahlt, sagen die Mütter zu ihren Kindern: „Das Christkindchen backt Plätzchen.“ Die Kinder singen in der Vorweihnachtszeit: „Christkind komm in unser Haus, leer’ dein goldnes Säckelche aus, stell dein Eselche auf die Mist, dass es Heu und Hafer frisst.“
Am Weihnachtsabend bringt das Christkindchen den Kindern Spielzeug und wie der Nikolaus gebackene Puppen, Hasen, Nüsse und Äpfel. („Äpfel, Nüss’ und Mandelkern essen brave Kinder gern…“) Auch die Erwachsenen beschenken sich gegenseitig, dem Zug der Zeit folgend, fast durchweg mit nützlichen Gegenständen, die auch bei den Kindern mehr und mehr den Platz unnötiger Gaben einnehmen.
In abgelegenen Orten trifft man ab und zu noch den Glauben, in der Weihnachtszeit ginge der Werwolf um, und der Teufel säße auf den Schornsteinen. Zwischen Weihnachten und Neujahr liegen die heiligen Nächte. In ihnen krächzt der Unglücksrabe, und das wilde Heer braust durch die Lüfte.
Wie meine Großmutter noch die „schäle Migge“ vertrieb
Stechmücken und Bremsen wahren bei unseren Vorfahren auch „verpennt“ (unbeliebt, verhasst). Ursprünglich bedeutete „pennen“ in der Gaunersprache „in einer Spelunke übernachten, schlafen“, und „pennen“ im Volksmund heißt „zu ungewöhnlicher Zeit schlafen“: „Der pennt die ganze Zeit.“ Ein „Penner“ war auch ein Obdachloser, der auf der Straße eben „pennte“. Und die Stechmücken sollten sich „verpennen“ (verziehen). Vor den stechenden und blutsaugenden Weibchen war keiner von uns sicher, wenn man sich bei schwüler Witterung im Freien aufhielt. Vom Schweiß des Menschen werden sie besonders angelockt. Hatte man „sießes Blud“ ( süßes Blut), so lockte man die Plagegeister besonders an. Im Gegensatz zu den nicht stechenden Mücken und Fliegen hießen die Stechmücken auch „schäle Migge“ (scheele Mücken). Und was tat der Bauer an schwülwarmen Sommertagen, wenn er mit seinen Pferden draußen auf dem Acker war und diese vor Bremsen schützen wollte? Er steckte Farnkräuter in das Kummet, das sollte die Stechmücken vom Pferdekopf abhalten. Und das stimmte! Meine Großmutter kannte eine Vielzahl von Pflanzen, deren ätherische Ausdünstungen Stechmücken abwehren. Lavendel war für sie das beste Mittel, die Plagegeister vom Menschen und von der Wohnung abzuhalten. Man betupfte sich an gefährdeten Körperstellen mit Lavendelöl oder rieb sich mit den aromatischen Blüten ein. Die abwehrende Wirkung hielt bis zu acht Stunden an. Großmutter stellte aber auch Lavendel in einer Blumenvase in die „gudd Stubb“, um die „schäle Migge“ dort abzustecken. Die Lavendelsäckchen in den Kleiderschränken unserer Vorfahren hatten zudem noch einen anderen Zweck: Der wohltuende Duft erfüllte den ganzen Raum und führte zu einem geruhsamen Schlaf, hielt aber auch die Motten von den Kleidern ab. Auch ein Lavendelsäckchen unterm Kopfkissen im Bett führte zu einem erholsamen Schlaf.
Auch Ameisen mögen Lavendel nicht und machen einen weiten Bogen um das Kraut. Die ätherischen Öle der Zitronenmelisse haben eine ähnlich gute abschreckende Wirkung auf Stechmücken. Schließlich gab es damals auch noch in jedem Bauerngarten das Mutterkraut, im Volksmund auch „Mottenkraut“ genannt. Ein Strauß davon in der Vase in der „gudd Stubb“ vertrieb die „schäle Migge“ und die Motten.
Auf unserem Hof stand früher ein Walnussbaum. Unter dem Nussbaum stand eine Ruhebank, auf der sich Großmutter und Großvater nach getaner Feld- und Gartenarbeit am Abend ausruhten, sicher vor stechenden Plagegeistern. Der herbbittere Geruch der Walnussblätter hielt die Stechmücken ab. Ähnliches sagte man vom Holunderstrauch, der dicht an der Giebelwand stand. Aber der „Hollerstock“ war für meine Großmutter auch die „lebendige Hausapotheke“. Aus ihren Blüten bereitete sie Erkältungstee, aus ihren reifen Beeren Marmelade.
Geschwollene und schmerzende Mückenstiche rieb man früher mit Johanniskrautöl ein oder man betupfte sie mit dem ausgepressten Saft der Ringelblume. Auf Wespen- und Bienenstiche drückte man den Saft des Spitzwegerichs und legte eine Zwiebel – oder Kartoffelscheibe darauf.
Von der Heublumenmedizin meiner Urgroßmutter
Meine Urgroßmutter hat mir meine frühe Kindheit auf wunderbare Weise vergoldet. Meine Erinnerungen an sie leuchten heute noch wie güldene Sonnenstrahlen am Firmament. Im Volksmund war es die „Stemmchemodder“, weil sie „auf dem Stümpfchen“ wohnte. Ich hatte das große Glück, dass sie 98 Jahre alt wurde. Noch heute gehe ich im Traum mit ihr durch Fluren und Wälder, sehe ihr lachendes Gesicht und ihre Kräuterbüschel über dem Rücken. Sie hat mir die Natur in die Wiege gelegt.
Noch mit 90 Jahren war sie geistig und körperlich sehr rüstig. In den Kriegsjahren und danach streifte sie mit mir den Sommer über durch Feld und Flur. Jeden Samstag und Sonntag waren wir oft stundenlang unterwegs. Auch der kleinste Zipfel auf der Gemarkung meines Heimatdorfes Steinbach im Ostertal war uns vertraut. Ihr „heiliger“ Sammeltag war der Johannistag (24. Juni9, wenn sie ihre Lieblingsheilpflanze, das „Herz-Jesu-Blut“ pflückte. Sie presste die jungen Blüten des Johanniskrautes zwischen den Daumen und zeigte mir den blutroten Farbstoff. Am liebsten waren wir im „Kerbacherloch“, auf dem „Wälenberg“ und auf der „Trift“ auf der Suche. Sie kannte fast alle Kräuter, von der Kamille über das Tausendgüldenkraut, die Schafgarbe bis hin zum Arnika. Damals waren Arnika und Tausendgüldenkraut noch weit verbreitet; heute sind sie selten und stehen unter Naturschutz. Hatten wir die Körbchen voll, dann schnürte sie Kräuterbündel, hängte sie uns über den Nacken und wir trugen sie heim. Zu Hause wurden die Kräuter in kleinen Sträußchen unter den Walnussbaum gelegt, wo sie dann im Schatten trockneten. Das ganze Jahr über hatten wir unseren Kräutertee. Im Hochsommer pflückte sie auch Kornblumen in den Getreidefeldern, die heute fast gänzlich verschwunden sind. Ihre blauen Blüten dienten zur Färbung der Tees.
Aber auch im zeitigen Frühjahr waren wir schon auf Tour. Da galt es vor allem das Scharbockskraut zu sammeln. Sie wusste, dass es ein wichtiger Vitaminspender für die Frühjahrskur war. Aus den Blättern bereitete sie einen köstlichen Salat, aus den stärkehaltigen Knöllchen „gebratene Feigen“. Natürlich sammelten wir im März, wie das vor allem im Saarland so üblich ist, den „Bettseicher“ (Löwenzahn). Jeden Morgen pünktlich um zehn Uhr kam sie zu meiner Mutter, um die Kartoffeln für den Mittagstisch zu schälen. Im Herbst schnitt sie Kartoffelscheiben, färbte sie und stellte für mich wundersame Muster mit Kartoffelstempel her.
Meine Urgroßmutter pflegte noch das „Brauchen“, wie das früher auf den Dörfern so üblich war. Hatte ich im Winter eine Erkältung, dann brachte mich meine Mutter zur „Stemmchemodder“. Das „fleißige Handauflegen“ bei Entzündungen im Kopfbereich war damals noch ein viel gepriesenes Mittel.
Ein Bett im Heustadel, eine Ruhestunde im Heuschwaden oder ein Schäferstündchen auf dem Heuboden ist heute nicht mehr romantisch. Früher roch das Heu stark nach Kumarin, was dem typischen Waldmeisterduft entspricht. Kumarin ist eine Zuckerverbindung, die erst beim Verwelken der Pflanzen frei wird und ihren unvergleichlichen Heuduft entfaltet, ist vornehmlich im Ruchgras („Riechgras“) der Wiese, im Waldmeister, im Steinklee, in der Weinraute und in vielen Wiesenblumen enthalten. Da diese ja häufig aus den Wiesen verschwunden sind oder man sie nicht mehr ausblühen lässt, mangelt es heute dem Heu am würzigen Duft.
„Heublumen“ aber sind keine Blumen. Es handelt sich um Pflanzenteile, die sich im Laufe der Zeit auf den Heuböden, häufig in einer mehrere Zentimeter dicken Schicht, ablagern. Diese Heublumen bestehen aus Blättchen, Samen, Blütenstaub und Blütchen der Gräser und Kräuter, die mit dem Heu eingebracht werden. Neben den eigentlichen Gräsern findet man Bestandteile des Löwenzahns, der Schafgarbe, des Eisenkrautes, des Ehrenpreises, des Kerbels, des Sauerampfers und anderer Kräuter. Heublumen sind vergleichsweise billig. Man kauft sie pfundweise in den Apotheken. Sie sollen gut getrocknet sein und nur bis zur nächsten Heuernte verwendet werden. Ältere Heublumen verlieren ihre Wirkung.
Die Behandlung mit Heublumen war für meine Urgroßmutter eine „Chefsache“. Vor allem Vollbäder mit Heublumen und der Gebrauch von Heublumensäckchen waren bei meiner Urgroßmutter dorfweit bekannt. Sie halfen bei rheumatischen Erkrankungen, Gicht, Hexenschuss, schmerzhaften Gelenkentzündungen und bei Erkältungskrankheiten. Für Vollbäder benötigte sie ein bis zwei Kilo Heublumen. Sie überbrühte mit fünf Liter Wasser, ließ zehn Minuten ziehen, seihte ab und setzte den Aufguss dem heißen Badewasser zu. Nach dem Bad gönnte man sich eine längere Bettruhe. Für Sitz- und Fußbäder nahm sie ¼ kg Heublumen.
Am bequemsten war für sie der Gebrauch von Heublumensäckchen. Dazu benutzte sie einen Leinenbeutel, den sie fast vollständig mit Heublumen füllte. Der Beutel wurde zugebunden und in kochendes Wasser gebracht. Bei zugedecktem Topf wurde er zehn Minuten ziehen gelassen. Der ausgedrückte Leinenbeutel wurde – so heiß wie nur möglich – auf die erkrankten Körperstellen gebracht. Die Heublumenauflage wurde mit wollenen Tüchern gut abgedeckt.
Als noch Fuhrleute und Kutscher auf den Dorfstraßen unterwegs waren
1945 gab es in unserem Dorf noch kein Auto. Doch den ganzen Tag über fuhren Fuhrwerke durch unsere Straßen, die ja noch nicht geteert waren. Da gab es Ortspolizeibeschlüsse, über die wir heute nur noch schmunzeln können.
Fuhrleute und Kutscher mussten linksseitig neben ihren Fuhrwerken hergehen, die Zugtiere führen oder an doppelten Leitseilen lenken. Im Innern des Dorfes durfte nur im Schritt oder kurzem Trabe gefahren oder geritten werden. Beim Bergabfahren sind Fuhrwerke durch Einlegen des Radschuhes oder mittels anderer Bremsvorrichtungen zu hemmen. Pferde, und zwar nicht mehr als je zwei zusammen, durften nur von erwachsenen Personen zur Tränke geführt oder geritten werden. Bei schneebedecktem Boden waren die Zugtiere mit Schellen oder Rosseln zu versehen. Das Peitschenknallen war nur insofern gestattet, als dasselbe bei Straßenwendungen und Kreuzungen nötig war. Während öffentlicher Bekanntmachungen durch den Gemeindebediensteten mittels der Schelle hatten Fuhren und Reiter in einer Entfernung von mindestens fünfzig Meter stille zu halten bis die Bekanntmachung zu Ende war. Ebenso waren störende Unterbrechungen durch Geschrei zu vermeiden.
Das Anhängen über drei Monate alter Pferde an Wagen sowie das Abschlachten des Viehes auf öffentlichen Straßen war verboten. Das Hetzen des Schlachtviehes durfte nicht geschehen. Schulpflichtiger Kinder waren bei eintretender Dunkelheit von der Straße fernzuhalten. Gänse waren an Sonn- und Feiertagen von öffentlichen Straßen und Plätzen fernzuhalten. Es war auch verboten, Vieh außerhalb geschlossener Höfe oder anderer umfriedeter Räume ohne gehörige Aufsicht umherlaufen zu lassen. Hausgeflügel, insbesondere Hühner, Enten und Gänse durften ohne Erlaubnis in fremde Gärten, auf Felder und Wiesen nie laufen gelassen werden. Tauben mussten während der Saat- und Erntezeit eingesperrt werden.
Es war verboten, Hunde in öffentliche Wirtschaften, Fleischbänke, auf Märkte oder zu öffentlichen Feierlichkeiten mitzunehmen oder dieselben zur Nachtzeit auf öffentlichen Straßen und Plätzen frei herumlaufen zu lassen. Das Mitnehmen von Hunden in öffentliche Wirtslokale und auf Märkte war ausnahmsweise nur dann gestattet, wenn diese mit einem Maulkorb versehen waren und an der Leine geführt wurden. Läufige Hündinnen hatte der Eigentümer „gehörig“ zu verwahren. Freilaufende Hunde größerer Gattung mit Ausnahme der Jagdhund, während sie sich auf der Jagd befanden, und der Hirten- und Schäferhunde, wenn sie bei der Herde waren, mussten mit einem wohlbefestigten Maulkorb versehen sein, der das Beißen verhinderte. Auch war es verboten, an offenen Stellen in der Nähe von Wohnungen oder öffentlichen Wegen zu baden.
Allerlei Aberglauben um die Rabenvögel
Noch meine Urgroßmutter war dem Aberglauben unserer Vorfahren verfallen und wusste zu berichten: „Wenn eine Schar Krähen am Abend auf dem Felde schreit, stirbt ein naher Verwandter.“ Das sagte man auch dem Kauz nach, wenn er in der Nacht „Kiwitt – Kiwitt“ („Komm mit – komm mit“) rief.
Im Volksmund machte man keine Unterschiede: Alle Rabenvögel, zu denen die verschiedenen krähenarten gehören, wurden „in einen Topf geworfen“. Es waren eben „Raben“. Dazu gehörten auch die „eigentlichen“ Raben, die Kolkraben. Selbst die „diebische Elster“ musste herhalten, um das schlechte Image unserer Rabenvögel zu erhalten.
„Sie klauen wie eine Atzel“. „Wie ein Rabe stehlen“ ist bis heute eine Redensart geblieben.
Bei den Bauernwaren insbesondere Saatkrähen gehasst. Fielen sie über Getreidesaaten, reifende Feld- und Gartenfrüchte her, verursachten sie großen Schaden. Die schwarze Farbe, dazu das Krächzen, das freche Heranflattern („frech wie ein Rabe“) und das scharenweise Auftauchen an grauen Novembertagen in der Nähe menschlicher Siedlungen haben bei unseren Vorfahren wohl einen so unheimlichen Eindruck erweckt, dass im Volksglauben und besonders im Märchen Rabenvögel als Unglücksvögel und Unglücksboten angesehen wurden: Ein „rabenschwarzer Tag“ war eben ein Unglückstag und ein „Unglücksrabe“ eben ein Pechvogel. Bei alledem mag der Rabe als „Galgenvogel“, der sich in der Nähe von Leichen aufhielt, eine Rolle gespielt haben. Auch sonst musste der Rabe als Symbol für Böses herhalten. „Rabeneltern“ („Rabenvater“ und „Rabenmutter“) kümmern sich nicht um ihre Kinder. Beides beruht auf der falschen Annahme, dass die Rabenvögel ihre Jungen im Stich ließen. In Wirklichkeit sind die Jungkrähen wie alle anderen Rabenvögel nach dem Schlüpfen Nesthocker, die erst nach einigen Wochen flügge werden. Eine ausgeprägte Brutpflege durch die Eltern ist damit wie bei allen Singvögeln instinktmäßig festgelegt. Nach der Brutzeit halten die Geschwister in engem Verband bis zur Verpaarung zusammen. Übrigens führen Raben eine Dauerehe.