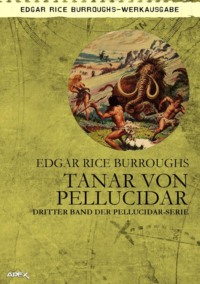Kitabı oku: «TANAR VON PELLUCIDAR», sayfa 3
»Du bist zu schön und zu elegant«, antwortete er. »Du hast Sympathie gezeigt, und das ist ein Gefühl, das weit über deren geistige Fähigkeit hinausgeht. Sie sind –«
»Pass auf, Feind; vielleicht bin ich ein Korsarin!«
»Glaube ich nicht«, sagte Tanar.
»Dann behalte deinen Glauben für dich, Gefangener«, erwiderte das Mädchen in einem hochmütigen Ton.
»Was soll das?«, fragte eine raue Stimme hinter Tanar.
»Was hat diese Kreatur zu dir gesagt, Stellara?« Tanar drehte sich zu Bohar dem Blutigen um.
»Ich habe angezweifelt, dass sie der gleichen Rasse angehört wie du«, schnauzte Tanar, bevor das Mädchen antworten konnte. »Es ist unvorstellbar, dass eine so schöne Frau mit dem Blut von Korsar befleckt sein kann.«
Bohar, das Gesicht rot vor Wut, legte eine Hand auf eines seiner Messer und schritt wütend auf den Sarier zu. »Es bedeutet den Tod, die Tochter des Cid zu beleidigen«, schrie er, riss das Messer aus seiner Schärpe und stiess das Messer nach Tanar.
Der leichtfüssige Sarier, seit Kindheit an im defensiven wie offensiven Umgang mit scharfen Waffen geübt, trat schnell zur Seite und dann ebenso schnell wieder zurück, und erneut wälzte sich Bohar der Blutige nach einem gut platzierten Schlag auf dem Deck.
Bohar schäumte geradezu vor Wut, als er seine schwere Pistole aus seiner bunten Schärpe riss und von dort, wo er auf dem Deck lag, auf Tanars Brust zielte und abdrückte. Im selben Augenblick sprang das Mädchen vor, als wolle es die Ermordung des Gefangenen verhindern.
Es geschah alles so schnell, dass Tanar die Abfolge der Ereignisse kaum mitbekam, aber was er wusste, war, dass das Pulver nicht zündete, und dann lachte er.
»Du solltest besser warten, bis ich dir beigebracht habe, wie man Pulver herstellt, das brennt, bevor du versuchst, mich zu ermorden, Bohar«, sagte er.
Der Blutige rappelte sich auf und Tanar stand bereit, um den erwarteten Angriff abzuwehren, aber das Mädchen trat mit einer gebieterischen Geste zwischen sie.
»Genug davon!«, rief sie. »Es ist der Wunsch des Cid, dass dieser Mann lebt. Willst du, dass der Cid erfährt, dass du versucht hast, ihn zu erschießen, Bohar?«
Der Blutige starrte Tanar einige Sekunden lang an, dann drehte er sich um und schritt wortlos davon.
»Es scheint, dass Bohar mich nicht mag«, sagte Tanar und lächelte.
»Er mag fast niemanden«, sagte Stellara, »aber dich hasst er – jetzt.«
»Weil ich ihn niedergeschlagen habe, nehme ich an. Ich kann es ihm nicht verübeln.«
»Das ist nicht der wahre Grund«, sagte das Mädchen.
»Was ist es dann?«
Sie zögerte, dann lachte sie. »Er ist eifersüchtig. Bohar will mich als seine Gefährtin.«
»Aber warum sollte er dann auf mich eifersüchtig sein?«
Stellara sah Tanar von oben bis unten an, dann lachte sie wieder. »Ich weiß es nicht«, sagte sie. »Neben unseren riesigen Korsaren bist du bloss ein halber Mann – mit deinem bartlosen Gesicht und deiner schmalen Taille. Es bräuchte zwei von dir, um einen von ihnen zu machen.«
Für Tanar bemerkte eine leichte Verachtung in ihrer Stimme und das pikierte ihn, aber warum, wusste er nicht, und das ärgerte ihn gleich mit. Was war sie anderes als die wilde Tochter eines wilden, rüpelhaften Korsaren?
Als er zum ersten Mal von Bohars Lippen erfahren hatte, dass sie die Tochter und nicht die Gefährtin des Cid war, hatte er eine unerklärliche Erleichterung verspürt, halb unbewusst und ohne überhaupt zu versuchen, seine Reaktion zu verstehen.
Vielleicht war es die Schönheit des Mädchens, die eine solche Beziehung mit dem Cid abstoßend erscheinen ließ, vielleicht war es ihre geringere Rücksichtslosigkeit, die im Gegensatz zur Brutalität von Bohar und dem Cid als überragende Sanftheit erschien, aber jetzt schien sie zu einer raffinierten Grausamkeit fähig zu sein, die er schließlich in der einen oder anderen Form bei der Tochter des Häuptlings der Korsaren erwartet hätte.
Wie man es eben so macht, wenn man pikiert ist, neckte Tanar sie, in der Hoffnung, sie damit zu ärgern. »Bohar kennt dich besser als ich«, sagte er; »vielleicht weiß er, dass er Grund zur Eifersucht hat.«
»Vielleicht«, erwiderte sie rätselhaft, »aber niemand wird es je erfahren, denn Bohar wird dich töten – ich kenne ihn gut genug, um das zu wissen.«
Kapitel 2: Unglück
Auf den zeitlosen Meeren von Pellucidar kann eine Reise eine Stunde oder ein Jahr dauern – das hängt nicht von ihrer Dauer ab, sondern von den wichtigen Ereignissen, die ihren Verlauf kennzeichnen.
Die Korsar-Flotte durchpflügte die unruhige See entlang des aufwärts gekrümmten Erdinnern. Günstige Winde trugen die Schiffe vorwärts. Die Mittagssonne stand unaufhörlich im Zenit. Die Menschen aßen, wenn sie hungrig waren, schliefen, wenn sie müde waren, oder schliefen für Zeiten, in denen ihnen der Schlaf verweigert werden könnte, denn die Menschen von Pellucidar scheinen mit einer Fähigkeit ausgestattet zu sein, die es ihnen erlaubt, den Schlaf sozusagen zu speichern, für Zeiten, in denen an Schlaf nicht zu denken war, etwa die anstrengenderen Perioden der Jagd und des Krieges, in denen es keine Gelegenheit für Schlaf gibt. Ähnlich essen sie mit unglaublicher Unregelmäßigkeit.
Tanar hatte seit seiner Begegnung mit Bohar, den er seither bei verschiedenen Gelegenheiten gesehen hatte, ohne dass es zu einer tatsächlichen Begegnung gekommen war, mehrere Male geschlafen und gegessen. Der Blutige schien seine Zeit abzuwarten.
Stellara hatte sich mit der alten Frau, von der Tanar annahm, dass es ihre Mutter war, in ihrer Kabine aufgehalten. Er fragte sich, ob Stellara einst wie ihre Mutter oder der Cid aussehen würde, wenn sie älter war, und ihm schauderte bei dem Gedanken an beide Möglichkeiten.
Während er so vor sich hin sinnierte, wurde Tanars Aufmerksamkeit von den Bewegungen der Männer auf dem Unterdeck abgelenkt. Er sah, wie sie über den Bug nach oben blickten, und als er mit seinem Blick der Richtung ihrer Augen folgte, sah er das seltene Phänomen einer Wolke am strahlenden Himmel.
Ungefähr zur gleichen Zeit muss jemand den Cid benachrichtigt haben, denn er kam aus seiner Kajüte und schaute lange und forschend zum Himmel hinauf.
Mit lauter Stimme brüllte der Cid Befehle, und seine wilde Mannschaft kletterte wie Affen auf ihre Posten, schwärmte nach oben oder stand an Deck bereit, um seine Befehle auszuführen.
Die großen Segel wurden herabgelassen und die kleineren gerefft, und in der ganzen Flotte, die über die Oberfläche des glänzenden Meeres verstreut war, folgte man dem Beispiel des Kommandanten.
Die Wolke nahm an Größe zu und kam schnell näher. Es war nicht mehr die kleine weiße Wolke, die zuerst ihre Aufmerksamkeit erregt hatte, sondern eine große, wulstige, bedrohliche, schwarze Masse, die finster über dem Ozean hing und ihn dort, wo der Schatten lag, in ein düsteres Grau verwandelte.
Der Wind, der sanft geweht hatte, ebbte urplötzlich ab. Das Schiff verlor an Fahrt und trieb im Meer. Die Stille, die folgte, legte einen Bann des Schreckens über die Schiffsbesatzung.
Tanar beobachtete sie und bemerkte ihre Veränderung. Wenn diese rauen Seefahrer vor der Bedrohung durch die große Wolke zurückschreckten, musste die Gefahr tatsächlich groß sein.
Die Sarier waren ein Bergvolk. Tanar wusste wenig über das Meer, aber wenn er auf Pellucidar etwas fürchtete, dann war es das Meer. Der Anblick dieser wilden Korsar-Matrosen, die sich vor Angst krümmten, war daher alles andere als beruhigend.
Jemand war an die Reling gekommen und stellte sich an seine Seite.
»Wenn das vorbei ist«, sagte eine Stimme, »wird es weniger Schiffe in der Flotte von Korsar geben und weniger Männer, die nach Hause zu ihren Frauen gehen.«
Er drehte sich um und sah Stellara, die zur Wolke hinaufblickte.
»Du scheinst aber keine Angst zu haben«, sagte er.
»Du auch nicht«, antwortete das Mädchen. »Wir scheinen die einzigen Menschen an Bord zu sein, die keine Angst haben.«
»Sieh dir die Gefangenen an«, sagte er zu ihr. »Sie zeigen keine Angst.«
»Warum?«, fragte sie.
»Sie sind Pellucidarer«, antwortete er stolz.
»Wir sind alle von Pellucidar«, erinnerte sie ihn.
»Ich beziehe mich auf das Imperium«, sagte er.
»Warum hast du keine Angst?«, fragte sie. »Bist du so viel mutiger als die Korsaren?« Es lag kein Sarkasmus in ihrer Stimme.
»Ich habe sehr viel Angst«, antwortete Tanar. »Ich gehöre zu einem Bergvolk – wir wissen wenig über das Meer und seine Wege.«
»Aber du zeigst keine Angst«, beharrte Stellara.
»Das ist das Ergebnis von Vererbung und Training«, antwortete er.
»Die Korsaren zeigen ihre Angst«, überlegte sie. Sie sprach wie eine, die von anderem Blut war. »Sie rühmen sich ihrer Tapferkeit«, fuhr sie fort, als redete sie zu sich selbst, »aber wenn der Himmel sich verdunkelt, zeigen sie Furcht.« In ihrer Stimme lag ein Hauch Verachtung. »Schau!«, rief sie. »Es kommt!«
Die Wolke kam jetzt auf sie zu, und unter ihr tobte das Meer. Nebelfetzen wirbelten und drehten sich an den Rändern der großen Wolkenmasse. Gischt wirbelte und brach über den wütenden Wellen. Und dann traf der Sturm auf das Schiff und brach es fast zum Kentern.
Was nun folgte, war für einen Bergmenschen, der das Meer nicht gewohnt war, entsetzlich: das Chaos der Wellen, die über das sich wälzende Schiff brachen, das peitschende Wasser; der kreischende Wind; die schäumende, blendende Gischt; die entsetzte und eingeschüchterte Mannschaft, die alle Bedrohlichkeit verloren hatte.
Taumelnd, torkelnd, sich an die Reling klammernd, kam Bohar der Blutige an Tanar vorbei, der sich mit einem Arm an eine Stütze klammerte und mit dem anderen Stellara festhielt, die ohne das schnelle Eingreifen des Sariers auf das Deck geschleudert worden wäre.
Das Gesicht von Bohar war eine aschfahle Maske, von der sich die rote Wunde seiner hässlichen Narbe in erschreckendem Kontrast abhob. Er schaute zu Tanar und Stellara, aber er ging an ihnen vorbei und murmelte vor sich hin.
Hinter ihnen war der Cid, der Befehle brüllte, die niemand hören konnte. Bohar machte sich auf den Weg zu ihm. Über dem Sturm hörte Tanar den Blutigen, der seinen Anführer anschrie.
»Rettet mich! Rettet mich!«, schrie er. »Die Boote – lasst die Boote runter! Das Schiff ist verloren.«
Es war selbst für einen Landbewohner offensichtlich, dass kein kleines Boot in einer solchen See bestehen konnte, selbst wenn eines hätte herabgelassen werden können. Der Cid beachtete seinen Leutnant nicht, sondern blieb, wo er war, und brüllte Befehle.
Eine mächtige Welle erhob sich plötzlich über den Bug; hing dort für einen Augenblick und brach dann auf das untere Deck – Tonnen von erdrückender, erbarmungsloser, gefühlloser See – donnerte auf die zusammengekauerten, schreienden Seeleute. Nichts als der hohe Bug und das hohe Achterschiff ragten aus den wütenden Wellen heraus – einen kurzen Moment lang ächzte das große Schiff und zitterte, kämpfte um sein Leben.
»Es ist das Ende!«, schrie Stellara.
Bohar schrie wie eine dumme Bestie im Angesicht des Todes. Der Cid kniete auf dem Deck, das Gesicht in seinen Armen vergraben. Tanar stand da und sah zu, fasziniert von der furchterregenden Macht der Elemente. Er sah, wie der Mensch wegen einer Windböe zu mickriger Bedeutungslosigkeit schrumpfte, und sein Gesicht verzog sich zu einem langsamen Lächeln.
Die Welle zog sich zurück und das Schiff taumelte ächzend nach oben. Das Lächeln verließ Tanars Lippen, als seine Augen auf das Unterdeck blickten. Es war jetzt fast leer. Ein paar durchnässte Gestalten lagen zusammengekauert in den Speigatten; ein Dutzend Männer, die sich hier und da festklammerten, gaben ein Lebenszeichen von sich. Die anderen, alle außer denen, die sich unter Deck in Sicherheit gebracht hatten, waren verschwunden.
Das Mädchen klammerte sich fest an den Mann. »Ich hätte nicht gedacht, dass wir das überleben würden«, sagte sie.
»Ich auch nicht«, sagte Tanar.
»Aber du hattest keine Angst«, sagte sie. »Du scheinst der Einzige zu sein, der keine Angst hatte.«
»Was hat Bohars Schreien genützt?«, fragte er. »Hat es ihn gerettet?«
»Du hattest also Angst, aber du hast sie versteckt?«
Er zuckte mit den Schultern. »Vielleicht«, sagte er. »Ich weiß nicht, was du mit Angst meinst. Ich wollte nicht sterben, wenn du darauf hinaus willst.«
»Da kommt noch eine!«, rief Stellara schaudernd und drückte sich näher an ihn.
Tanars Arm schlang sich um die schlanke Gestalt des Mädchens. Es war eine unbewusste Geste des Beschützerinstinkts des Mannes.
»Hab keine Angst«, sagte er.
»Ich habe keine – jetzt nicht mehr«, antwortete sie.
In dem Augenblick, als die mächtige Welle das Schiff verschlang, schlug der wütende Orkan plötzlich mit neuer Wut zu – und die Masten, deren Segel schon auf ein Minimum gerefft waren, gerade noch genug, um den Bug des Schiffes gegen den Sturm zu halten, zerbarsten wie trockene Knochen und krachten in einem Gewirr von Tauwerk auf Deck. Die Gallionsfigur des Schiffes brach weg und das Schiff wirbelte im Sog des großen Meeres umher – ein hoffnungsloses Wrack.
Über das Heulen des Windes erhob sich Bohars Geschrei. »Die Boote! Die Boote!«, wiederholte er wie ein dressierter Papagei, der vor Angst verrückt geworden ist.
Als wäre er für den Moment gesättigt und von seinen eigenen Anstrengungen erschöpft, legte sich der Sturm, der Wind erstarb, aber das aufgepeitschte Wasser stieg und fiel, und zog das große Schiff mit sich. Am Fusse jedes wässrigen Tals schien es, als würde es von der graugrünen Klippe verschlungen werden, die über ihm zusammenstürzte, die unausweichliche Zerstörung mit sich bringend.
Bohar, immer noch schreiend, kletterte auf das Unterdeck. Er fand Männer im Freien, die wie durch ein Wunder noch lebten, und andere, die unter Deck in Angst und Schrecken erstarrt waren. Durch Flüche und Schläge und mit seiner geladenen Pistole drohend, brachte er die vor Angst zitternde Meute, ein Boot bereit zu machen.
Es waren zwanzig von ihnen, und ihre Götter oder Teufel müssen mit ihnen treu gewesen sein, denn sie ließen ein Boot hinunter und entkamen dem taumelnden Wrack sicher und ohne einen Mann zu verlieren.
Der Cid hatte Bohars Vorhaben beobachtet, und versuchte, die scheinbar selbstmörderische Tat zu verhindern, indem er ihm vom Oberdeck her Befehle zubrüllte, aber sie hatten keine Wirkung, worauf der Cid auf das Unterdeck hinabstieg, um seinen Befehlen Nachdruck zu verleihen, aber er war zu spät gekommen.
Nun stand er da und starrte ungläubig auf das kleine Boot, das in scheinbarer Sicherheit über das weite Meer schipperte, während das zerstörte Schiff, das unter den abgeknickten Masten langsam auseinanderbrach, dem Untergang geweiht schien.
Aus allen Ecken und Verstecken, kam der Rest der Schiffsbesatzung gekrochen, und als sie Bohars Boot und die scheinbare Sicherheit der Besatzung sahen, riefen sie nach einer Flucht mit den anderen Booten. Nachdem sich der Gedanke in ihren Köpfen festgesetzt hatte, brach eine wahnsinnige Panik aus, und die Halbstarken begannen um Plätze in den verbleibenden Booten zu kämpfen.
»Komm!«, rief Stellara. »Wir müssen uns beeilen, sonst fahren sie ohne uns.« Sie begann, sich in Richtung Niedergang zu bewegen, aber Tanar hielt sie zurück.
»Sieh sie dir an«, sagte er. »Wir sind sicherer, wenn wir uns dem Meer und dem Sturm ausliefern.«
Stellara wich vom Niedergang zurück. Sie sah Männer, die sich gegenseitig abstachen – die Hinteren murksten die Vorderen ab. Männer zerrten andere aus den Booten und töteten sie an Deck oder wurden selbst getötet. Sie sah, wie der Cid einem Matrosen in den Rücken schoss und dessen Platz im ersten Boot einnahm, das herabgelassen wurde. Sie sah Männer, die von der Reling sprangen, in dem verrückten Versuch, dieses Boot zu erreichen, und dabei ins Meer stürzten oder hineingeworfen wurden, wenn es ihnen gelang, das schaukelnde Boot zu entern.
Sie sah, wie die anderen Boote herabgelassen wurden und die Männer zwischen ihnen und der Bordwand zerquetscht wurden – sie sah, in welche Verzweiflung die Angeber und Grobiane vor lauter Angst getrieben wurden, als die verbleibenden Matrosen, die keinen Platz im letzten Boot ergattern konnten, absichtlich ins Meer sprangen und ertranken.
Tanar und Stellara standen auf dem hohen Vorschiff des sinkenden Wracks und beobachteten die verzweifelten Bemühungen der Ruderer in den überfüllten kleinen Booten. Sie sahen, wie ein Boot ein anderes rammte und beide untergingen. Sie sahen, wie die ertrinkenden Männer ums Überleben kämpften. Als der Sturm zurückkehrte, hörten sie ihre heiseren Flüche und ihre Schreie über das Tosen des Meeres und das Heulen des Windes hinweg, als fürchteten sie, so seiner Wut entkommen zu können.
»Wir sind allein«, sagte Stellara. »Sie sind alle weg.«
»Lass sie gehen«, antwortete Tanar. »Ich würde nicht mit ihnen tauschen wollen.«
»Aber es gibt keine Hoffnung für uns«, sagte das Mädchen.
»Ja, für sie gibt es keine mehr«, antwortete der Sarier, »aber wenigstens sind wir nicht in ein kleines Boot voller Halsabschneider gepfercht.«
»Du hast mehr Angst vor den Männern als vor dem Meer«, sagte sie.
»Um deinetwillen, ja«, antwortete er.
»Warum solltest du dich um mich fürchten?«, fragte sie. »Bin ich nicht auch dein Feind?«
Er blickte sie voller Überraschung an. »Das stimmt«, sagte er, »aber irgendwie hatte ich es vergessen – du wirkst aber nicht wie ein Feind, nicht so wie die anderen. Du scheinst nicht einmal wie einer von ihnen zu sein.«
Tanar klammerte sich an die Reling und stützte das Mädchen auf dem schwankenden Deck, seine Lippen bewegten sich nahe an Stellaras Ohr, als er versuchte, sich über den Sturm hinweg mit ihr zu sprechen. Er vernahm einen schwachen und zarten Duft, der für immer ein Teil seiner Erinnerung an Stellara bleiben sollte.
Eine Woge schlug gegen das schwankende Schiff und warf Tanar nach vorne, so dass seine Wange die Wange des Mädchens berührte und als sie den Kopf drehte, streiften seine Lippen die ihren. Beiden war klar, dass es ein Versehen war, aber der Effekt war nicht weniger überraschend. Tanar spürte zum ersten Mal den Körper der Frau an seinem und das Bewusstsein dieser Berührung muss sich in seinen Augen widergespiegelt haben, denn Stellara wich zurück, ein Schimmer der Furcht in ihrem Blick.
Tanar sah die Angst in den Augen eines Feindes, aber es bereitete ihm kein Vergnügen. Er versuchte sich vorzustellen, was einer Frau seines Stammes widerfahren wäre, wäre sie den Korsaren in die Hände gefallen, aber auch dieser Gedanke befriedigte ihn nicht – und hätte es, wäre das einem Eingeständnis gleich gekommen, dass er aus dem gleichen unedlen Holz geschnitzt war wie die Männer von Korsar.
Welche Gedanken Stellara und Tanar auch plagten, verlor in dem Augenblick an Bedeutung, als eine weitere gewaltige Welle, die gigantischste, die das geschundene Schiff bisher heimgesucht hatte, ihre unzähligen Tonnen auf das bebende Deck schleuderte.
Für Tanar schien es in der Tat so, als müsse dies das Ende bedeuten, denn es war unvorstellbar, dass sich der unbeherrschbare Schiffsrumpf wieder aus dem Wasserschwall erheben könnte, der ihn fast bis zum obersten Deck des hoch aufragenden Vorschiffs überspülte, wo sich die beiden gegen den reißenden Wind und das furchtbare Schaukeln des Wracks festhielten.
Doch während die Wellen weiter über das Deck brachen, kämpfte sich das Schiff langsam und träge zurück an die Oberfläche, wie ein erschöpfter und ertrinkender Schwimmer, der sich schwach nach oben kämpft, um einen letzten Atemzug zu bekommen, der bestenfalls die Agonie des Todes verlängern würde.
Als das Hauptdeck langsam aus dem zurückweichenden Wasser auftauchte, bemerkte Tanar voller Schrecken, dass die vordere Luke eingedrückt worden war. Dass das Schiff eine beträchtliche Menge Wasser aufgenommen haben musste und dass jede nachfolgende Welle, die über sie hereinbrach, die Menge noch vergrössern würde, berührte den Sarier weniger als das Wissen um die Tatsache, dass unter dieser Luke seine Mitgefangenen eingesperrt waren.
Durch die finstere Bedrohung seiner fast aussichtslosen Lage hindurch schimmerte ein einziger heller Hoffnungsschimmer, dass, sollte das Schiff den Sturm überstehen, eine Anzahl seiner pellucidarischen Kameraden an Bord sein würde und dass sie gemeinsam die Mittel finden würden, ein notdürftiges Segel zu bauen und sich den Weg zurück zum Festland zu bahnen, von dem aus sie entführt wurden; aber angesichts der klaffenden Luke und der fast sicheren Schlussfolgerung, die daraus gezogen werden musste, wurde ihm klar, dass es in der Tat ein Wunder wäre, wenn außer Stellara und ihm noch jemand an Bord des Wracks am Leben wäre.
Das Mädchen blickte auf die Verwüstung hinunter und wandte nun ihr Gesicht dem seinen zu.
»Sie müssen alle ertrunken sein«, sagte sie, »und es waren deine Leute. Es tut mir leid.«
»Vielleicht hätten sie es dem vorgezogen, was sie in Korsar erwartet hätte«, sagte er.
»Und sie wurden nur ein wenig früher erlöst, als wir es werden«, fuhr sie fort. »Bemerkst du, wie tief das Schiff jetzt liegt und wie träge es ist? Der Laderaum muss halb mit Wasser gefüllt sein – eine weitere solche Welle wie die letzte wird es endgültig versenken.«
Eine Zeit lang standen sie schweigend da, jeder mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Der Schiffsrumpf wälzte sich im Wellental, und einen Moment lang schien es, als könnte er nicht rechtzeitig beidrehen, um das Unheil der nächsten bedrohlichen Welle abzuwenden, doch er taumelte wie trunken und hielt dem nahenden Wasser seine hohe Seite entgegen.
»Ich glaube, der Sturm hat sich verzogen«, sagte Tanar.
»Der Wind ist abgeflaut, und die Wellen sind nicht mehr so groß wie die, die Vorschiff geflutet hat«, sagte Stellara hoffnungsvoll.
Die Mittagssonne brach hinter der schwarzen Wolke hervor, die sie verhüllt hatte, und das Meer erstrahlte in blauer und silberner Schönheit. Der Sturm hatte sich gelegt. Die Wellen flauten ab. Das Wrack lag tief im Wasser, war aber vorübergehend von der Bedrohung einer unmittelbaren Katastrophe befreit.
Tanar stieg den Niedergang zum Unterdeck hinunter und näherte sich der vorderen Luke. Ein einziger Blick nach unten offenbarte nur das, was er voraussehen konnte – schwimmende Leichen, die im Wellengang hin und her wogten. Alle unter Deck waren tot. Mit einem Seufzer wandte er sich ab und kehrte auf das Oberdeck zurück.
Das Mädchen fragte nicht nach, denn sie konnte in seinem Blick lesen, was geschehen war.
»Du und ich sind die einzigen Überlebenden an Bord«, sagte er.
Sie holte mit einer Hand zu einer großen Geste aus, die das Meer um sie herum einbezog. »Wir sind zweifellos die einzigen Überlebenden der gesamten Flotte«, sagte sie. »Ich sehe weder ein anderes Schiff noch eines der kleinen Boote.«
Tanar blickte in alle Richtungen. »Ich auch nicht«, sagte er; »aber vielleicht sind einige von ihnen entkommen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Das bezweifle ich.«
»Ihr habt einen schweren Verlust erlitten«, sagte der Sarier mitfühlend. »Neben so vielen deiner Leute hast du auch deinen Vater und deine Mutter verloren.«
Stellara wandte sich ihm schnell zu. »Sie waren nicht mein Volk«, sagte sie.
»Was?«, rief Tanar aus. »Sie waren nicht dein Volk? Aber dein Vater, der Cid, war der Anführer der Korsaren.«
»Er war nicht mein Vater«, antwortete das Mädchen.
»Und die Frau war nicht deine Mutter?«
»Mögen die Götter es verhüten!«, rief sie aus.
»Aber der Cid! Er hat dich wie eine Tochter behandelt.«
»Er dachte, ich sei seine Tochter, aber ich bin es nicht.«
»Ich verstehe nicht«, sagte Tanar; »und doch bin ich froh, dass du es nicht bist. Ich konnte nicht verstehen, wie du, die du so anders bist als sie, eine Korsarin sein konntest.«
»Meine Mutter war eine Eingeborene der Insel Amiocap, und dort hat der Cid sie auf einem Raubzug nach Frauen geschnappt. Sie erzählte mir viele Male davon, bevor sie starb.
Ihr Gefährte war auf einer großen Jagd nach Tandors und sie sah ihn nie wieder. Als ich geboren wurde, dachte der Cid, ich sei seine Tochter, aber meine Mutter wusste es besser, denn ich trug auf meiner linken Schulter ein kleines, rotes Muttermal, das identisch mit dem auf der linken Schulter des Mannes war, dem sie gestohlen worden war – meinem Vater.
Meine Mutter erzählte dem Cid nie die Wahrheit, aus Angst, er würde mich töten, weil es bei den Korsaren Brauch ist, die Kinder ihrer Gefangenen zu töten, wenn nicht ein Korsar der Vater ist.«
»Und die Frau, die mit euch an Bord war, war nicht deine Mutter?«
»Nein, sie war die Gefährtin des Cid, aber nicht meine Mutter, die ist tot.«
Tanar spürte eine deutliche Erleichterung, dass Stellara keine Korsarin war, aber warum das so war, wusste er nicht, versuchte aber auch nicht, seine Gefühle zu analysieren.
»Ich bin froh«, sagte er wieder.
»Aber warum?«, fragte sie.
»Jetzt müssen wir keine Feinde mehr sein«, antwortete er.
»Waren wir das vorher?«
Er zögerte, dann lachte er. »Ich war nicht dein Feind«, sagte er, »aber du hast mich daran erinnert, dass du meiner bist.«
»Ich habe mir ein Leben lang angewöhnt, mich für eine Korsarin zu halten«, erklärte Stellara, »aber ich wusste, dass ich es nicht bin. Ich empfand keine Feindschaft gegen dich.«
»Was immer wir gewesen sein mögen, wir müssen jetzt zwangsläufig Freunde sein«, sagte er ihr.
»Das hängt von dir ab«, erwiderte sie.