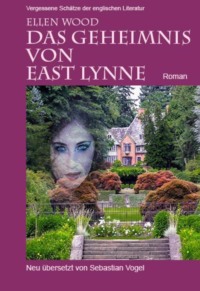Kitabı oku: «Das Geheimnis von East Lynne», sayfa 7
Kapitel 9 Lied und Totenklage
Das Konzert sollte am Donnerstag stattfinden, und Lord Mount Severn hatte die Absicht, East Lynne am folgenden Samstag endgültig zu verlassen. Die notwendigen Vorbereitungen für die Abreise waren im Gang, aber als der Donnerstagmorgen heraufdämmerte, erhob sich die Frage, ob die Pläne nicht wieder einmal zunichte gemacht werden sollten. Im Haus erhob man sich frühzeitig, und Mr. Wainwright, der Chirurg aus West Lynne, wurde an das Bett des Earl geholt; dieser hatte erneut einen heftigen Anfall erlitten. Der Lord war ausgesprochen verärgert, verdrießlich und sehr reizbar.
„Jetzt werde ich hier vielleicht noch eine Woche – zwei Wochen – einen Monat länger festgehalten!“, knurrte er mürrisch zu Isabel.
„Das tut mir sehr leid, Papa. Ich wage zu behaupten, dass du East Lynne langweilig findest.“
„Langweilig! Daran liegt es nicht; ich wünsche mir aus anderen Gründen, dass East Lynne uns loswird. Und jetzt kannst du nicht zu dem Konzert gehen.“
Isabels Gesicht wurde rot. „Nicht zum Konzert gehen, Papa?“
„Wer soll dich denn begleiten? Ich komme nicht aus dem Bett.“
„Aber Papa, ich muss dort sein. Ansonsten würde es fast aussehen, als ob … Als ob wir etwas verkündet hätten, was wir gar nicht wirklich vorhatten. Du weißt, es war ausgemacht, dass wir uns den Ducies anschließen; der Wagen kann mich immer noch zum Konzertsaal bringen, und ich kann mit ihnen hineingehen.“
„Wie es dir beliebt. Ich dachte, du hättest jeden Vorwand genutzt, um fernzubleiben.“
„Keineswegs“, lachte Isabel. „Ganz West Lynne soll sehen, dass ich Mr. Kane und sein Konzert nicht gering schätze.“
Im Lauf des Tages trat beim Earl eine beunruhigende Verschlechterung ein; seine Schmerzkrämpfe waren entsetzlich. Isabel wurde aus dem Krankenzimmer ferngehalten; sie wusste nichts von der Gefahr, und das Stöhnen des Earl drang nicht an ihre Ohren. Sie kleidete sich fröhlich und voller lachendem Eigensinn, während ihre Zofe Marvel in steifem Missvergnügen zusah, weil die ausgewählten Kleidungsstücke nicht ihre Zustimmung fanden. Als Isabel fertig war, ging sie ins Zimmer des Earl.
„Sehe ich gut aus, Papa?“
Lord Mount Severn hob die geschwollenen Augenlider und zog die Laken von seinem geröteten Gesicht. Vor ihm stand eine leuchtende Vision, eine Königin der Schönheit, eine glitzernde Fee; er erkannte sie kaum wieder. Sie hatte einen weißen Spitzenhut und ihre Diamanten angelegt; das Kleid war üppig, die Juwelen glitzerten an ihren zarten Armen; die Wangen waren leicht gerötet, und ihre Locken fielen fließend herab.
Der Earl starrte sie voller Verblüffung an. „Wie kannst du dich für ein Konzert so anziehen? Du bist nicht ganz bei Sinnen, Isabel.“
„Das findet Marvel auch“, lautete die fröhliche Antwort. „Sie macht ein böses Gesicht, seit ich ihr gesagt habe, was ich anziehen will. Aber ich habe das absichtlich gemacht, Papa; ich dachte, es würde den Leuten von West Lynne zeigen, dass ich den großen Augenblick des armen Mannes für wert halte, hinzugehen und mich dafür gut anzuziehen.“
„Der ganze Saal wird dich anstarren.“
„Das macht mir nichts aus. Ich werde dir genau davon berichten. Lassʼ sie ruhig starren.“
„Du eitles Kind! Du hast dich nur so angezogen, um in deiner Eitelkeit einen Gefallen zu tun. Aber, Isabel, du … oooh!“
Isabel zuckte zusammen; der Schmerzensschrei des Earl war entsetzlich.
„Ein unangenehmes Zwicken, mein Kind. Gehʼ ruhig; Sprechen macht es nur schlimmer.“
„Papa, soll ich bei dir zu Hause bleiben?“, fragte sie ernst. „Hinter der Krankheit müssen alle anderen Erwägungen zurückstehen. Wenn du möchtest, dass ich bleibe, oder wenn ich dir etwas Gutes tun kann, sagʼ es mir bitte.“
„Ganz im Gegenteil, es wäre mir lieber, wenn du weg bist. Du kannst für mich auf Erden nichts Gutes tun, denn ich könnte dich im Zimmer nicht ertragen. Auf Wiedersehen, mein Liebling. Wenn du Carlyle siehst, sagʼ ihm, ich hoffe ihn morgen zu sehen.“
Der Saal war schon zum Teil gefüllt, als Mrs. Ducie, ihre beiden Töchter und Lady Isabel eintraten und von Mr. Kane zu ihren Plätzen geführt wurden – Plätzen, die er für sie am oberen Ende in der Nähe des Orchesters reserviert hatte. Die gleiche schwindelerregende Vision, die sich den Blicken von Lord Mount Severn gezeigt hatte, präsentierte sich jetzt auch dem Publikum in Form von Isabel mit ihrem üppigen, weißen Kleid, den glitzernden Diamanten, den fließenden Locken und ihrer zauberhaften Schönheit. Die Töchter Ducie, einfache, in braune Seide gekleidete Mädchen, streckten die Nasen höher, als die Natur es ihnen vorgegeben hatte, und Mrs. Ducie stieß ein hörbares Seufzen aus.
„Das arme Mädchen hat keine Mutter und ist zu bedauern, meine Lieben“, flüsterte sie; „sie hat niemanden, der ihr zeigt, was eine angemessene Kleidung ist. Diese lächerliche Staffage ist sicher Marvels Werk.“
Aber ob die „Staffage“ nun lächerlich war oder nicht, sie sah aus wie eine Lilie zwischen Mohn- und Sonnenblumen. Hatte Lord Mount Severn recht, als er ihr vorwarf, sie habe sich aus Selbstsucht so gekleidet? Sehr wahrscheinlich, denn hat der große Prediger nicht gesagt, Kindheit und Jugend seien Eitelkeit?
Miss Carlyle, der Richter und Barbara hatten ebenfalls Plätze in der Nähe des Orchesters, denn Miss Carlyle war in West Lynne eine Person, auf die man Rücksicht nehmen musste, und versteckte sich nicht hinter anderen. Mr. Carlyle dagegen zog es vor, sich den Gentlemen anzuschließen, die an der Tür innen und außen zusammenstanden. Mittlerweile war im Saal kaum noch ein Stehplatz frei; Mr. Kane hatte erwartungsgemäß gute Einnahmen; der arme Mann hätte Lady Isabel anbeten können, wusste er doch, dass er es ihr zu verdanken hatte.
Es war ein langes Konzert – was auf Landkonzerte allgemein zutrifft –, und als es ungefähr zu drei Vierteln vorüber war, konnte man sehen, wie ein gepuderter Kopf, größer als jeder Blumenkohl, hinter der Gruppe der Gentlemen die Treppe heraufkam; als der zugehörige Körper vollständig zu sehen war, stellte sich heraus, dass der Kopf zu einem der Lakaien des Lord Mount Severn gehörte. Schon die in Seidenstrümpfe eingeschlossenen Waden waren ein sehenswerter Anblick; und diese Waden begaben sich mit einer missbilligenden Verbeugung gegenüber den Gentlemen, zwischen denen sie hindurchsteuern mussten, in den Konzertsaal. Dort kamen sie zum Stillstand, der Blumenkohl streckte sich nach vorn und drehte sich von rechts nach links.
„He, ich bin auch noch da!“, rief ein verärgerter alter Fuchsjäger, der einen Ellenbogen des Lakaien abbekommen hatte. „Was solche Burschen doch für eine Frechheit besitzen!“
Der fragliche Bursche war aber nicht gekommen, um in diesem Augenblick ein großes Maß an Frechheit an den Tag zu legen; vielmehr blickte er verwirrt, demütig und unbehaglich drein. Plötzlich fiel sein Blick auf Mr. Carlyle, und sein Gesicht hellte sich auf.
„Ich bitte um Verzeihung, Sir; könnten Sie mich vielleicht in Kenntnis setzen, an welcher Stelle meine junge Lady sitzt?“
„Am anderen Ende des Saales in der Nähe des Orchesters.“
„Dann weiß ich ganz sicher nicht, wie ich zu ihr kommen soll“, gab der Mann mehr im Selbstgespräch als zu Mr. Carlyle zurück. „Der Saal ist proppenvoll, und ich dränge mich nicht gern durch. Meinem Herrn geht es beunruhigend viel schlechter, Sir“, erklärte er in demütigem Ton. „Es steht zu fürchten, dass er stirbt.“
Mr. Carlyle war schmerzlich beunruhigt.
„Seine Schmerzensschreie waren entsetzlich, Sir. Mr. Wainwright und ein anderer Doktor aus West Lynne sind bei ihm, und ein Eilbote soll aus Lynneboroʼ weitere Ärzte holen. Mrs. Mason hat gesagt, wir sollen meine junge Lady sofort nach Hause bringen und keinen Augenblick verlieren; wir haben auch den Wagen mitgebracht Sir, und Wells hat seine Pferde den ganzen Weg galoppieren lassen.“
„Ich bringe Lady Isabel zu Ihnen“, sagte Mr. Carlyle.
„Ich werde Ihnen mit Sicherheit immer zu Dank verpflichtet sein, wenn sie das tun“, gab der Mann zurück.
Mr. Carlyle bahnte sich den Weg durch den Konzertsaal – er war groß und schlank; viele Blicke trafen ihn wie Dolche, denn gerade gab eine Dame aus London ein pathetisches Lied zum Besten. Er kümmerte sich um niemanden und stand kurz darauf vor Isabel.
„Ich hatte nicht geglaubt, dass Sie heute Abend kommen und mit mir sprechen“, sagte sie. „Ist das nicht ein großartiger Saal? Ich freue mich so!“
„Mehr als großartig, Lady Isabel.“ Er wählte seine Worte sorgfältig, um sie nicht zu beunruhigen. „Lord Mount Severn fühlt sich nicht wohl und hat den Wagen für Sie geschickt.“
„Papa fühlt sich nicht wohl!“, rief sie hastig aus.
„Nicht sehr. Jedenfalls wünscht er, dass Sie nach Hause kommen. Würden Sie erlauben, dass ich Sie durch den Saal führe?“
„Ach, mein lieber, rücksichtsvoller Papa!“, lachte sie. „Er fürchtet, ich könne der Musik überdrüssig sein, und will mich vor der Zeit befreien. Ich danke Ihnen, Mr. Carlyle, aber ich werde bis zum Ende bleiben.“
„Nein, nein, Lady Isabel, so ist es nicht. Es geht Lord Mount Severn tatsächlich schlechter.“
Ihre Miene wurde ernst; aber beunruhigt war sie nicht. „Nun gut. Wenn das Lied zu Ende ist – stören Sie nicht den ganzen Saal.“
„Ich denke, Sie sollten besser keine Zeit verlieren“, drängte er. „Kümmern Sie sich nicht um das Lied und den Saal.“
Sie erhob sich augenblicklich und legte ihren Arm in den von Mr. Carlyle. Einige hastige Worte der Erklärung zu Mrs. Ducie, und er führte sie davon; im Saal machte man überrascht so viel Platz, wie möglich war. Viele Blicke folgten ihnen, aber keiner war neugieriger und eifriger als der von Barbara Hare. „Wohin bringt er sie?“, murmelte sie unwillkürlich.
„Woher soll ich das wissen?“, gab Miss Corny zurück. „Barbara, Sie haben den ganzen Abend noch nichts anderes getan als herumzuzappeln; was ist in Sie gefahren? Die Leute kommen zum Zuhören zu einem Konzert, aber nicht um zu reden und zu zappeln.“
Isabels Mantel wurde aus dem Vorraum geholt, wo sie ihn zurückgelassen hatte, und sie ging mit Mr. Carlyle die Treppe hinunter. Der Wagen war unmittelbar vor dem Eingang vorgefahren, und der Kutscher hielt die Zügel in der Hand, bereit, abzufahren. Ein Lakai – nicht derjenige, der nach oben gegangen war – riss die Wagentür auf, als er sie sah. Er war neu im Dienst, ein einfacher, gerade erst eingestellter Einheimischer vom Land. Sie nahm ihre Hand von Mr. Carlyles Arm und blieb einen Augenblick stehen, bevor sie einstieg. Dabei sah sie den Mann an.
„Geht es Papa sehr viel schlechter?“
„Oh ja, Mylady. Er hat schrecklich geschrien. Aber sie nehmen an, dass er noch bis morgen früh leben wird.“
Mit einem spitzen Schrei griff sie nach dem Arm von Mr. Carlyle – griff danach, um sich im Schrecken ihrer Qual darauf zu stützen. Mr. Carlyle drängte den Mann grob weg. Am liebsten hätte er ihn der Länge nach auf das Straßenpflaster gestoßen.
„Ach, Mr. Carlyle, warum haben Sie mir das nicht gesagt?“, schauderte sie.
„Meine liebe Lady Isabel, ich bin betrübt, dass Sie es jetzt erfahren haben. Aber trösten Sie sich; Sie wissen ja, wie krank er oftmals ist, und möglicherweise ist das nur ein normaler Anfall. Steigen Sie ein. Ich bin zuversichtlich, dass es sich als nichts anderes erweist.“
„Begleiten Sie mich nach Hause?“
„Natürlich; ich lasse Sie doch nicht allein gehen.“
Sie rückte in der Kutsche auf die andere Seite und machte ihm Platz.
„Vielen Dank. Ich werde außen sitzen.“
„Aber es ist eine kalte Nacht.“
„Ach nein.“ Er schloss die Tür und nahm neben dem Kutscher Platz; der Lakai stieg hinten auf, und die Kutsche raste davon. Isabel kauerte sich in ihrer Ecke zusammen und stöhnte laut vor Ungewissheit und Hilflosigkeit.
Der Kutscher fuhr schnell und peitschte die Pferde schon wenig später durch das Gartentor.
Mrs. Mason, die Haushälterin, wartete an der Tür zur Diele und nahm Lady Isabel in Empfang. Mr. Carlyle half ihr beim Aussteigen und bot ihr die Stufen hinauf seinen Arm. Sie wagte kaum, eine Frage zu stellen.
„Geht es ihm besser? Darf ich in sein Zimmer gehen?“, keuchte sie.
Ja, dem Earl ging es besser – jedenfalls insofern, dass er ruhig und empfindungslos war. Hastig eilte sie in sein Schlafzimmer. Mr. Carlyle nahm die Haushälterin beiseite.
„Besteht irgendeine Hoffnung?“
„Nicht die geringste, Sir. Er liegt im Sterben.“
Der Earl erkannte niemanden mehr; die Schmerzen waren vorerst verschwunden, und er lag ruhig im Bett; aber sein Gesicht, in dem der Tod nur allzu deutlich geschrieben stand, ließ Isabel zusammenzucken. Sie schrie nicht und weinte nicht; sie war vollkommen still und hatte nur einen Anfall von Zittern.
„Wird es ihm bald besser gehen?“, flüsterte sie zu Mr. Wainwright, der neben ihr stand.
Der Chirurg hustete. „Nun ja, er … er … wir müssen darauf hoffen, Mylady.“
„Aber warum sieht denn sein Gesicht so aus? Es ist blass – ganz grau; ich habe noch nie gesehen, dass jemand so aussieht.“
„Er hatte starke Schmerzen, Mylady, und Schmerzen hinterlassen ihre Spuren im Gesicht.“
Mittlerweile war Mr. Carlyle hinzugekommen. Er stand neben dem Chirurg, berührte dessen Arm und wollte ihn aus dem Zimmer ziehen. Ihm war der Gesichtsausdruck des Earl aufgefallen, und er gefiel ihm nicht; deshalb wollte er den Chirurgen befragen. Lady Isabel sah, dass Mr. Carlyle im Begriff stand, das Zimmer zu verlassen, und winkte ihn zu sich.
„Gehen Sie nicht aus dem Haus, Mr. Carlyle. Wenn er aufwacht, heitert es ihn vielleicht auf, wenn er Sie hier sieht; er mochte Sie immer sehr gern.“
„Ich werde nicht gehen, Lady Isabel. Ich denke gar nicht daran.“
Nach einiger Zeit – es schien eine Ewigkeit zu sein – trafen die Ärzte aus Lynneborough ein. Es waren drei – der Stallknecht hatte gedacht, er könne gar nicht zu viele holen. Sie trafen auf eine seltsame Szenerie: der totenbleiche Adlige, der jetzt wieder unruhig wurde und mit seinem scheidenden Geist kämpfte, und die Galakleider mit den glitzernden Juwelen, die das junge Mädchen an seiner Seite schmückten. Sie verstanden die Umstände sofort: Man hatte sie sehr plötzlich von einem Ort der Fröhlichkeit geholt.
Sie beugten sich hinunter, betrachteten den Earl, fühlten seinen Puls, berührten sein Herz und tauschten mit Mr. Wainwright einige halblaute Worte aus. Isabel war zurückgetreten, um ihnen Platz zu machen, aber ihre ängstlichen Blicke folgten jeder ihrer Bewegungen. Es schien, als bemerkten sie das Mädchen nicht, und so trat sie nach vorn.
„Können Sie irgendetwas für ihn tun? Wird er wieder gesund werden?“
Alle wandten sich der Fragestellerin zu und sahen sie an. Einer ergriff das Wort; er gab eine ausweichende Antwort.
„Sagen Sie mir die Wahrheit!“, flehte sie ihn mit fiebriger Ungeduld an: „Sie dürfen es sich mit mir nicht zu leicht machen. Kennen Sie mich nicht? Ich bin sein einziges Kind, und ich bin allein hier.“
Als Erstes musste man sie aus dem Zimmer haben, denn die große Veränderung rückte näher, und die Trennung von Körper und Seele konnte zu einem Krieg werden – kein Anblick für seine Tochter. Aber als Antwort auf den Hinweis, sie solle gehen, legte sie nur den Kopf neben ihrem Vater auf das Kissen und stöhnte voller Verzweiflung.
„Sie muss aus dem Zimmer gehen“, rief einer der Ärzte fast wütend. „Madam“, wandte er sich plötzlich an Mrs. Mason, „gibt es im Haus sonst keine Angehörigen – niemanden, der Einfluss auf die junge Dame ausüben könnte?“
„Sie hat auf der ganzen Welt so gut wie keine Angehörigen“, erwiderte die Haushälterin, „zumindest keine nahen; und gerade jetzt sind wir zufällig ganz allein.“
Mr. Carlyle erkannte, wie dringend die Sache war, denn der Earl wurde mit jeder Minute erregter. Also näherte er sich ihr und flüsterte ihr zu: „Sie haben um die Genesung Ihres Vaters so viel Angst, wie man es sich nur vorstellen kann?“
„So viel Angst!“, murmelte sie vorwurfsvoll.
„Sie wissen, was ich damit sagen will. Natürlich ist unsere Angst nichts gegenüber der Ihren.“
„Nichts – wirklich nichts. Ich habe das Gefühl, als würde mein Herz brechen.“
„Dann – verzeihen Sie mir – sollten Sie sich den Wünschen dieser medizinischen Berater nicht widersetzen. Sie wollen mit ihm allein sein, und wir verlieren Zeit.“
Sie erhob sich und legte die Hände an die Stirn, als wolle sie den Sinn der Worte begreifen. Dann wandte sie sich an die Ärzte:
„Ist es wirklich notwendig, dass ich den Raum verlasse – notwendig für ihn?“
„Es ist notwendig, Mylady – absolut notwendig.“
Als Mr. Carlyle sie in ein anderes Zimmer führte, brach sie voller Leidenschaft in Tränen und Schluchzen aus.
„Er ist mein geliebter Vater; außer ihm habe ich niemanden auf der ganzen Welt!“, stieß sie hervor.
„Ich weiß … ich weiß; ich fühle von ganzem Herzen mit Ihnen. Zwanzigmal in dieser Nacht habe ich mir gewünscht – verzeihen Sie mir den Gedanken –, Sie wären meine Schwester, sodass ich mein Mitgefühl freimütiger zum Ausdruck bringen und Sie trösten könnte.“
„Dann sagen Sie mir die Wahrheit: Warum werde ich ferngehalten? Wenn Sie mir ausreichende Gründe nennen können, werde ich vernünftig sein und gehorchen; aber sagen Sie nicht noch einmal, ich würde ihn stören, denn das stimmt nicht.“
„Er ist zu krank, als dass Sie ihn sehen könnten – seine Symptome sind zu schmerzhaft. Es wäre wirklich nicht richtig; und wenn Sie entgegen den Ratschlägen hingehen, werden Sie es später Ihr ganzes Leben lang bereuen.“
„Stirbt er?“
Mr. Carlyle zögerte. Sollte er ihr gegenüber heucheln, wie die Ärzte es getan hatten? Ihn beschlich das starke Gefühl, dass er es nicht tun sollte.
„Ich vertraue Ihnen, dass Sie mich nicht täuschen“, sagte sie schlicht.
„Ich fürchte es … ich glaube es.“
Sie erhob sich und griff, von plötzlicher Angst übermannt, nach seinem Arm.
„Sie täuschen mich. Er ist schon tot!“
„Ich täusche Sie nicht, Lady Isabel. Er ist nicht tot, aber … es könnte sehr bald bevorstehen.“
Sie legte ihr Gesicht auf das weiche Kissen.
„Er geht für immer von mir – für immer? Ach, Mr. Carlyle, lassen Sie ihn mich nur für eine Minute sehen – nur ein einziges Lebewohl! Verwehren Sie mir das nicht!“
Er wusste, wie hoffnungslos es war, aber er wandte sich um und wollte das Zimmer verlassen.
„Ich werde nachsehen. Aber Sie bleiben in aller Stille hier – Sie kommen nicht.“
Sie neigte zustimmend den Kopf, und er schloss die Tür. Wäre sie tatsächlich seine Schwester gewesen, er hätte vermutlich vor ihr den Schlüssel umgedreht. Er betrat die Kammer des Earl, blieb aber nur wenige Sekunden darin.
„Es ist vorüber“, flüsterte er Mrs. Mason zu, die ihm im Korridor begegnete, „und Mr. Wainwright fragt nach Ihnen.“
„Sie kommen so schnell zurück“, rief Isabel und hob den Kopf. „Darf ich hineingehen?“
Er setzte sich und nahm ihre Hand. Die Aufgabe ließ ihn zurückschrecken.
„Es wäre schön, wenn ich Sie trösten könnte!“, rief er in zutiefst bewegtem Ton.
Ihr Gesicht nahm ein gespenstisches Weiß an – ein Weiß, nicht weit entfernt von dem eines anderen.
„Sagen Sie mir das Schlimmste“, hauchte sie.
„Ich habe Ihnen nichts zu sagen außer dem Schlimmsten. Möge Gott Ihnen eine Stütze sein, liebe Lady Isabel!“
Sie wandte sich ab, um ihr Gesicht und ihren Kummer vor ihm zu verbergen; ein leises, qualvolles Wimmern brach aus ihr heraus und erzählte seine eigene Geschichte der Verzweiflung.
Das graue Dämmerlicht des Morgens brach über die Welt herein und kündigte einen weiteren geschäftigen Tag in der Geschichte des Lebens an; aber die Seele von William Vane, Earl of Mount Severn, war für immer davongeschwebt.
Kapitel 10 Die Wächter des Toten
Zwischen dem Tod von Lord Mount Severn und seiner Bestattung überstürzten sich die Ereignisse; bei einem davon ist der Leser vielleicht geneigt, Einwände zu erheben und zu glauben, es habe keine Grundlage in den Tatsachen, in den Abläufen des wahren Lebens, sondern müsse eine wilde Schöpfung aus dem Gehirn der Autorin sein. Wer das meint, hat Unrecht. Die Autorin liebt wilde Schöpfungen nicht mehr als der Leser. Die Ereignisse haben sich tatsächlich so abgespielt.
Der Earl starb am Freitagmorgen bei Tagesanbruch. Die Nachricht verbreitete sich schnell. Das geschieht beim Tod eines Adligen regelmäßig, wenn er im guten oder im schlechten Sinn in der Welt wahrgenommen wurde. Bevor der Tag vorüber war, wusste man es auch in London – und das hatte zur Folge, dass am frühen Samstagmorgen ein ganzer Schwarm von Harpyien, wie der Earl sie genannt hätte, eingetroffen war und East Lynne umkreiste. Es waren Gläubiger aller Arten; für kleine und große Summen, von fünf oder zehn Pfund bis hin zu fünf- oder zehntausend. Manche waren höflich, manche ungeduldig, manche laut und grob und wütend; manche kamen, um die Vollstreckung in die Vermögenswerte zu erwirken, und einige – um die Leiche festzunehmen!
Diese letzte Maßnahme wurde auf schlaue Weise vollzogen. Zwei Männer, beide mit bemerkenswerten Hakennasen, schlichen sich aus der Menge der Johlenden davon, sahen sich listig um und begaben sich zum Seiten- oder Lieferanteneingang. Auf ihr sanftes Betätigen der Glocke erschien ein Küchenmädchen.
„Ist der Sarg schon gekommen?“, fragten sie.
„Sarg – nein!“, lautete die Antwort des Mädchens. „Das Gehäuse ist noch nicht da. Mr. Jones hat es erst für neun Uhr versprochen, und jetzt ist es noch nicht acht.“
„Das wird nicht lange dauern“, erwiderten sie. „Er ist unterwegs. Wir möchten bitte hinauf in das Zimmer seiner Lordschaft gehen und ihn vorbereiten.“
Das Mädchen rief den Butler. „Zwei Männer von Jones, dem Leichenbestatter, Sir“, verkündete sie. „Demnächst kommt der Sarg, und sie wollen hinaufgehen und ihn vorbereiten.“
Der Butler führte sie selbst die Treppe hinauf und ließ sie in das Zimmer. „Das reicht“, sagten sie, als er mit ihnen eintreten wollte. „Sie müssen sich nicht die Mühe machen zu warten.“ Nachdem sie die Tür hinter dem ahnungslosen Butler geschlossen hatten, bezogen sie beiderseits des Toten Position wie zwei unheilvolle Klageweiber. Sie hatten eine Verhaftung der Leiche vorgenommen; sie gehörte ihnen, bis ihr Anspruch befriedigt war, deshalb setzten sie sich, um den Toten zu beobachten und zu sichern. Welch angenehme Beschäftigung!
Vielleicht eine Stunde später kam Lady Isabel aus ihrem Zimmer und öffnete geräuschlos die Tür zur Kammer des Toten. Am Tag zuvor war sie mehrmals dort gewesen – das erste Mal mit der Haushälterin, und danach, als das unsägliche Entsetzen sich ein wenig gelegt hatte, allein. Dennoch war sie an diesem Morgen wiederum nervös und hatte das Bett bereits erreicht, bevor sie es wagte, den Blick vom Teppich zu heben und sich dem Anblick zu stellen. Jetzt fuhr sie zurück, saßen dort doch zwei seltsam aussehende Männer – und attraktive Männer waren es auch nicht.
Ihr schoss der Gedanke durch den Kopf, es müssten Leute aus der Nachbarschaft sein, die gekommen waren, um eine müßige, unverzeihliche Neugier zu befriedigen. In einem ersten Impuls wollte sie den Butler rufen; im zweiten sprach sie die Männer selbst an.
„Suchen Sie hier etwas?“, fragte sie leise.
„Verbindlichen Dank für die Nachfrage, Miss. Alles in Ordnung.“
Worte und Tonfall erschienen ihr äußerst eigenartig; außerdem waren sie sitzen geblieben, als hätten sie ein Recht, hier zu sein.
„Warum sind Sie hier?“, wiederholte sie. „Was tun Sie hier?“
„Naja, Miss, ich habʼ nix dagegen, es Ihnen zu sagen, denn Sie sind ja wohl seine Tochter“ – wobei er mit dem linken Daumen über die Schulter zu dem verstorbenen Earl wies – „und wie man hört, hat er sonst keine nahen Angehörigen. Wir sind verpflichtet, Miss, ʼne unangenehme Aufgabe zu erfüllen und ihn festzunehmen.“
Die Worte hörten sich für sie wie Griechisch an, was die Männer auch erkannten.
„Leider is er ʼnen kleinen Geldbetrag schuldig geblieben, Miss – was Sie vielleicht wissen, unsere Auftraggeber wissen es jedenfalls. Als die gehört haben, was passiert is, ham se uns geschickt, damit wir die tote Leiche festnehmen, und das ham wer gemacht.“
In der erschrockenen Lady Isabel kämpften Verblüffung, Entsetzen und Angst. Den Toten festnehmen? Von einer ähnlichen Übeltat hatte sie noch nie gehört, und sie hatte auch nie an so etwas geglaubt. Festnehmen zu welchem Zweck? Um was zu tun? Um sie zu entstellen? – Zu verkaufen? Mit pochendem Herzen und aschfahlen Lippen wandte sie sich um und verließ das Zimmer. Zufällig kam Mrs. Mason in der Nähe der Treppe vorüber. Isabel lief in ihrem Entsetzen zu ihr, fasste ihre beiden Hände und brach in eine Flut von nervösen Tränen aus.
„Diese Männer – da drin!“, keuchte sie.
„Welche Männer, Mylady?“, gab Mrs. Mason überrascht zurück.
„Ich weiß es nicht; ich weiß es nicht. Ich glaube, sie wollen nicht hierbleiben; sie sagen, sie hätten Papa festgenommen.“
Nach einer Pause voller fassungslosem Erstaunen wandte sich die Haushälterin auf dem Absatz um und ging in das Zimmer des Earl; sie wollte wissen, ob sie die rätselhaften Worte durchschauen konnte. Isabel lehnte sich gegen das Treppengeländer, zum Teil, um sich zu stützen, zum Teil aber auch, weil sie Angst hatte, sich von ihnen weg zu bewegen; von unten drangen rätselhafte Geräusche an ihre Ohren. Fremde, Eindringlinge waren offensichtlich in der Diele, redeten hektisch und in bitter klagenden Ton. In immer größerem Entsetzen hielt sie die Luft an und hörte zu.
„Wozu soll es gut sein, dass Sie die junge Dame sehen?“, rief der Butler in tadelndem Ton. „Sie weiß nichts über die Angelegenheiten des Earl; sie hat jetzt schon genug Kummer, auch ohne weitere Sorgen.“
„Ich werde sie sehen“, erwiderte eine verärgerte Stimme. „Wenn sie so vornehm und edel ist, dass sie nicht herunterkommen und die eine oder andere Frage beantworten kann, werde ich den Weg zu ihr schon finden. Wir sind hier beschämend viele, die beschwindelt worden sind, und jetzt sagt man uns, es gebe niemanden, mit dem wir sprechen können; niemand hier außer der jungen Dame, und die darf nicht gestört werden. Es hat sie nicht gestört, dass sie mitgeholfen hat, unser Geld auszugeben. Wenn sie nicht herkommt und mit uns spricht, hat sie nicht die Ehre und die Gefühle einer Lady. Basta.“
Lady Isabel unterdrückte ihre widerstrebenden Gefühle, glitt die Treppe ein Stück weiter herunter und rief leise nach dem Butler. „Was hat das alles zu bedeuten?“, fragte sie. „Ich muss es wissen.“
„Ach, Mylady, begeben Sie sich nicht unter diese groben Männer! Sie können nichts ausrichten; bitte gehen Sie zurück, bevor sie Ihrer ansichtig werden. Ich habe nach Mr. Carlyle geschickt und erwarte ihn hier jeden Augenblick.“
„Hat Papa denen allen Geld geschuldet?“, fragte sie und schauderte.
„Ich fürchte, so ist es, Mylady.“
Sie ging schnell weiter, kam in der Diele an den wenigen Nachzüglern vorüber und betrat das Esszimmer, wo sich die Hauptmenge versammelt hatte und das Geschrei am lautesten war. Bei ihrem Anblick wurde alle Wut zumindest äußerlich gedämpft. Sie sah so jung, so unschuldig, so kindlich aus in ihrem hübschen Morgenkleid aus pfirsichfarbenem Musselin; das Gesicht, das von den fallenden Locken überschattet war, schien so wenig in der Lage, mit ihnen zu kämpfen oder ihr Anliegen zu verstehen, dass sie Isabel nicht mit Beschwerden überschütteten, sondern in Schweigen verfielen.
„Ich habe gehört, wie einer von Ihnen gerufen hat, ich solle zu Ihnen kommen“, begann sie. Ihre Aufregung hatte zur Folge, dass die Worte abgehackt herauskamen. „Was wollen Sie von mir?“
Jetzt sprudelten sie mit ihren Anliegen heraus, wenn auch nicht wütend; sie hörte zu, bis ihr übel wurde. Es waren viele beträchtliche Forderungen; Schuldbriefe und Schuldscheine, überfällige Rechnungen und unbezahlte Rechnungen; hohe, ausstehende Schulden aller Art und relative Kleinigkeiten, Forderungen für Hausverwaltung, Bedienstetenuniformen, Gärtnerlohn, Brot und Fleisch.
Was sollte Isabel Vane antworten? Welche Entschuldigung konnte sie vorbringen? Welche Hoffnungen oder Versprechungen machen? Verwirrt stand sie da, wandte sich, unfähig zu sprechen, von einem zum anderen, die Augen voller Mitleid und Zerknirschung.
„Eigentlich, junge Lady“ ergriff einer das Wort, der das Äußere eines Gentleman zur Schau trug, „hätten wir nicht herkommen und Ihnen Ungelegenheiten bereiten sollen – zumindest kann ich das für mich sagen –, aber die geschäftlichen Vertreter seiner Lordschaft, Warburton & Ware, zu denen viele von uns gestern Abend eilig gegangen sind, haben uns gesagt, wir würden für niemanden auch nur einen Schilling finden, es sei denn, man könne das Mobiliar zu Geld machen. Wenn das so ist, heißt es ‚wer zuerst kommt, mahlt zuerst‘; deshalb bin ich im Morgengrauen hergekommen und habe eine Vollstreckung vorgenommen.“
„Die wurde schon vorgenommen, bevor Sie gekommen sind“, warf ein Mann ein, der, nach seiner Nase zu urteilen, ein Bruder der beiden in der oberen Etage sein konnte. „Aber was ist ein solches Mobiliar schon für unsere Forderungen – wenn man sie zusammennimmt? Nicht mehr als ein Eimer Wasser für die Themse.“
„Was kann ich tun?“, schauderte Lady Isabel. „Was soll ich Ihrer Ansicht nach tun? Ich habe kein Geld, das ich Ihnen geben könnte, ich …“
„Nein, Miss“, unterbrach sie ein stiller, blasser Mann. „Wenn die Berichte stimmen, wurde Ihnen noch schlimmeres Unrecht getan als uns, denn Sie werden weder ein Dach über dem Kopf noch eine einzige Guinee haben, die Sie Ihr Eigentum nennen könnten.“
„Er war gegenüber allen ein Schuft“, unterbrach eine unbeherrschte Stimme. „Er hat Tausende ruiniert.“
Der Sprecher wurde niedergezischt; nicht einmal diese Männer beleidigten leichtfertig eine empfindsame junge Dame.
„Vielleicht können Sie uns nur eine Frage beantworten, Miss“, beharrte die Stimme trotz des Zischens. „Gibt es irgendwo Geld, mit dem man …“
Aber mittlerweile hatte ein anderer das Zimmer betreten: Mr. Carlyle. Als er Isabels weißen Gesichtes und ihrer zitternden Hände ansichtig wurde, unterbrach er den, der zuletzt gesprochen hatte, ohne große Umschweife.