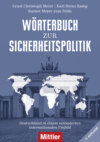Kitabı oku: «Wörterbuch zur Sicherheitspolitik», sayfa 19
Darfur-Konflikt
Im ~ stehen sich Einheiten der sudanesischen Zentralregierung in Khartum und mit ihr verbündeter arabischstämmiger Reitermilizen (Janjaweed) und Milizen der Sudanesischen Befreiungsbewegung (Sudan Liberation Movement – SLM/Sudan Liberation Army – SLA) und der Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit (Justice and Equality Movement – JEM) als Interessenvertreter überwiegend schwarzafrikanischer Stämme gegenüber.
Der im Februar 2003 eskalierte Konflikt in Darfur forderte bisher nach Schätzungen der Vereinten Nationen etwa 300.000 Todesopfer. Mindestens zwei Millionen Menschen wurden vertrieben, davon ca. 200.000 in das Nachbarland Tschad. Damit hat dieser Konflikt zu einer der größten humanitären Katastrophen weltweit geführt. Eine – auch auf Initiative der Bundesregierung – eingesetzte VN-mandatierte internationale Untersuchungskommission stellte schon 2005 fest, dass die sudanesische Regierung und die mit ihr verbündeten Janjaweed-Milizen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verantwortlich sind. Der sudanesischen Befreiungsbewegung und der Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit werden ebenfalls Kriegsverbrechen zur Last gelegt. Nachdem der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag, Luis Moreno Ocampo, am 14. Juli 2008 noch eine Anklage wegen Völkermordes gegen den amtierenden sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir beantragte, hat der IStGH im März 2009 einen Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgestellt.
Zur Überwachung der fragilen Waffenstillstands- und Friedensabkommen (von 2004/2006) war seit 2004 zunächst eine Friedensmission der Afrikanischen Union (AU), AMIS, im Einsatz, seit Anfang 2008 eine gemeinsame Friedensmission der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union, UNAMID. Nachdem nicht alle Konfliktparteien das maßgeblich von der AU vermittelte Darfur-Friedensabkommen von 2006 unterzeichnet hatten und die Darfur-Rebellen sich weiter aufgespalten haben, werden seit Mai 2011 in einem neuen Ansatz Darfur-Verhandlungen in Doha mit dem Ziel geführt, die beteiligten Hauptkonfliktgruppen in einen Dialogprozess und eine Friedensregelung einzubinden. Mit einer nachhaltigen Verbesserung der Lage in Darfur ist nur dann zu rechnen, wenn eine umfassende politische Lösung für den ~ gefunden wird. Die Initiative, mit einem umfassenden »Nationalen Dialog« den ~ zu befrieden, war bis jetzt noch nicht erfolgreich, da noch nicht alle Oppositionsgruppen eingebunden werden konnten. Der Konflikt hat unverändert starke regionale Auswirkungen mit erheblichem Destabilisierungspotenzial, u. a. mit der Folge einer Ausweitung der Flüchtlingsproblematik auf die Nachbarländer Tschad, Libyen und die Zentralafrikanische Republik.
Dayton-Abkommen
Auf der amerikanischen Air Base von Dayton (Ohio) verhandelte völkerrechtliche Vereinbarung zur Friedensregelung nach dem Krieg in Bosnien-Herzegowina (1992–1995), die am 14. Dezember 1995 als »General Framework Agreement for Peace« in Paris unterzeichnet wurde. Das ~ beinhaltet einen politischen und einen militärischen Teil.
Politischer Teil
Der staatliche Fortbestand Bosnien-Herzegowinas wird in Form einer Föderation garantiert. Die Serben behalten danach 49 Prozent des Staatsgebiets, die muslimisch-kroatische Föderation 51 Prozent. Sarajevo bleibt Hauptstadt. Die Bundesregierung trägt Verantwortung für sämtliche Bereiche der Außenpolitik, des Transportwesens und der Geldpolitik. Die Teilstaaten erhalten dagegen weit reichende Kompetenzen, wie z. B. Vertragsschlüsse mit anderen Staaten oder die Vergabe einer eigenen Staatsangehörigkeit. Darüber hinaus wurden die Anerkennung des Heimatrechts der Flüchtlinge, die Einhaltung der Menschenrechte, die Verpflichtung, Kriegsverbrecher von öffentlichen Funktionen auszuschließen sowie die Verpflichtung, demokratische Wahlen abzuhalten, vereinbart.
Militärischer Teil
Enthält Abmachungen über Rückzug, Entmilitarisierung und Gefangenenaustausch in Bosnien. Es wurde die Stationierung einer ca. 60.000 Mann starken Friedenstruppe (IFOR) unter dem Kommando der NATO vereinbart, die die Umsetzung des ~ überwachen sollte. Balkankonflikt
DCI NATO Defence Capabilities Initiative
Deeskalation
(engl.: deescalation)
1. Verminderung oder Begrenzung von Spannungen, Krisen und Konflikten.
2. In einem bewaffneten Konflikt der Versuch seiner Verlagerung auf eine qualitativ niedrigere Ebene zum Zwecke der Kriegsbeendigung. Eskalation; Krisenbewältigung
De-facto-Flüchtling
Person, die keinen Asylantrag gestellt hat oder deren Asylantrag abgelehnt worden ist, der aber aus humanitären oder politischen Gründen die Rückkehr in ihr Heimatland nicht zumutbar ist, sowie Personen, die ursprünglich aus diesen Gründen Aufnahme gefunden haben und sich immer noch im Bundesgebiet aufhalten.
Defätismus
Zweifel am politischen oder militärischen Erfolg. Der Begriff ist in Frankreich im Ersten Weltkrieg entstanden, der für das Zweifeln am alliierten Sieg gegen Deutschland und für Anhänger eines Verständigungsfriedens geprägt wurde.
DEFRAM
Grundsatzartikel »Deutsch-französische Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik«
Deklaratorische Politik
Politische Erklärung, die aufgrund fehlenden politischen Durchsetzungswillens, unzureichender Mittel oder zu geringer Macht nicht in angewandte Politik umsetzbar ist.
Dekontamination
Maßnahmen zur Entstrahlung, Entseuchung, Entwesung und Entgiftung von Personal und Material. ABC-Waffen; ABC-Abwehr
Delimitation Grenzfestlegung
Demarche
(franz.: démarche)
In den internationalen Beziehungen der diplomatische Einspruch gegenüber einem anderen Staat mit der Absicht, diesen von einem bestimmten Handeln abzubringen oder zu einem bestimmten Tun zu bewegen.
Demarkation Grenzziehung
Demobilmachung
Gesamtheit aller Maßnahmen, die im Rahmen eines Deeskalations-/Disengagementsprozesses nach erfolgreicher Krisenbewältigung oder Beendigung von Kampfhandlungen auf der Grundlage bündnisgemeinsamer und nationaler politischer und militärischer Entscheidungen darauf ausgerichtet sind, den organisatorischen, personellen und materiellen Zustand von Streitkräften vor der Mobilmachung ganz oder in Teilen wiederherzustellen.
Demografischer Wandel
Der ~ gehört zu den globalen Megatrends, der für Deutschland und andere entwickelte Industriestaaten nicht nur gesellschaftliche und soziale, sondern auch sicherheitspolitische Herausforderungen mit sich bringen kann. Die Weltbevölkerung wird bis 2050 um etwa ein Drittel auf 9,1 Mrd. Menschen zunehmen, gleichzeitig wird sie altern, indem das Durchschnittsalter von derzeit 29 auf 38 Jahre ansteigen wird. Der ~ fällt in verschiedenen Staatengruppen und Regionen unterschiedlich aus, die jeweiligen nationalen Herausforderungen stellen sich entsprechend unterschiedlich dar. Der Zusammenhang zwischen Demografie und Sicherheit ist demzufolge erheblich differenzierter und weniger vorhersehbar, als bisweilen in der öffentlichen Diskussion suggeriert wird.
Im globalen Rahmen kann von einer demografischen Dreiteilung ausgegangen werden. In der ersten Gruppe der Industriestaaten Europas, Nordamerikas und Asiens geht eine umfassende Alterung mit einer zunehmenden Schrumpfung der Bevölkerung einher. Die Bevölkerung Deutschlands wird sich bis 2050 von jetzt 82 Mio. auf 68 bis 74 Mio. verringern, das Durchschnittsalter um sechs Jahre auf 88 (Frauen) bzw. um sieben Jahre auf 84 (Männer) ansteigen. In der zweiten Welt der wirtschaftlich dynamischen Entwicklungs- und Schwellenstaaten in Lateinamerika (z. B. Argentinien, Brasilien), Südasien (z. B. China, Thailand, Vietnam) und im Nahen Osten (z. B. Israel, Libanon) findet sich eine junge Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, die sich allerdings im Übergang zu den demografischen Mustern der westlichen Industriestaaten befinden. In der dritten Gruppe findet sich die große Zahl von wenig entwickelten Staaten mit starker Zunahme der Kinder- und Jugendbevölkerungen, Armut, Perspektivlosigkeit und schlechter Regierungsführung (z. B. Uganda, Kongo, Afghanistan, Jemen, Palästina). Vor allem für diese Staaten wird aufgrund des überproportional großen Bevölkerungsanteils von 15–24-Jährigen (»youth bulges«) von einem erhöhten Konfliktpotenzial ausgegangen, da Integration und Beschäftigung dieser Gruppe nicht gewährleistet wird. Demgegenüber wird in der Forschung vermutet, dass alternde Gesellschaften eher zu einer friedlichen Bewältigung von Krisen und Konflikten tendieren als demografisch jüngere Staaten.
Die Forschung zu den sicherheitspolitischen Implikationen des ~ steckt aber noch in den Anfängen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Bevölkerungszuwächse im Zusammenwirken mit anderen Faktoren in bestimmten Regionen krisen- und konfliktverschärfend wirken können, zu grenzüberschreitenden Wanderungsbewegungen und regionalen (Ressourcen-)Konflikten führen und damit auch überregionale Auswirkungen haben. Bevölkerungsrückgänge müssen sich wiederum per se sicherheitspolitisch nicht auswirken (die Sicherheit eines Staates hängt nicht von seiner Bevölkerungszahl ab), aber Staaten der »ersten Welt«, die altern und schrumpfen, können gleichwohl mit verschiedenen Herausforderungen ihrer Sicherheit konfrontiert werden. Dazu gehören Migrationsströme und die Auswirkungen regionaler Krisen. Auch kann der ~ in den alternden und schrumpfenden Staaten deren außenpolitische Handlungsfähigkeit und internationalen Einfluss mindern, wenn sich der – erkennbare – Trend fortsetzen sollte, die öffentlichen Haushalte zugunsten der alternden Bevölkerung (Renten, Pensionen) und zulasten der Streitkräfte umzuschichten. Dies kann verschärft werden durch Personalrekrutierungsprobleme der Streitkräfte in einer kompetitiveren Arbeitsmarktkonkurrenz mit der zivilen Wirtschaft um jüngeres qualifiziertes Personal. Im Ergebnis kann dies zu kleineren, weniger leistungsfähigen Streitkräften und zu einer Reduzierung außenpolitischer Gestaltungsmöglichkeiten sowie zu Machtverschiebungen zwischen der demografisch ersten, zweiten und dritten Welt führen.
Demokratie
Bezeichnung für verschiedene Ordnungsformen, in denen sich Herrschaft auf dem Willen des Volkes gründet. Ein demokratisch legitimiertes Staatswesen basiert in der Regel auf einer rechtsstaatlichen Verfassung, die der Gewaltenteilung unterliegt und die Einhaltung der Menschenrechte garantiert.
Demoskopie
Die wissenschaftliche Erforschung der öffentlichen Meinung zu bestimmten Fragen durch repräsentative Befragungen von Bevölkerungsgruppen (in der Regel 1.000 bis 3.000 Personen), die statistisch ausgewertet oft einen hohen Grad an Zuverlässigkeit haben.
Denkfabrik Think Tanks
Deportation
Erzwungene Verschleppung von Personen aus ihrer Heimat durch einen Besatzer. Nach der Genfer Konvention von 1949 zum Schutz von Zivilbevölkerung in einem Kriegsgebiet ist ~ völkerrechtlich verboten.
Depot
Ortsfestes Lager, in dem Material der Streitkräfte aufbewahrt wird.
Desert Storm
Name für die 1991 von den Vereinigten Staaten von Amerika im Auftrag der Vereinten Nationen (VN), auf der Grundlage der Resolution 678 (1990) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen (VN-SR), erfolgreich geführte Operation einer internationalen Koalition gegen den Irak im Golfkonflikt.
Desertifikation
Ausbreitung von Wüsten oder wüstenähnlichen Verhältnissen in Gebieten, in denen – zumindest in mehr als der Hälfte des Jahres – die Verdunstung größer ist als der Niederschlag. Für die Entwicklungsländer stellt die ~ nicht nur eine Gefahr in der Versorgungssituation dar, sondern sie kann auch insbesondere wegen wachsender Armut die politischen Strukturen dieser Regionen destabilisieren. Mehr als 900 Millionen Menschen leiden heute unmittelbar unter den Auswirkungen von ~. Flüchtlinge; Hunger; Grundsatzartikel »Krieg und bewaffneter Konflikt«; Grundsatzartikel »Klimawandel und Sicherheit«; Migration; Wasser
Desinformation
~ sind gemäß einer EU-Definition nachweislich falsche oder irreführende Informationen, die mit dem Ziel des wirtschaftlichen Gewinns oder der vorsätzlichen Täuschung der Öffentlichkeit konzipiert, vorgelegt und verbreitet werden und öffentlichen Schaden anrichten können. Sie stellt damit eine Bedrohung für die demokratischen Prozesse, öffentliche Güter wie die Gesundheit der Bevölkerung, die Umwelt und die Sicherheit dar.
Gesteuerte ~kampagnen können Teil hybrider Bedrohung sein, wenngleich ihre Wirkung auf die Einstellungen und Entscheidungen der Zielgruppe schwer messbar ist. ~ wurden als sog. »aktive Maßnahmen« bereits in Zeiten des Kalten Krieges eingesetzt. Heute wird ~ vielfach unter Nutzung sozialer Medien und Trollfabriken, verschleiertem Ursprung gefälschter Nutzerkonten, automatisierter Verstärkung über Bot-Netzwerke und mithilfe maschinellen Lernens und künstlicher Intelligenz verbreitet.
Deutsch-Dänisch-Polnisches Korps
Multinationale Großverbände
Deutsche Atlantische Gesellschaft
Die ~ ist ein überparteilicher, unabhängiger, eingetragener Verein. Sie arbeitet auf internationaler Ebene unter dem Dach der Atlantic Treaty Association (ATA) mit den anderen nationalen atlantischen Gesellschaften der NATO-Mitgliedstaaten und der Partnernationen zusammen. 1956 gegründete Gesellschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Verständnis für die Politik und die Ziele der Nordatlantischen Allianz in der Öffentlichkeit zu vertiefen.
Durch Vorträge, Fachtagungen, Seminare und Informationsfahrten informiert die ~ ihre Mitglieder über die Entwicklung der NATO. Besondere Fachtagungen mit sicherheitspolitischem Schwerpunkt werden u. a. für Lehrer und Schüler durchgeführt. Die regionalen Arbeitskreise bieten Vorträge und Seminare für Mitglieder und Öffentlichkeit an. Die ~ fördert die Bestrebungen der Atlantischen Allianz um Frieden, Sicherheit, Stabilität und internationale Zusammenarbeit und setzt sich für den intensiven politischen Dialog und die militärische Zusammenarbeit der NATO mit den mittel- und osteuropäischen Staaten im Rahmen des Euro-Atlantischen Partnerschaftsrates ein.
Deutsche Atlantische Gesellschaft
Dorotheenstraße 84, 10117 Berlin
Tel.: (030) 20649 134, Fax: (030) 20649 136
Internet: www.ata-dag.de
Deutsche Einheit
Ergebnis der Vereinigung des deutschen Volkes nach der Trennung im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg. Die ~, stets verfassungsmäßiges Ziel der Bundesrepublik Deutschland, galt mit Abschluss des Zwei-plus-Vier-Vertrages am 12. September 1990 als vollendet. In Teilen noch nicht gelöst ist die Vollendung der ~ im Hinblick auf das gesellschaftliche Zusammenwachsen der über 40 Jahre getrennten Teile des deutschen Volkes.
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)
Private, gemeinnützige Vereinigung; unabhängig und überparteilich. Nach ihrer Satzung hat die ~ die Aufgabe, Probleme der internationalen, besonders der europäischen Politik, Sicherheit und Wirtschaft zu erörtern und ihre wissenschaftliche Untersuchung zu fördern, die Dokumentation über diese Forschungsfragen zu sammeln und das Verständnis für internationale Fragen durch Vorträge, Studiengruppen und Veröffentlichungen zu vertiefen. Hierdurch sollen die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit und der Gedanke der Völkerverständigung gefördert werden.
Zu diesem Zweck unterhält die ~ verschiedene Einrichtungen. Die wissenschaftliche Arbeit erfolgt vor allem im Forschungsinstitut der ~. Mit jeweils wissenschaftlicher Betreuung werden Studien- und Arbeitsgruppen zu folgenden Themen durchgeführt: Strategische Fragen; Europapolitik; Globalisierung und Weltwirtschaftliche Zusammenarbeit; Globale Zukunftsfragen; Frankreich/deutsch-französische Beziehungen; Polen/deutsch-polnische Beziehungen; Tschechien/deutsch-tschechische Beziehungen; Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen und sensitiven Technologien; Balkan; Internationale Raumfahrtpolitik.
Der Sammlung und Auswertung der einschlägigen Fachliteratur dient die Bibliothek und Dokumentationsstelle der ~, die dem Fachinformationsverbund »Internationale Beziehungen und Länderkunde angeschlossen« ist. Publikationsorgan der ~ und ihrer Einrichtungen ist die im Jahre 1945 durch Wilhelm Cornides unter dem Namen Europa-Archiv gegründete, monatlich erscheinende Zeitschrift »Internationale Politik«.
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
Rauchstraße 17/18, 10787 Berlin
Tel.: (030) 254231-0, Fax: (030) 254231-16
E-Mail: info@dgap.org
Internet: www.dgap.org
Deutsche Marine Marine; Teilstreitkraft (TSK) der Bundeswehr
Deutsche Stiftung Friedensforschung
Die ~ wurde im Oktober 2000 als Stiftung bürgerlichen Rechts durch die Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in Osnabrück gegründet. Ihr Ziel ist es, Friedens- und Konfliktforschung in ihren verschiedenen Facetten, insbesondere in ihren interdisziplinären Ansätzen, zu unterstützen. Mit der Struktur- und Nachwuchsförderung unterstützt die Stiftung zudem Projekte, die zu einer dauerhaften strukturellen Stärkung der Friedens- und Konfliktforschung beitragen.
Die ~ soll ferner dazu beitragen, die Friedensforschung national und international zu vernetzen. Sie unterstützt die Vermittlung der Ergebnisse aus den geförderten Projekten in die Öffentlichkeit und die politische Praxis.
Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF)
German Foundation for Peace Research
Am Ledenhof 3–5, 49074 Osnabrück
Tel.: (0541) 6003542
Fax: (0541) 60079039
E-Mail:
info@bundesstiftung-friedensforschung.de
Internet:
www.bundesstiftung-friedensforschung.de
Deutscher Bundestag (BT)
Das Parlament der Bundesrepublik Deutschland, das in allgemeinen und freien, gleichen und geheimen und unmittelbaren Wahlen nach einem System einer personalisierten Verhältniswahl hervorgeht. Der ~ hat nach folgenden Artikeln des Grundgesetzes (GG) weit reichende Kompetenzen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik:
•Gesetzgebung und Bestellung der Bundesregierung
•Bundeshaushalt
•Feststellung des Spannungsfalls (Art. 80a)
•Feststellung des Verteidigungsfalls (Art. 115a)
•Teilhabe im gemeinsamen Ausschuss mit zwei Dritteln der Sitze
•Parlamentarische Kontrolle der Streitkräfte.
•Die Wahlperiode des ~ beträgt vier Jahre. Verteidigungsausschuss; Wehrbeauftragter
Deutscher Bundeswehrverband e. V. (DBwV)
Der 1956 gegründete ~ vertritt die allgemeinen ideellen, sozialen und beruflichen Interessen der Soldaten der Bundeswehr (Bw). Er verfügt über rund 200.000 Mitglieder, aktive und ehemalige Soldaten aller Dienstgrade. Als Spitzenorganisation der Soldaten wird der ~ von Bundestag und Bundesregierung an der Vorbereitung grundsätzlicher Regelungen beteiligt, die die Belange der Soldaten und ihrer Angehörigen berühren. Die Stellungnahmen des ~ in der Sicherheitspolitik, in der Gesellschafts- und Sozialpolitik nehmen konkreten Einfluss auf Entscheidungen von Regierung und Parlament. Der ~ ist politisch und finanziell unabhängig, die Verbandsarbeit wird aus Mitgliedsbeiträgen finanziert.
Der ~ verfügt über einen dreistufigen Aufbau: Die örtliche Gliederung bilden Kameradschaften, auf Länderebene bestehen Landesverbände, die wiederum in Bezirke gegliedert sind, der Bundesvorstand an der Spitze leitet mit den Bundesgeschäftsstellen in Bonn und Berlin die Verbandsarbeit. Für seine Arbeit stehen ihm Ausschüsse, Arbeitsgruppen, Verbandsbeauftragte für verschiedene Fachgebiete und die Verbandsschiedskommission zur Verfügung.
Die vier Landesverbände (LV) bestehen aus 27 Bezirken. Auf unterster Ebene stehen Standortkameradschaften, Truppenkameradschaften, Kameradschaften ehemaliger Soldaten/Reservisten/Hinterbliebener sowie selbstständige Truppenkameradschaften zusammen.
In den Bundes- und Landesgeschäftsstellen betreuen über 200 hauptamtliche Mitarbeiter, die in rund 1.000 Kameradschaften organisierten Mitglieder.
Höchstes Beschlussorgan des ~ ist die Hauptversammlung, die alle vier Jahre tagt. Die wichtigsten Aufgaben der Hauptversammlung:
•Festlegung der Aufgaben und Ziele der Verbandspolitik für die nächsten Jahre durch die gewählten Delegierten,
•Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes,
•Wahl des Bundesvorstandes.
Deutscher BundeswehrVerband
Bundesgeschäftsstelle Berlin
Stresemannstraße 57
10963 Berlin
Tel.: (030) 259260-0
E-Mail: berlin@dbwv.de
Internet: www.dbwv.de