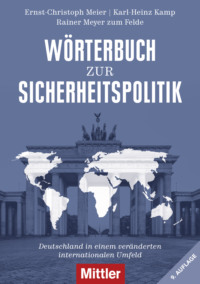Kitabı oku: «Wörterbuch zur Sicherheitspolitik», sayfa 6
ANZUS Pazifischer Sicherheitspakt
Apartheid
Durch die Republik Südafrika von 1910 bis 1991 geführte Politik der Rassentrennung zwischen schwarzer und weißer Bevölkerung. Mit der Wahl des schwarzen Politikers Nelson Mandela zum Staatspräsidenten endete die Politik der ~ im Juli 1991. Afrikanischer Nationalkongress
APEC Asiatisch-Pazifische Wirtschaftliche Zusammenarbeit
Appeasementpolitik
(dt.: Beschwichtigungspolitik)
Inhalt politischen Handelns, das gekennzeichnet ist durch die Bereitschaft zum Nachgeben gegenüber der Machtpolitik eines anderen Staates, einer Staatengemeinschaft oder eines Bündnisses. ~ wird auch als Schlagwort zur Beschreibung einer Politik ständigen Nachgebens, insbesondere gegenüber autoritären, totalitären und außenpolitisch expansionistischen Systemen, verstanden. Ursprünglich ist ~ eine kritische Bezeichnung für die Beschwichtigungspolitik der britischen und französischen Regierungen gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland, deren Höhepunkt der Abschluss des Münchener Abkommens (1938) war, das zum Zweiten Weltkrieg führte.
Arabische Einheit Panarabismus
Arabische Liga
Liga der Arabischen Staaten
Arabische Maghreb-Union (AMU)
Am 17. Februar 1989 in Marrakesch/Marokko gegründete regionale Staatengemeinschaft, der Algerien, Libyen, Marokko, Mauretanien und Tunesien angehören. Die ~ soll u. a. der Intensivierung der politischen und wirtschaftlichen Kooperation sowie der gemeinsamen außen- und sicherheitspolitischen Abstimmung dienen. Die nur nominell existierende ~ leidet unter dem angespannten marokkanisch-algerischen Verhältnis wegen des Westsaharakonflikts.
Arbeitssicherstellungsgesetz
Sicherstellungsgesetze
Area of Interest (AoI)
Über den eigenen Verantwortungsbereich hinausgehender Raum, in dem Informationen für die eigenen laufenden und künftigen Operationen von Bedeutung sind oder in dem Ereignisse den Ausgang der laufenden oder künftigen Operationen beeinflussen können.
Area of Operations (AoO)
Festgelegter geografischer Raum (Land/Luft/See), der einem Commander zur Durchführung seines Auftrages zugewiesen wurde.
Area of Responsibility (AoR)
NATO Area of Responsibility (AoR)
ARIANE
Raketenprogramm der Europäischen Weltraumbehörde (ESA). Erster Start einer ~ -1-Rakete im Dezember 1979. Erfolgreichste Trägerrakete der Welt ist ~ 4, die am 15. Februar 2003 ihren letzten Start absolvierte. ~ 5 führte am 10. Dezember 1999 ihre erste kommerzielle Mission durch und ist seither die leistungsfähigste europäische Trägerrakete zur Beförderung schwerer Nutzlasten in die Erdumlaufbahn. Raumfahrt
Arktis
Circa 20 Mio. Quadratkilometer großes Land- und Meeresgebiet rund um den geografischen Nordpol, das infolge des Klimawandels an strategischer und sicherheitspolitischer Bedeutung gewonnen hat. Die ~ umfasst die nördlichen Teile der drei Kontinente Nordamerika, Asien und Europa sowie das Nordpolarmeer. Anrainerstaaten sind die USA, die Russische Föderation, Norwegen, Dänemark und Kanada (die Arctic Five). Das wichtigste Forum regionaler Kooperation ist der 1996 im kanadischen Ottawa gegründete Arktische Rat, der aber lediglich beratende Funktion hat. Deutschland ist ständiger Beobachter. Seit einem halben Jahrhundert wird die Abnahme der Meereseisfläche beobachtet, sodass die Arktis nach Schätzungen bereits 2030 im Sommer eisfrei sein könnte. Schon früher dürfte die Nordostpassage und die Nordwestpassage temporär handelsschifffahrtstauglich werden. Der Klimawandel eröffnet neue Optionen für die Fischerei und den Abbau von Öl, Gas und Mineralien. Rund ein Viertel der globalen fossilen Brennstoffe könnte sich am Nordpol verbergen. Etwa 85 Prozent dieser Gas- und Ölressourcen befinden sich in Offshore-Gebieten, also außerhalb der Küstengewässer (US Geological Survey 2008). Ein internationaler Schutzvertrag nach dem Vorbild der Antarktis wird von den fünf Anrainerstaaten grundsätzlich abgelehnt. Alle acht Arktisstaaten – neben den Arctic Five Finnland, Schweden und Island – stimmen darin überein, Gebietsansprüche auf Grundlage des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen (SRÜ) regeln zu wollen. Zwar hatte Russland 2007 seine Landesflagge auf dem geografischen Nordpol platziert und mittels eines U-Boots seine strittigen Gebietsansprüche untermauert, 2010 wurde zwischen Russland und Norwegen aber eine Vereinbarung zur Festlegung der Seegrenze in der Barentssee getroffen und ein 40-jähriger Streit beigelegt, was die Erschließung umfänglicher Öl- und Gaslagerstätten ermöglicht. Während sich langfristig zwar das Risiko eines geopolitischen Konflikts in der Polarregion verstärken dürfte, erscheint ein »Wettlauf um die Arktis« gegenwärtig jedoch eher wenig wahrscheinlich. Ein Grund hierfür sind auch die enormen Schwierigkeiten bei der Nutzung der Rohstoffvorkommen (unwirtliches Klima, große Entfernung von den Absatzmärkten etc.).
Armee
1. Traditionelle Bezeichnung für die Streitkräfte eines Staates.
2. Organisatorisch ein aus mehreren Armeekorps und Armeetruppen bestehender militärischer Großverband (Größenordnung: über 100.000), der unter einem einheitlichen Kommando (Armeeoberkommando) steht und von einem Oberbefehlshaber geführt wird.
Armeekorps
1. Militärischer Großverband (Größenordnung: 50.000–100.000) aus mehreren Divisionen und Korpstruppen.
2. In der Bundeswehr werden ~ als Korps bezeichnet. ~ mit Beteiligung des Heeres sind grundsätzlich multinational organisiert und haben keine truppendienstlichen Führungsaufgaben im Frieden. Multinationale Großverbände
Arms Control Grundsatzartikel »Abrüstung und Rüstungskontrolle«
Arms Control and Disarmament Agency (ACDA)
(dt.: Rüstungskontroll- und Abrüstungsbehörde)
Dem State Department (Außenministerium) der Vereinigten Staaten von Amerika zugeordnete Rüstungskontrollbehörde. Die 1961 gegründete ~ ist seit 1. April 1999 in das State Department integriert.
Arms Trade Treaty (ATT)
(deutsch: Vertrag über den internationalen Waffenhandel)
Der ~ setzt erstmals völkerrechtlich verbindliche, einheitliche Mindeststandards zur Regulierung des internationalen Handels mit konventionellen Rüstungsgütern. Er erfasst neben den Großwaffensystemen auch Kleine und Leichte Waffen, weite Bereiche der Munition sowie Waffensystemteile und -komponenten. Der ~ ist am 24. Dezember 2014 nach der Ratifizierung von 50 Staaten in Kraft getreten. Er wurde zuvor auf einer globalen Konferenz unter der Schirmherrschaft der VN vom 2.–27. Juli 2012 in New York ergebnislos verhandelt. Am 7. November 2012 beschloss die VN-Generalversammlung, die Verhandlungen vom 18.–28. März 2013 wieder aufzunehmen. Am 2. April 2013 wurde das Abkommen schließlich mit 154 zu 3 Stimmen bei 23 Enthaltungen verabschiedet. Dem ~ gehören zur Zeit 110 Vertragsstaaten an. Ziel ist die Universalisierung des Vertrags.
Armut
Äußerste Besitzlosigkeit, die dann vorliegt, wenn Menschen ihr Existenzminimum nicht aus eigener Kraft bestreiten können. Man unterscheidet zwei Arten von ~:
•Absolute ~, die das physische Existenzminimum ausdrückt;
•Relative ~, die sich am Wohlstandsgefälle einer Gesellschaft orientiert.
Die Europäische Union legt die relative Armutsgrenze so fest, dass Menschen, die mit weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens in ihrem Lande auskommen müssen, als arm eingestuft werden.
Die Massen-~ in den Entwicklungsländern kann die politische Stabilität gefährden. Die Verringerung der Massen-~ wird daher heute als eine zentrale Aufgabe der Entwicklungshilfe angesehen.
Armutswanderung
Bevölkerungsbewegungen/Migration, die durch die Folgen extremer Armut ausgelöst werden. Bevorzugtes Ziel dieser ~ sind die wohlhabenden Industriestaaten der nördlichen Hemisphäre. Zurzeit gibt es rund 21 Millionen Flüchtlinge und Menschen in flüchtlingsähnlichen Situationen auf der Erde, die vom Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) erfasst sind. Wie hoch der Anteil derer ist, die davon zur Kategorie der Armutsflüchtlinge gehören, ist durch die Statistiken zurzeit nicht verifizierbar.
ARRC Allied Command Europe Rapid Reaction Corps, multinationale Großverbände
Artillerie
Der KSE-Vertrag definiert als ~ großkalibrige Artilleriesysteme, Kanonen und Haubitzen sowie Artilleriewaffen, welche die Eigenschaften von Kanonen und Haubitzen miteinander verbinden, und Mörser sowie Mehrfachraketenwerfersysteme mit einem Kaliber von 100 Millimetern und darüber. Außerdem fallen alle künftigen großkalibrigen Systeme zum Schießen im direkten Richten, wenn sie sekundär zum Schießen im indirekten Richten geeignet sind, unter die ~.
Artillerietruppe Heer
Ärzte ohne Grenzen
1971 von einer Gruppe junger Ärzte in Paris als Médecins Sans Frontières (MSF) gegründete private medizinische Nothilfeorganisation, die das Ziel verfolgt, der Zivilbevölkerung in Kriegsgebieten und den Opfern von Naturkatastrophen schnell und professionell ärztliche Hilfe zu bringen. Die Grundprinzipien sind in einer Charta festgelegt. Das internationale Netzwerk von ~ setzt sich aus Sektionen in 19 Ländern zusammen. Rund 2.000 internationale und etwa 25.000 lokale Mitarbeiter von ~ arbeiten jährlich in 70 Einsatzgebieten. Die Organisation erhielt 1999 den Friedensnobelpreis.
ASEAN
Vereinigung Südostasiatischer Nationen
ASEAN-Regionalforum (ARF)
(engl.: ASEAN Regional Forum)
Sicherheitspolitisches Dialogforum der Region Asien-Pazifik. Am 25. Juli 1994 beim 27. Treffen der Außenminister der ASEAN-Staaten in Bangkok gegründet. ~ umfasst neben den zehn ASEAN-Mitgliedstaaten (Indonesien, Malaysia, Thailand, Singapur, Philippinen, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos, Kambodscha) die 16 Dialogpartner der ASEAN (Australien, Bangladesch, Neuseeland, Kanada, USA, China, Russland, Japan, Indien, Südkorea, Mongolei, Nordkorea, Pakistan, Timor-Leste, Papua-Neuguinea und die EU) und den Generalsekretär der ASEAN. Das ~ bildet den sicherheits- und militärpolitischen Teil der ASEAN-Ministerkonferenz. Das ~ hat bislang zwar noch keine Vorkehrungen für eine Kollektive Verteidigung getroffen, doch es kann sich für die Schaffung von Stabilität und Sicherheit im Wirtschaftsgroßraum »Asien-Pazifik« zu einem wichtigen Instrument der Absicherung des asiatisch-pazifischen Wirtschaftsprozesses innerhalb der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftlichen Zusammenarbeit (APEC) entwickeln. Das ~ hat für den sicherheitspolitischen Dialog drei Schritte vorgesehen: 1. Förderung vertrauensbildender Maßnahmen, 2. Maßnahmen präventiver Diplomatie, 3. Entwicklung von Konfliktlösungsmechanismen. Bestehende vertrauensbildende Maßnahmen betreffen bilaterale Sicherheitsdialoge, hochrangige Militärkontakte, militärische Übungs- und Austauschprogramme sowie gegenseitige Information über militärische Weißbücher und Doktrinen. Die EU hat ihre Mitwirkung im ~ durch Beiträge in den Bereichen Informationsaustausch, Vertrauensbildung und präventive Diplomatie weiter verstärkt. Sie sieht das ~ als geeignetes Forum für die Behandlung wesentlicher regionaler Sicherheitsfragen, für das Herbeiführen eines Konsenses zwischen den asiatischen Ländern in diesen Fragen und für die Förderung des Informationsaustausches sowie für die Zusammenarbeit auf Sachverständigenebene in Terrorismusfragen.
Wichtigstes Organ der ~ sind jährliche Treffen der Außenminister (im direkten Zusammenhang mit den Treffen der ASEAN-Außenminister, jeweils im Juni/Juli jeden Jahres).
ASEM Asien-Europa-Treffen
Asiatisch-Pazifische Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(engl.: Asia Pacific Economic Cooperation – APEC)
Auf Anregung Australiens im Jahre 1989 von Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea, Kanada, den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und den damals noch sechs ASEAN-Staaten gegründetes Wirtschaftsforum mit dem Ziel der Liberalisierung des multilateralen Handelssystems und der Förderung des Wirtschaftswachstums in der Großregion. Die ~ umfasst insgesamt 21 Staaten der Asien-Pazifik-Region (Australien, Brunei, Chile, China, Hongkong, Indonesien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Russland, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, USA, Vietnam). Die in der APEC vertretenen Staaten repräsentieren rund 2,7 Milliarden Menschen und rund 49 Prozent des Welthandels. Bei einem der jährlich stattfindenden Treffen der Regierungschefs wurde im November 1994 in Bogor (Indonesien) die Schaffung einer Freihandelszone »Asien-Pazifik« für 2010 für entwickelte Länder und 2020 für Entwicklungsländer beschlossen.
Am 18. Oktober 2001 haben die Staatschefs der ~-Staaten bei ihrem Gipfel in Shanghai unter dem Eindruck des 11. September erstmals sicherheitspolitische Probleme besprochen und sich in einer gemeinsamen Erklärung zur Unterstützung des Kampfes gegen den Terrorismus verpflichtet. Seitdem stehen regelmäßig sicherheitspolitische Themen auf der Gipfelagenda. 2007 verständigen sich die ~-Mitglieder erstmals auf eine Erklärung zum Klimawandel und zur Energiesicherheit und auf einen dazugehörigen Maßnahmenkatalog. Der letzte Gipfel der ~ fand am 17./18. November 2018 in Papua-Neuguinea statt.
Asien-Europa-Treffen
(engl.: Asia Europe Meeting – ASEM)
Im März 1996 auf dem Europäisch-Asiatischen Gipfeltreffen in Bangkok gegründetes informelles Dialogforum von zurzeit 45 gleichberechtigten Partnern (alle 27 EU-Staaten und die Europäische Kommission, 16 asiatische Staaten (Brunei, Kambodscha, Indonesien, Indien, Laos, Malaysia, Mongolei, Myanmar, Pakistan, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam, China, Japan, Südkorea) und das ASEAN-Sekretariat. Themenbereiche der Kooperation sind: 1. der politische Dialog, 2. handels-, wirtschafts- und finanzpolitische Fragen, die seit der Asienkrise 1997 im Vordergrund stehen, sowie 3. bildungs- und sozialpolitische sowie kulturelle Themen. Im politischen Dialog werden auch sicherheitspolitische Fragen wie Nichtverbreitung und Abrüstung, Reform der Vereinten Nationen und Erfahrungen mit regionaler Integration diskutiert. Globale Herausforderungen wie Terrorismus, Umweltschutz und der Kampf gegen das organisierte Verbrechen bilden einen weiteren Schwerpunkt. Kern von ~ sind alle zwei Jahre abwechselnd in Europa und Asien stattfindende Treffen der Staats- bzw. Regierungschefs. Zur inhaltlichen Vertiefung der Schwerpunktbereiche finden Fachministertreffen (Außen-, Wirtschafts-, Finanz-, Innen-, Kultur- und Technologieminister) statt. Die Außenminister wirken als Gesamtkoordinatoren des Prozesses. Das zwölfte Gipfeltreffen fand am 18./19. Oktober 2018 in Brüssel statt. Einzige feste Institution ist die Asien-Europa-Stiftung in Singapur (ASEF) als Koordinator und Mittler des kulturellen und gesellschaftlichen Dialogs.
Asien-Pazifik
Der asiatisch-pazifische Raum hat in den vergangenen Jahren erheblich an sicherheitspolitischer Bedeutung gewonnen – sowohl für Deutschland als auch für Europa insgesamt. Hauptgrund für diesen Bedeutungszuwachs ist der rasante Aufstieg Chinas, der in diesem Ausmaß und in dieser Geschwindigkeit historisch einmalig sein dürfte. Seit 1978, als Deng Xiaoping mit Wirtschaftsreformen begann und China zur Welt hin öffnete, ist das chinesische Bruttoinlandsprodukt um das 40-fache gestiegen (von 300 Milliarden auf zwölf Billionen US-Dollar). Das Pro-Kopf-Einkommen wuchs um mehr als das Hundertfache (von 76 auf 8600 Dollar), und das Handelsvolumen verzweihundertfachte sich (von 20 Milliarden auf 4,1 Billionen Dollar). Dadurch wurde China das größte Exportland weltweit.
Mit dem Amtsantritt Xi Jinpings 2013 als Staats- und Parteichef veränderte sich das innen- und außenpolitische Verhalten Chinas deutlich. Xi konzentrierte die politische Macht im Land auf seine Person und stärkte das Primat der Partei in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Folgen sind eine weit stärkere Kontrolle und Bevormundung der Bevölkerung sowie eine massive Verschlechterung der Menschenrechtslage insbesondere gegenüber religiösen Minderheiten. Mit dem Inkrafttreten der nationalen Sicherheitsgesetze im Juli 2020 wurde die vereinbarte Autonomie Hongkongs ausgehöhlt, und der politische und militärische Druck auf das aus chinesischer Sicht »abtrünnige« Taiwan wuchs in den vergangenen Jahren kontinuierlich.
Außenpolitisch tritt China deutlich selbstbewusster auf und ist bereit, hohe internationale Reputationskosten für die Durchsetzung seiner Interessen in Kauf zu nehmen, Dabei verfolgt die chinesische Diplomatie die »Wolfskrieger-Strategie« (benannt nach einem patriotischen Propagandafilm), welche ein Beharren auf »Harmonie« mit unverhohlenen Drohungen von Botschaftern gegen die Regierungen oder die Öffentlichkeit ihrer Stationierungsländer mischt. Darüber hinaus schlägt sich Chinas Wirtschaftsmacht und sein sinozentrisches Selbstverständnis in einem immer stärkeren Aufbau militärischer Fähigkeiten nieder. Insbesondere die Marinerüstung hat geradezu atemberaubende Ausmaße angenommen und erlaubt China zunehmend, das Bild eigener Größe auch militärisch zu untermauern oder im Südchinesischen Meer unter Verletzung des internationalen Rechts militärische Stützpunkte aufzubauen.
Das immer aggressivere Auftreten Chinas verschärft die Spannungen in der asiatisch-pazifischen Region, deren Stabilität durch historisch bedingte Streitigkeiten, ungeklärte Gebietsansprüche oder den nuklearen Ambitionen Nordkoreas ohnehin brüchig ist. Dabei entwickelt sich diese lange als regional verstandene Instabilität zunehmend zu einem globalen Problem. Ein militärischer Konflikt in der Region könnte etwa neuralgische Schifffahrtswege wie die Straße von Malakka blockieren und damit weltwirtschaftliche Verwerfungen auslösen. Ein Angriff Chinas auf Taiwan hätte ein gewaltiges Eskalationspotenzial, da mit heftiger Gegenwehr Taiwans zu rechnen wäre und auch Länder wie die USA mit einbezogen werden könnten. Auch stoßen im erweiterten asiatisch-pazifischen Raum sechs Atommächte aufeinander (China, Indien, Pakistan, Russland, Nordkorea und die USA), die sich untereinander als Gegner verstehen – eine nukleare Krise oder gar ein Einsatz nuklearer Waffen sind somit nicht auszuschließen.
Die Reaktionen Europas und der USA auf die Entwicklungen im asiatisch-pazifischen Raum sind sehr unterschiedlich. Für Washington ist China eine aufsteigende Macht, die wirtschaftlich, politisch und auch militärisch immer stärker zu den USA aufschließt und den amerikanischen globalen Führungsanspruch zunehmend infrage stellt. Da China dem westlichen Wertekanon nicht entspricht, kann aus der wirtschaftlich-militärischen Konkurrenz ein Konflikt um die künftige Weltordnung erwachsen. Folglich verlagern die USA ihren geostrategischen Blickwinkel von Europa, wo ein absteigendes Russland eine noch akute, aber langfristig schwindende Bedrohung darstellt, immer pointierter in die Asien-Pazifik-Region. Erfolgte dies unter Präsident Trump noch in sprunghaft-vulgären Schritten ohne erkennbare Strategie, verfolgt Präsident Biden eine klar erkennbare Politik der Einhegung Chinas auf zweierlei Wegen: Zum einen sollen die wirtschaftlichen Fähigkeiten der USA (wieder) gestärkt werden, um damit auch genügend Ressourcen für ein politisches und militärisches Agieren in der Region zu schaffen. Zum anderen sollen engere Verbindungen vor allem zu demokratischen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum geknüpft werden, um dadurch ein Netzwerk zur Einhegung chinesischer Machtansprüche aufzubauen. Darüber hinaus wird China klar als Bedrohung und als zentrale Herausforderung für die kommenden Jahre benannt – was allerdings eine Kooperation mit China in Fragen von gemeinsamem Interesse (Klimaschutz) nicht grundsätzlich ausschließt.
Die EU und Deutschland haben China lange Zeit weniger kritisch gesehen und gingen davon aus, dass starke wirtschaftliche Verflechtungen langfristig auch zu politischen Verhaltensänderungen auf chinesischer Seite führen würden (Wandel durch Annäherung). Hier hat allerdings insbesondere nach den Entwicklungen in Hongkong ein schrittweises Umdenken eingesetzt. Dennoch bestehen zwischen China und vielen EU-Mitgliedern enge wirtschaftliche Beziehungen, die eine einheitliche Position der EU erschweren und eine kohärente europäisch-amerikanische Politik gegenüber Peking bislang verhindern, da China sowohl als Gegner als auch als Partner wahrgenommen wird. Entsprechend definierte die EU China Ende 2019 als »Partner, Wettbewerber und strategischen Rivalen«.
Dieser differenziertere Ansatz spiegelt sich auch in den im September 2020 verabschiedeten »Leitlinien zum Indopazifik« der Bundesregierung wider. Darin benennt Deutschland sechs Oberziele: Stärkung einer regelbasierten Ordnung in der Region, Kampf gegen den internationalen Terrorismus, Verhinderung nuklearer Proliferation, Cyber-Sicherheit, Schutz von Bundesbürgern und die Bewahrung freier Handelswege. Zwar verfolgen die Leitlinien grundsätzlich einen inklusiven Ansatz und wenden sich an alle Länder des indopazifischen Raums. Allerdings hat gerade die Bundesministerin der Verteidigung, Annegret Kramp-Karrenbauer, immer wieder verdeutlicht, dass sich der Ausbau der sicherheitspolitischen Kooperation in einem ersten Schritt auf die Wertepartner in der Region – und hier vor allem Australien, Neuseeland, Südkorea und Japan – konzentrieren solle und in einem zweiten Schritt die Mitgliedstaaten des ASEAN-Bündnisses einbeziehen müsse. Um das eigene Engagement in der Region zu betonen, hat Deutschland im Sommer 2021 eine Fregatte in die Region entsandt (Indo-Pacific Deployment 21), die auch durch das Südchinesische Meer gefahren ist, um so die Freiheit der Seewege zu betonen.
In der Perspektive zeichnet sich ab, dass der asiatisch-pazifische Raum Schauplatz einer bipolaren Weltordnung werden könnte, in der aber – anders als im Kalten Krieg – die beiden Kontrahenten USA und China wirtschaftlich eng miteinander verwoben sind. Die Europäische Union wird sich in dieser Bipolarität eindeutig positionieren und vor allem eine strategische Handlungsfähigkeit entwickeln müssen, um ihre eigenen Interessen zu vertreten und um die USA als engsten Partner zu entlasten. Die NATO wird hingegen ihr Augenmerk stärker auf den asiatisch-pazifischen Raum richten müssen, ohne ihre klassische Aufgabe der Friedenssicherung im euro-atlantischen Raum zu vernachlässigen.