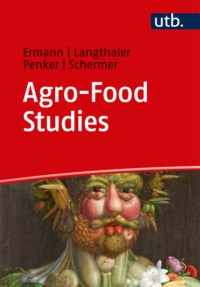Kitabı oku: «Agro-Food Studies», sayfa 4
Nachfrage einer wachsenden Bevölkerung
Der zunehmende Güter- und Leistungsaustausch im internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr und die voranschreitende internationale Arbeitsteilung führten gemeinsam mit der Technisierung zu enormen Produktivitätszuwächsen. So konnten mehr und kostengünstigere Lebensmittel für eine in fast allen Teilen der Welt wachsende Bevölkerung produziert werden. Die Bekämpfung von Hunger und Unterernährung ist daher ein wesentliches Argument der GlobalisierungsbefürworterInnen und zentrales Ziel der Vereinten Nationen. In den letzten Jahrzehnten, die durch starke Globalisierungsprozesse gekennzeichnet waren, konnte zwar der Anteil der unterernährten Menschen weltweit reduziert werden; in absoluten Zahlen hat sich aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung aber wenig an der Dramatik der Situation geändert (siehe Abb. 3.3).

Abb. 3.3: Anzahl und Anteil unterernährter Personen weltweit (basierend auf Daten der FAO 2015)
Fluktuierende Lebensmittelpreise, die in liberalisierten, deregulierten Lebensmittelmärkten von einzelnen Nationalstaaten kaum beeinflusst werden können, treffen Haushalte im → Globalen Süden weit stärker als im Globalen Norden, weil Erstere einen höheren Anteil des Haushaltseinkommens für Lebensmittel aufwenden (siehe Abb. 3.4).
Der Anteil der Haushaltsausgaben für Lebensmittel ist insbesondere in den Ländern des Globalen Nordens in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gefallen. In Mitteleuropa gab der durchschnittliche Haushalt in den 1970er Jahren noch etwa ein Viertel seines Einkommens für Lebensmittel aus, gegenwärtig ist es nur mehr etwa ein Zehntel. Im weltweiten Vergleich divergieren die Anteile der Lebensmittelausgaben am Haushaltsbudget stark; so liegen diese in den USA bei 7 % und in Ländern südlich der Sahara bei über 40 % (vgl. Abb. 3.4).

Abb. 3.4: Anteil des Haushaltseinkommens (in %), welcher 2014 für zu Hause konsumiertes Essen ausgegeben wurde (ERS 2017)
Während in vielen Teilen Europas immer weniger für Lebensmittel ausgegeben wird, die zu Hause konsumiert werden, steigt der Außer-Haus-Konsum. Dieses Phänomen wird u. a. mit Veränderungen in der Arbeitswelt und dem Wandel der Genderrollen erklärt. Der Anteil außer Haus konsumierter Lebensmittel ist tendenziell in nordeuropäischen Ländern höher als in jenen des Südens und beträgt zwischen 11 % und 28 % der nahrungsbezogenen Energie (Orfanos et al. 2007). Der steigende Anteil des Außer-Haus-Konsums verdrängt das Kochen daheim und trägt auch dazu bei, dass KonsumentInnen noch weniger nachvollziehen können, wer wo an der Produktion, Verarbeitung und Zubereitung ihrer Nahrung beteiligt war. Man denke an zentrale Großküchen, die gleich mehrere Krankenhäuser, Altersheime, Kindergärten, Gefängnisse, Flüchtlingsheime oder Schulen mit Essen beliefern.
In vielen Gastronomiebetrieben hat sich eine standardisierte ‚Weltküche‘ durchgesetzt. Global agierende Gastronomieunternehmen und fast-food-Ketten versuchen weltweit ähnliche Produkte unter vereinheitlichten Herstellungsbedingungen mit möglichst standardisierter Qualität und Präsentation zu vertreiben und tragen so zu einer Homogenisierung von Ernährungskulturen bei. Gleichzeitig profitieren westliche KonsumentInnen vom vielfältigen Angebot ganzjährig verfügbarer Waren, die sonst aufgrund klimatischer Bedingungen oder durch Ernteausfälle gar nicht oder nur saisonal erhältlich wären.
3.2.2 Standardisierung, Dokumentation und Kontrolle statt Vertrauen
Entlang globalisierter Wertschöpfungsketten gehen Lebensmittel durch die Hände zahlreicher den KonsumentInnen nicht persönlich bekannter ProduzentInnen, deren Standorte oft weit voneinander entfernt liegen. Langfristige, auf Vertrauen und auf Gegenseitigkeit im sozialen Austausch (Reziprozität) angelegte Beziehungen zwischen den Unternehmen sowie mit den KonsumentInnen treten in den Hintergrund. Aus der Perspektive des neoliberalen Paradigmas scheinen soziale Beziehungen jenseits reiner Marktbeziehungen mitunter sogar wettbewerbshinderlich (z. B. Preisabsprachen). Rationale, auf Eigennutz ausgerichtete und am Gewinn orientierte individuelle Unternehmensentscheidungen gelten als Voraussetzung für einen funktionierenden Markt (Granovetter 1985).
Unterschiedliche regional geprägte Wuchsformen, Größen, Geschmacksnoten, Qualitäten etc. erschweren die auf Effizienz und Flexibilität ausgerichteten Transaktionen entlang langer Warenketten mit zahlreichen einander und den KonsumentInnen nicht persönlich bekannten Marktteilnehmern. Entlang globalisierter Wertschöpfungsketten werden daher bevorzugt standardisierte Massenwaren (commodities) mit homogener Qualität gehandelt, die von regionalen Besonderheiten bereinigt ist. Nur so können Händler commodities auf Börsen handeln, ohne die Ware jemals persönlich zu sehen, anzugreifen oder zu prüfen.
In sozial weniger eingebetteten und langen Warenketten, die durch eine Vielzahl einmaliger Transaktionen charakterisiert sind, lässt sich Fehlverhalten kaum verorten und Konsumentenvertrauen schwer aufbauen. Damit der internationale Warenaustausch zwischen individuell und weitgehend isoliert agierenden MarktteilnehmerInnen dennoch funktionieren kann, sollen abstrakte Systeme der Lebensmittelsicherheit (→ Nahrungsmittelsicherheit) mit einheitlichen und klaren Standards, Aufzeichnungspflichten, Etikettierungsregeln und Rückverfolgbarkeitsmechanismen sowie staatliche Kontrolle die Qualität sichern und Fehlverhalten verhindern. Diese Regulative substituieren das Vertrauen, das viele KonsumentInnen – zu Recht oder Unrecht – ihnen persönlich bekannten LebensmittelproduzentInnen entgegenbringen. So können Sicherheit und Qualität auch für jene Lebensmittel vermittelt werden, die durch die Hände unzähliger einander und den KonsumentInnen nicht persönlich bekannter AkteurInnen in unterschiedlichen Ländern und Kontinenten gehen.
Über staatliche Lebensmittelvorschriften hinausgehende Qualitätsstandards werden in komplexen Zertifizierungssystemen garantiert, durch unabhängige Kontrollstellen überprüft und durchgehend bis zu den KonsumentInnen dokumentiert und kommuniziert (z. B. Biolandbau und Fair Trade). Branchenstandards, d. h. zwischen Agrar- und Lebensmittelunternehmen vereinbarte Regeln zur Hygiene- und Qualitätssicherung, ergänzen staatliche Reglementierungen.
Auch mit ausgefeilten Kontrollsystemen lassen sich Lebensmittelskandale nicht gänzlich verhindern (siehe Abschnitt 5.6). In betrügerischer Absicht neu etikettierte Produkte (Stichwort „Gammelfleisch“ oder Pferdefleischskandal) bzw. mit Pestiziden oder pathogenen Keimen verunreinigte Lebensmittel gelangen immer wieder in die Supermarktregale, in private Kühlschränke, in den menschlichen Körper und schließlich in die Schlagzeilen.
3.2.3 Globalisierungsfolgen und Kritik
Die Handelsbedingungen sind nicht für alle Länder gleich. Entwicklungsländer (→ Globaler Süden) können aufgrund von Handelsbeschränkungen oder von Industrieländern einseitig definierten Standards die Chancen der Globalisierung nur sehr beschränkt nutzen. Zudem steht ihre Agrarproduktion unter dem Konkurrenzdruck subventionsgestützter Billigimporte aus Industrieländern. Während die Rohstoffproduktion oft in Ländern mit niedrigen sozialen und ökologischen Standards angesiedelt ist, bleiben die lukrativeren Verarbeitungsschritte den Industrieländern vorbehalten (z. B. die Röstung und Mischung von Kaffeesorten unterschiedlicher Herkunft oder Verarbeitung von Kakao zu Schokoriegeln). Die Markenbildung bei Lebensmitteln wie Kaffee, Schokoriegeln oder Cerealien erfolgt vorwiegend ohne Bezug zum Ort der landwirtschaftlichen Produktion und der Mehrwert der Marke bleibt in der Regel in den reichen Ländern des Nordens. Das ‚freie Spiel der Kräfte‘ auf ‚liberalisierten‘ – d. h. durch WTO und multinationale Konzerne re-regulierten – Märkten führt zu neuen Formen der Ausbeutung benachteiligter Länder: Landraub, Patentierung genetischer Ressourcen, Vertragslandwirtschaft.
Als Folge der Globalisierung geriet aber auch das regionalwirtschaftliche, soziale und agrarökologische Gefüge vieler ländlicher Regionen Europas unter Druck. Europaweit ist seit den 1970er Jahren ein starker Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe zu verzeichnen. Wachstums- und Spezialisierungsprozesse kennzeichnen die Mehrheit der verbliebenen Betriebe. Flächen, die nur manuell oder unter großem Aufwand zu bewirtschaften, weniger produktiv und abgelegen sind, werden aufgegeben. Das hat weitreichende Folgen für das Landschaftsbild und die Agrarökosysteme, welche sich in einer Koevolution mit der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung entwickelt hatten (siehe Kapitel 4). Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft problematisieren den Verlust von Landschaftsvielfalt, → Biodiversität und kultureller Vielfalt sowie eine Homogenisierung von Ernährungskulturen.
Die ‚Liberalisierung‘ der Agrarmärkte hat Betrieben der Agrar- und Ernährungswirtschaft einerseits größere Entscheidungsspielräume und neue Märkte eröffnet, sie andererseits direkt mit den Risiken schwankender Weltmarktpreise konfrontiert. Auch wenn die Menge weltweit gehandelter Agrargüter anteilsmäßig gering ist, etablieren sich Weltmarktpreise, die auch auf die lokalen Agrar- und Lebensmittelmärkte rückwirken. Sinkt die Nachfrage nach Milchprodukten in Russland oder China, so fallen auch die Milchpreise in Europa. Durch die ‚Liberalisierung‘ der Agrargüterpreise müssen sich auch europäische Betriebe auf stark schwankende Preise einstellen. Zudem hat die ‚Liberalisierung‘ weitere Optionen für Spekulationen auf Rohstoff- und Agrarbörsen eröffnet (siehe Box 3.2).
Box 3.2: Tortilla-Krise (Keleman und Rañó 2011)
Am 31. Jänner 2007 wandten sich in Mexiko Zigtausende Demonstranten gegen die teilweise Vervierfachung des Tortillapreises. 50 Mio. Mexikaner konsumieren täglich über 600 Mio. Tortillas. Die aus Maismehl produzierte Tortilla ist nicht nur für die ärmere Bevölkerung Mexikos ein wesentlicher Kalorienlieferant, sondern auch wesentlicher Teil der mexikanischen Kultur. Das zeigt die Parole sin maiz no hay país („ohne Mais kein Mexiko“). Die Regierung reglementierte schließlich den Tortillapreis und setzte verschiedene Maßnahmen gegen Spekulation und Preisfluktuation.
Die Krise in Mexiko dürfte durch das Zusammenwirken mehrerer Faktoren hervorgerufen worden sein: steigender globaler Bedarf, auch getrieben durch die forcierte Produktion von Agrotreibstoffen aus Mais in den USA, Spekulationen auf internationalen Märkten, die Import-abhängigkeit Mexikos sowie Machtkonzentrationen in Teilen der Wertschöpfungskette. Preisschocks in internationalen Lebensmittelmärkten zeigen die Verletzlichkeit von Ländern, die stark von Lebensmittelimporten abhängig sind. Besonders verletzlich gegenüber Preisschwankungen bei Grundnahrungsmitteln sind die Ärmsten, die den größten Teil ihres Einkommens für Lebensmittel aufwenden müssen (vgl. Abb. 3.4).
Der globalisierungsbedingte Strukturwandel in weiten Teilen Europas machte sich in den letzten Jahrzehnten auch außerhalb der Landwirtschaft durch den Verlust von Arbeitsplätzen bemerkbar. So gingen z. B. in den kleinstrukturierten Betrieben der Lebensmittelverarbeitung allein zwischen 1970 und 1999 etwa die Hälfte der Arbeitsplätze verloren (Favry et al. 2004). Ebenso wurden Einzelhandelsstandorte aufgelassen, sodass viele ländliche Gemeinden über kein eigenes Lebensmittelgeschäft mehr verfügen.
Durch globalisierte Wirtschaftsbeziehungen können transnational agierende Unternehmen divergierende Sozial- und Umweltstandards sowie Steuervorteile in unterschiedlichen Ländern auszunutzen. Für kleinere, regional verankerte Betriebe steigt der Konkurrenzdruck, da sie mit hohen Arbeitskosten, Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern und Umweltauflagen konfrontiert sind. Jene, die diesem Druck nicht standhalten, geben auf. Andere versuchen, Ausnahmen von Sozial- oder Umweltauflagen durchzusetzen, indem sie den Druck an die Politik weitergeben und drohen, die Produktion zu schließen oder in ein anderes Land zu transferieren. Handelsabkommen, aber auch durch unterschiedliche Produktionsauflagen verzerrte Wettbewerbsbedingungen können so zur Nivellierung hart erkämpfter nationaler Umwelt- und Sozialstandards beitragen (race to the bottom).
Transportstromanalysen zeigten, dass die für die Lebensmitteldistribution zurückgelegten Kilometer (Transportleistung der gesamten Kette) in den letzten Jahrzehnten um mehr als das Doppelte stiegen, während sich die Menge der transportierten Güter nur geringfügig erhöhte (Favry et al. 2004). Das heißt, das Essen legte wesentlich längere Wege „vom Feld zum Teller“ zurück (für ein konkretes Beispiel siehe Box 3.3). Mehr zu Umweltwirkungen des Transports ist im Abschnitt 4.3.1 nachzulesen.
Box 3.3: Beispiel einer langen Wertschöpfungskette
Lastkraftwagen transportieren regelmäßig gekühlte Nordseekrabben 6000 km bis nach Marokko und zurück. Dadurch lässt sich das arbeitsintensive Schälen der Krabben nach Marokko auslagern. Die Transportkosten fallen im Vergleich zu den Ersparnissen aufgrund der geringen Arbeitskosten in Marokko kaum ins Gewicht. Nur durch die Ausnutzung des Lohngefälles zwischen Deutschland und Marokko können deutsche KonsumentInnen so preisgünstig ‚heimische‘ und ‚frische‘ Nordseekrabben erwerben.
3.3 Regionalisierung – die verstärkte Einbettung von Lebensmitteln in regionale Strukturen
In Reaktion auf die Globalisierung der Lebensmittelversorgung und aus dem Wunsch nach überschaubareren Strukturen, der sich oftmals gerade nach medial aufbereiteten Lebensmittelskandalen breitmacht, versuchen AktivistInnen, einzelne Betriebe und regionsübergreifende Initiativen die Lebensmittelversorgung ‚wieder‘ stärker in regionale Sozialstrukturen einzubetten (siehe Kapitel 9). Neben der Wiederbelebung von Wochenmärkten oder dem Ab-Hof-Verkauf und Bauernläden verbreiten sich auch alternative Formen regionaler Lebensmittelversorgung, wie etwa die ‚Biokiste‘ (eine regelmäßig zugestellte Auswahl an saisonalem, biologisch produziertem Obst und Gemüse), die solidarische Landwirtschaft (vgl. Box 3.4) oder Lebensmittelkooperativen (Box 3.5). Auch globale Initiativen wie die → slow-food-Bewegung oder Via Campensina tragen zur Bewusstseinsentwicklung bei und stärken kurze qualitätsorientierte Warenketten in den Regionen.
Im Vergleich zu globalen Produktionssystemen sind regionale Warenketten kürzer und zeichnen sich durch die geografische und/oder soziale Nähe vergleichsweise weniger Betriebe und Personen aus. Noch weniger AkteurInnen umfasst nur die → Prosumption (siehe Abschnitt 9.5.3). Beim Selbstanbau in Eigen- und Gemeinschaftsgärten bzw. in Selbsternteprojekten erfolgen Produktion und Konsum durch dieselbe Person.
LebensmittelaktivistInnen und vermehrt auch Marketingabteilungen des Lebensmitteleinzelhandels verknüpfen Regionalität argumentativ mit sozialer Nähe, mit Mitsprachemöglichkeiten bei der Definition von Qualitätsstandards (→ Ernährungssouveränität, Kapitel 9) oder mit der Förderung ‚authentischer‘, an die regionalen naturräumlichen und soziokulturellen Verhältnisse angepasster Lebensmittel und konstruieren damit Versprechen, die weit über kürzere Transportwege und entsprechende Klimaeffekte hinausgehen. Sie implizieren kausale Verknüpfungen zwischen der „Wo-Frage“ und der „Wie-Frage“, die so faktisch nicht bestehen (Ermann 2015).
Ohne Rechtsdefinition wird Regionalität bei Lebensmitteln sehr unterschiedlich interpretiert und lässt je nach Interessenlage viel Definitionsspielraum (Hinrichs 2003; Ermann 2005; Sonnino 2013). Dass Regionalität sehr subjektiv ist, zeigen auch VerbraucherInnenbefragungen. Während einige den Begriff „regional“ sehr eng auf die nähere Umgebung mit einer maximalen Entfernung oder den Landkreis/Kanton/Bezirk festlegen, bestimmen ihn andere mit den Grenzen des Bundeslands oder des Nationalstaats. Viele assoziieren mit Regionalität aber auch eine kurze Wertschöpfungskette, direkte Interaktion mit den ProduzentInnen, Wissen über die Herkunft, bessere Qualität oder höhere soziale und ökologische Produktionsstandards. Hier seien beispielhaft vier überlappende, teilweise aber auch widersprüchliche Definitionsinhalte veranschaulicht:
 Lebensmittel, bei denen die KonsumentInnen die Bedingungen von Produktion, Verarbeitung oder Vertrieb mitbestimmen können (selbstproduzierte Lebensmittel, Lebensmittelkooperativen, solidarische Landwirtschaft; siehe Box 3.4).
Lebensmittel, bei denen die KonsumentInnen die Bedingungen von Produktion, Verarbeitung oder Vertrieb mitbestimmen können (selbstproduzierte Lebensmittel, Lebensmittelkooperativen, solidarische Landwirtschaft; siehe Box 3.4).
 Lebensmittel persönlich gut bekannter ProduzentInnen, die den KonsumentInnen sozial (aber nicht unbedingt räumlich) nahestehen (die Marmelade der Großeltern oder der Schnaps des befreundeten Bauern am Urlaubsort).
Lebensmittel persönlich gut bekannter ProduzentInnen, die den KonsumentInnen sozial (aber nicht unbedingt räumlich) nahestehen (die Marmelade der Großeltern oder der Schnaps des befreundeten Bauern am Urlaubsort).
 Lebensmittel, die in räumlicher Nähe produziert, verarbeitet und konsumiert werden; die räumliche Nähe definiert sich über einen bestimmten Kilometerumkreis (z. B. max. 50 km), die Länge der Transportwege entlang der gesamten Warenkette oder die Zugehörigkeit zum selben soziokulturellen Identifikationsraum (z. B. aus demselben Bundesland).
Lebensmittel, die in räumlicher Nähe produziert, verarbeitet und konsumiert werden; die räumliche Nähe definiert sich über einen bestimmten Kilometerumkreis (z. B. max. 50 km), die Länge der Transportwege entlang der gesamten Warenkette oder die Zugehörigkeit zum selben soziokulturellen Identifikationsraum (z. B. aus demselben Bundesland).
 Lebensmittel mit Herkunftsnachweis, die u. U. auch für internationale Märkte und weit entfernte KonsumentInnen produziert werden (z. B. rechtlich geschützte Herkunftsbezeichnungen wie Schweizer Gruyère oder Steirisches Kürbiskernöl) (siehe Abschnitt 3.4.3).
Lebensmittel mit Herkunftsnachweis, die u. U. auch für internationale Märkte und weit entfernte KonsumentInnen produziert werden (z. B. rechtlich geschützte Herkunftsbezeichnungen wie Schweizer Gruyère oder Steirisches Kürbiskernöl) (siehe Abschnitt 3.4.3).
Box 3.4: Solidarische Landwirtschaft
Mitglieder, die üblicherweise in einem Verein organisiert sind, schließen mit Bäuerinnen und Bauern einen Vertrag ab, in dem sie sich verpflichten, die kalkulierten Kosten für die Jahresproduktion inklusive eines ausgehandelten Stundenlohns für die anfallenden landwirtschaftlichen Tätigkeiten anteilig zu bezahlen. Im Gegenzug erhalten sie einen entsprechenden Anteil der Ernte, der je nach Wetter und Bewirtschaftungsgeschick unterschiedlich groß ausfallen kann. Die Risiken von Missernten werden so zumindest teilweise von der Landwirtschaft zu den Mitgliedern verschoben. Die Vereinbarung regelt auch, was in welcher Menge und wie angebaut wird. Teilweise helfen Mitglieder bei landwirtschaftlichen Arbeiten oder übernehmen Aufgaben der Administration oder Warenverteilung. Diese erfolgt an vereinbarten Abholplätzen und zu festgelegten Zeiten. Man vertraut darauf, dass die Mitglieder nicht mehr nehmen, als ihnen zusteht, und die Betriebe tatsächlich die entsprechenden Ernteanteile an die Mitglieder weitergeben und bei der Produktion die vereinbarten Tierschutz- oder Umweltauflagen erfüllen. Auf eine Bio-Zertifizierung und externe Kontrollen wird oftmals verzichtet.
Im Gegensatz zu Lebensmitteln, von denen man nicht weiß, woher sie kommen (food from nowhere; Campbell 2009), verfügen all die oben angeführten Lebensmittelkategorien über eine den KonsumentInnen bekannte Herkunft (food from somewhere; Campbell 2009).
3.3.1 Triebfedern der Regionalisierung
Regionalisierung als Gegenbewegung oder als Teil der Globalisierung
Infolge von Globalisierungsprozessen, der steigenden Außer-Haus-Verpflegung und des erhöhten Verarbeitungsgrads gekaufter Lebensmittel haben Menschen teilweise die Kontrolle darüber verloren, was sie sich mehrmals täglich – im wahrsten Sinne des Wortes – einverleiben. Die Qualität hoch verarbeiteter und verpackter Produkte ist nur schwer über den Geruchs- und Geschmackssinn bzw. über Form oder Farbe zu beurteilen. KonsumentInnen verlassen sich auf ExpertInneninformationen, die Angaben auf Etiketten und Speisekarten sowie auf das staatliche System der Lebensmittelkontrolle. Diese Regulative produzieren oder substituieren aber nur bedingt das Vertrauen, das durch medial aufbereitete Lebensmittelskandale immer wieder erschüttert wird. Eine sehr kleine, aber wachsende Gruppe von Menschen hinterfragt die Folgen globalisierter Lebensmittelsysteme und beklagt Vertrauens- und Kontrollverlust, den Strukturwandel in der Landwirtschaft und im Gewerbe, die Ausbeutung von Mensch und Natur oder die Dominanz des Preisarguments über jenem der Qualität. Stattdessen legen sie Wert auf langfristige und möglichst persönliche Beziehungen zu ProduzentInnen in der eigenen Region. Insbesondere in den Monaten nach größeren internationalen Lebensmittelskandalen bietet Regionalität Orientierung und subjektive Sicherheit im globalisierten und für den einzelnen Menschen nicht zu überschauenden Lebensmittelmarkt (Großsteinbeck 2012).
Box 3.5: Lebensmittelkooperative (siehe Kapitel 9)
In diesem stark durch KonsumentInnen gesteuerten Versorgungssystem organisiert eine Gruppe von Mitgliedern den gemeinsamen Einkauf und die Verteilung meist regionaler Bioprodukte. Bauernhöfe des Vertrauens liefern die bestellten Lebensmittel, die dann aus den Lagerräumlichkeiten der Kooperative abgeholt werden. Aufgaben der Selbstverwaltung und Lebensmittelverteilung werden durch ehrenamtlich tätige Mitglieder arbeitsteilig bewerkstelligt. Die Abholung basiert oft auf Vertrauen (selbst abwiegen, verpacken und den entsprechenden Geldbetrag hinterlegen). Mitglieder akzeptieren auch nicht zertifizierte Bauernhöfe als Biobetriebe. Aufgrund der persönlichen Beziehung vertrauen sie darauf, dass diese nachhaltig produzieren, auch wenn sie nicht extern kontrolliert werden.
Regionale Lebensmittel werden oftmals als Gegengewicht zu durchgreifenden Standardisierungs- und Homogenisierungsprozessen in der internationalen Lebensmittelindustrie verstanden. Die Vielfalt regionaler Ess- und Speisekulturen, die etwa von der slow-food-Bewegung propagiert wird, schlägt sich auch in einer Vielfalt von Kulturlandschaften, Sorten und Nutztierrassen nieder (z. B. die Lüneburger Heide mit ihren typischen Heidschnucken). In einer globalisierten Welt bindet sich Identität oftmals genau an diese Heterogenität regionstypischer Nutztierrassen, Speisekulturen und Landschaftsräume. Kurze Lebensmittelketten können durch eine Verankerung in regionalen → Ökosystemen, Landschafts- und Kulturräumen zu Aufhängern regionaler Identitätsentwürfe werden sowie zur biokulturellen Vielfalt, zur Erhaltung regionsspezifischer Produktionsstrukturen, Fertigkeiten und Arbeitsplätze beitragen.
Nicht zuletzt werden regionale Lebensmittel aber auch von Agrarmarktorganisationen und dem Lebensmitteleinzelhandel beworben. Der Lebensmittelmarkt im deutschsprachigen Raum und in weiten Teilen des Globalen Nordens ist gut gesättigt, zudem drängen durch die Öffnung der Märkte neue, oftmals preisgünstigere Produkte auf die bisher von heimischen Produkten dominierten Lebensmittelmärkte. Um neue Produkte vermarkten zu können, müssen sich diese aus der preisgünstigen Masse hervorheben, indem sie den KundInnen einen zusätzlichen Nutzen wie Nachhaltigkeit, ‚Authentizität‘ oder ‚Regionalität‘ versprechen. Heimische Produkte mit hoher Reputation lassen sich auch auf internationalen Märkten als hochpreisige Qualitätsprodukte positionieren. Regionalisierung lässt sich somit nicht nur als Gegenbewegung zur, sondern auch als komplementärer Prozess der Globalisierung erklären (mehr dazu im Abschnitt 3.4).
Vielfältige Motive regionaler Ernährung
Obwohl „Regionalität“ in Konsumerhebungen oftmals unterschiedlich bzw. gar nicht definiert wird, zeigen verschiedene Studien dennoch, dass der Trend zu regionalen Lebensmitteln auf sehr ähnlichen und vielfältigen Motiven beruht (Tab. 3.1). Natürlich erfüllen sich diese vielfältigen Erwartungen nicht in jedem Einzelfall (siehe Abschnitt 3.3.3).
Tab. 3.1: Motive regionaler Ernährung (basierend auf Dorandt und Leonhäuser 2001; Zepeda und Leviten-Reid 2004; Roininen et al. 2006; Chambers et al. 2007; Brown et al. 2009)

Wenn sich Regionalität und Saisonalität paaren, verfügen Obst und Gemüse aus der Region über Qualitätsmerkmale hinsichtlich Frische und Geschmack, die sonst durch frühzeitige Ernte oder lange Transportwege bzw. Glashauskultur verloren gehen. Andererseits kommt ein im Frühling konsumierter Apfel aus regionaler Lagerware geschmacklich nicht an den kürzlich geernteten Apfel aus Übersee heran. Aber selbst das Bewusstsein, dass bestimmte regionale Lebensmittel nur saisonal verfügbar sind, wird kultiviert: Wer fast das ganze Jahr auf die ersten Erdbeeren, den frischen Spargel, die ersten Aprikosen wartet, erfreut sich ganz besonders am Genuss dieser saisonalen Lebensmittel.
Während Frische vor allem bei Obst, Gemüse, Fleisch und Backwaren eine Rolle spielt, werden andere Qualitätsmerkmale vor allem durch Fertigkeiten der Verarbeitung geprägt. Lebensmittel können einen entscheidenden Qualitätsvorteil aufweisen, wenn wiederholte Transaktionen sowie die Bekanntheit der Betriebe und ihrer Produktionsbedingungen einen Qualitätsdruck erzeugen, der zu stetiger Innovation und Weiterentwicklung führt. VerarbeiterInnen, die KundInnen nicht bekannt sind bzw. diese nicht langfristig beliefern, können sich diesem Qualitätsdruck u. U. leichter entziehen.
Angesichts der oftmals beklagten Intransparenz und der mangelnden nationalstaatlichen Steuerbarkeit langer, globaler Warenketten versprechen kurze regional verankerte Produktionssysteme subjektive Sicherheit. KonsumentInnen schenken ProduzentInnen, deren Tun sie zumindest teilweise (und möglicherweise auch nur potenziell) selbst beobachten können, die sie vielleicht sogar persönlich kennen, größeres Vertrauen. Zudem lassen sich ökologische und soziale Standards über demokratische bzw. gesellschaftspolitische Prozesse (z. B. Tierschutzstandards, Gentechnikfreiheit) und die direkte Interaktion mit bäuerlichen Betrieben (solidarische Landwirtschaft, Lebensmittelkooperativen, Ab-Hof-Verkauf usw.) zumindest teilweise mitgestalten.
Auch wenn Umweltschutz ein ganz wesentliches Motiv für den Kauf regionaler Lebensmittel darstellt, bedarf es diesbezüglich eines differenzierten Blicks. Kürzere Transportwege müssen sich nicht zwingend in niedrigeren Emissionen niederschlagen (man denke an die Glashaustomate oder die gegenüber der CO2-Effizienz des Überseeschiffs ungleich niedrigere des Pkws für die Direktvermarktung). Umgekehrt ist davon auszugehen, dass der Druck für eine ökologisch und sozial verantwortungsvolle Produktion ungleich größer ist, wenn KonsumentInnen das Produkt mit dem Ort seiner Produktion direkt in Verbindung bringen können. Wer kauft schon gern Produkte, von denen bekannt ist, dass sie aus einer Region mit kontaminierten Böden, verschmutzten Gewässern oder ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen stammen? Weitere Motive neben Umwelteffekten im engen Sinne sind auch die Erhaltung bedrohter Nutztierrassen bzw. Kulturpflanzensorten und das Vermeiden unerwünschter Landschaftsveränderungen.
Viele KonsumentInnen geben an, die regionale Landwirtschaft und das regionale Lebensmittelgewerbe unterstützen zu wollen, um zur oben erwähnten Landschafts- und Speisenvielfalt beizutragen. Manche erinnern sich aber auch an Lebensmittelskandale (siehe Abschnitt 5.6) oder kriegsbedingte Lebensmittelknappheiten. Sie hoffen, dass die Erhaltung der Produktionsflächen, -strukturen und -fertigkeiten die → Resilienz der Lebensmittelversorgung gegenüber Pandemien, Kriegen, Terroranschlägen oder internationalen Lebensmittelskandalen erhöht.
Regionale Lebensmittel werden oftmals direkt ab Hof, über Lebensmittelkooperativen, Selbsternteprojekte, Eigen- oder Gemeinschaftsgärten bezogen. Das verspricht andere Erlebnisse, andere Lerneffekte und eine andere Befriedigung als beim alltäglichen Einkauf im Supermarkt.
3.3.2 Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser
Alternative Formen der regionalen Lebensmittelversorgung, wie Lebensmittelkooperativen oder die solidarische Landwirtschaft, aber auch der traditionelle Ab-Hof-Verkauf, setzen stark auf Vertrauen. Vertrauensbasierte Transaktionen sind vor allem dort zu finden, wo Personen bereits wiederholte Male positive persönliche Austauscherfahrungen gemacht haben. RegionalisierungsverfechterInnen gehen davon aus, dass langfristige persönliche Beziehungen und ihnen inhärente gegenseitige Verpflichtungen und Abhängigkeiten opportunistisches Verhalten eindämmen.
Da der Qualitätsdruck durch die persönliche Bekanntheit der ProduzentInnen größer ist, wird gerade bei in kleinen Mengen produzierten regionalen Lebensmitteln ein Qualitätsvorsprung erwartet. Die Lebensmittelproduktion am Ort des Konsums ist durch „dichtere ökologische Rückkoppelungen“ charakterisiert und ermöglicht so raschere Anpassungsmaßnahmen bei unerwünschten ökologischen Effekten (Campbell 2009). Außerdem kennen KundInnen in der Regel eher die ökologischen und sozialen Standards, die im nationalen Umwelt-, Lebensmittel- und Arbeitsrecht definiert sind und von nationalen Behörden kontrolliert werden, als jene anderer Länder.
3.3.3 Kritik an der Regionalisierungsdiskussion
Die wenigsten Produkte aus der Region können all die vielfältigen Erwartungen einlösen, die in Tab. 3.1 aufgelistet sind. Nicht alle Betriebe, die Regionalprodukte vermarkten, arbeiten nach den Regeln des → Ökolandbaus oder erfüllen über das Tierschutzrecht hinausgehende Standards einer artgerechteren Tierhaltung. Manche bringen sogar qualitativ minderwertige oder nicht mehr frische Produkte in Umlauf. Auf Bauernmärkten finden sich teilweise auch zugekaufte, von weither importierte oder minderwertige Lebensmittel. Die „Wo-Frage“ gibt also keine verlässliche Antwort auf die „Wie-Frage“ nach den Produktions- und Handelsbedingungen (Ermann 2015).
Die Mitglieder von Lebensmittelkooperativen (Box 3.5) oder der solidarischen Landwirtschaft (Box 3.4) sind oftmals BesserverdienerInnen und (angehende) Akademiker-Innen. Personen mit Migrationshintergrund und sozial benachteiligte Gruppen haben oftmals keinen Zugang zu Qualitätsprodukten aus der Region. Somit bleibt regionale Ernährung das Privileg eines exklusiven Clubs der weißen Mittelklasse (DuPuis und Goodman 2005), die sich so von den anderen abgrenzt (siehe Kapitel 8).
Zudem wird mit dem Regionalisierungsprozess die Verantwortung von der Politik zu einzelnen KonsumentInnen und ihren Kauf- und Ernährungsentscheidungen verschoben, anstatt staatliche, gesamtgesellschaftliche Lösungen oder internationale ökologische und soziale Standards der Lebensmittelproduktion zu verankern (Hartwick 2000; van der Ploeg 2010; Sage 2012).