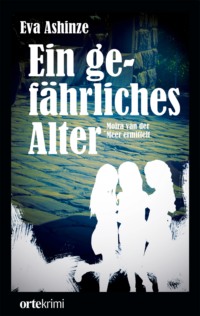Kitabı oku: «Ein gefährliches Alter», sayfa 3
12 Ich ass den letzten Biss meiner hastig zubereiteten Pasta. Ich koche gern, wenn ich Musse habe. Aber frische Kräuter, spezielle Gewürze – damit hatte ich mich heute nicht abgeben mögen. Heisshungrig und müde war ich nach dem Zusammentreffen mit Julia nach Hause gekommen. Ich hatte nur eines gewollt: Etwas zu essen. Deswegen hatte ich nach dem Glas gekauften Pestos gegriffen.
Ich schob den Teller von mir und griff nach meinen Zigaretten. Während ich mir eine anzündete, erhob ich mich, trat ans Fenster und öffnete es. Die kühle Luft liess mich erschauern. Ich nahm einen langen Zug. Unter mir leuchteten die Lichter der Stadt. Ich liess meinen Blick schweifen zu meiner Kanzlei, zu den Bahngleisen. Im Roten Turm brannte in einigen Büros noch immer Licht. Daneben war das Schulhaus St. Georgen. Ich zog an meiner Zigarette. Ich versuchte, die Friedensstrasse auszumachen, da, wo Nina wohnte. Nina. Ich wurde nicht schlau aus ihr. Sie verheimlichte mir etwas. Noch wusste ich nicht, was es war. Aber ich würde es herausfinden. Mein Blick wanderte weiter zur Seidenstrasse. Ich konnte das Dach der Villa ausmachen, in der ich aufgewachsen war. In der wir aufgewachsen waren, Maria und ich. Meine Mutter Celina lebte noch immer dort. Ich weiss nicht, wie sie die ganzen Erinnerungen, die dieses Haus beherbergt, ertragen kann. Mit einer Unmenge Alkohol vermutlich.
Ich zog ein letztes Mal an meiner Zigarette, stand auf und schloss das Fenster.
Während ich das schmutzige Geschirr in die Spülmaschine räumte und in der Küche einigermassen Ordnung schuf, ging ich in Gedanken die Unterhaltungen mit Nina und Julia noch einmal durch. Ich wischte die Herdplatte, wrang den feuchten Lappen aus. Nina und Julia malten widersprüchliche Bilder von Luca. Ich musste mehr über ihn erfahren. Ich musste herausfinden, was für ein Mensch er gewesen war. Je besser ich das Opfer kannte, desto besser durchschaute ich auch die Täterin – Nina.
Meine Gedanken schweiften zu Norah, zu meinem heutigen Besuch im Gefängnis. Hatte Maria tatsächlich harte Drogen konsumiert? Und wo war sie jetzt? War auch sie ein Opfer, tot und verwest? Oder lebte sie unter anderem Namen irgendwo in der Fremde? Energisch schüttelte ich das Geschirrtuch aus, hängte es an den Haken. Fragen über Fragen, die mich allesamt nicht weiterbrachten.
Ich nahm eine bereits geöffnete Flasche Wein zur Hand, entkorkte sie und goss mir ein Glas ein. Irgendwann würde ich wissen, was mit Maria geschehen war. Es hatte keine Eile, schliesslich schlug ich mich bereits mein halbes Leben lang mit ihrem Verschwinden herum. Aber die Sache mit Nina, die war dringend. Darauf musste ich mich konzentrieren, auf meinen neuen Fall. Auf den Fall des toten Jungen. Ich seufzte und trank Wein. Ich ahnte, dass es in dieser Geschichte nur Verlierer geben würde. Ich trank noch einen Schluck, stellte das Glas beiseite und fuhr mein Notebook hoch. Zum Glück hatte ich meine Arbeit. Ohne sie würde ich in dieser elenden Welt nicht klarkommen.
13 Ich musste nicht lange im Internet suchen, bis ich Informationen über Luca fand. Der Tod des Fünfzehnjährigen hatte Aufsehen erregt und war von den Medien entsprechend ausgeschlachtet worden. Da gab es Hintergrundberichte, Analysen, mögliche Tatszenarien. Und nicht zuletzt kamen die Nachbarn, die «besten» Freunde, Angehörige und viele weitere zu Wort, vermittelten ihre Sicht auf die Dinge. Ich überflog Aussagen wie «Jetzt sind schon Schulhäuser Gefahrenzonen», «Das waren keine von hier, ganz sicher nicht» und «Gottlose Jugend – wohin uns die Abkehr von der Religion führt».
Ich verspürte Abscheu und trank schnell noch etwas Wein. Heutzutage steuerte jeder seinen Senf zu allem und jedem bei. Vor allem die, die nichts zu sagen hatten, sagten etwas. Und ich überflog nur die Berichte in den Tagesmedien. Keine Ahnung, was bei facebook oder in privaten Chats noch über Lucas Tod geschrieben wurde. Wobei – vielleicht wären da die interessanten Dinge zu lesen.
Bevor ich den Gedanken zu Ende denken konnte, blieben meine Augen an einer Überschrift hängen: «Mitschüler können Tat nicht nachvollziehen: Luca war bei allen beliebt.» Das deckte sich mit Julias Aussage. Ich vertiefte mich in den Artikel.
Nach einer guten halbe Stunden Recherche musste ich Julia Recht geben: Es schien, als hätten alle Luca gemocht. Er war ein guter Schüler gewesen, ein begabter Handballer mit viel Teamgeist, beliebt bei den Mädchen, angesehen bei den Jungs. Er hatte nicht geraucht, keinen Alkohol konsumiert, nichts geklaut. Ein Vorzeigejunge.
Ich wollte mir Wein nachschenken, aber die Flasche war leer. Ein Blick auf die Uhr sagte mir, dass es kurz vor 23 Uhr war. Ich spürte, wie müde ich war. Zeit, zu Bett zu gehen.
Mein Telefon läutete, als ich mir im Bad die Zähne putzte. Mit der Zahnbürste in der Hand ging ich ins Wohnzimmer, schaute aufs Display. Celina, meine Mutter. Um diese Uhrzeit? Normalerweise konnte sie nach zehn Uhr abends keinen verständlichen Satz mehr von sich geben.
Meine Mutter ist Alkoholikerin. Seit ich denken kann, ist ein gut gefülltes Glas ihr ständiger Begleiter. Nicht, dass ich mit Alkohol ein Problem hätte, im Gegenteil. Ich bin ein paar Gläschen auch nicht abgeneigt, und es gibt Stimmen, die von James zum Beispiel, die sagen, auch ich würde zu viel trinken. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Celina und mir: Ich trinke, um mich vom Elend der Welt abzulenken. Alkohol stimmt mich milder, gelassener. Celina trinkt, um keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen zu müssen. Alkohol lässt sie entweder aggressiv oder überschwänglich werden. Die Launen meiner Mutter waren der Grund gewesen, weswegen mein Vater abgehauen war, als ich fünfzehn war und meine kleine Schwester Maria dreizehn. Er war zurück nach Nigeria gegangen und hatte uns bei Celina zurückgelassen. Es war die Hölle gewesen. Das hatte ich ihm bis heute nicht wirklich verziehen. Und mein Verhältnis zu meiner Mutter ist, milde ausgedrückt, angespannt.
Mittlerweile war das Telefon verstummt. Auch gut. Ich war nicht in der Stimmung, mich auf eine sinnlose Diskussion über meine vernachlässigten töchterlichen Pflichten einzulassen. Ich ging zurück ins Badezimmer und spuckte den Schaum aus. Das Telefon läutete erneut. Ich seufzte. Beharrlich war Celina, das musste man ihr lassen.
«Celina?»
«Hast du schon geschlafen?»
«Nein. Ich …»
Sie liess mich nicht ausreden. «Moira, du glaubst nicht, wer mich heute angerufen hat.» Ihre Aussprache war leicht verschliffen, aber ansonsten klang sie klar. Sie war definitiv noch nicht völlig betrunken. Aber sie war aufgeregt.
«Willy?»
«Was Willy. Weshalb Willy? Willy sehe ich jede Woche.»
Mein Vermieter und meine Mutter kannten sich aus Kindheitstagen; Willy war zwar gut zehn Jahre älter als Celina, aber sie hatten dennoch gute Erinnerungen aneinander. Beide waren an der Seidenstrasse gross geworden, und vor ein paar Jahren hatten sie sich durch mich wiedergetroffen. Ich stand dieser Freundschaft zwiespältig gegenüber. Willy sollte in erster Linie für mich da sein.
«Ich habe keine Ahnung, Celina», sagte ich. Ausser Willy hatten Celina und ich keine gemeinsamen Bekannten. Ich versuchte, meine Ungeduld im Zaum zu halten. Ich wollte meine Ruhe. Ich wollte schlafen.
«Chinedu hat angerufen. Stell dir das vor. Chinedu. Nach so vielen Jahren.»
Meine Müdigkeit war wie weggeblasen. Chinedu. Mein Vater. Ich hatte seit ein paar Jahren wieder Kontakt mit ihm, aber meine Mutter und er hatten seit über zwanzig Jahren kein Wort miteinander gesprochen.
«Was wollte er?», fragte ich vorsichtig.
«Es war … Ich habe das Telefon abgenommen und er hat Hallo gesagt. Ich habe ihn sofort erkannt. Seine Stimme hat sich kein bisschen verändert.»
Meine Mutter hatte meine Frage überhört.
«Ich war dermassen überrascht, im ersten Moment hätte ich beinahe wieder aufgelegt. Stell dir vor, nach so vielen Jahren, da ruft er einfach so an.»
Ich hörte Erstaunen in der Stimme meiner Mutter und eine Art unterschwellige Freude. Das wunderte mich. So, wie sie immer über meinen Vater hergezogen war, hatte ich etwas Anderes erwartet. Ich hatte erwartet, dass sie ihn eiskalt abservierte. Einen ihrer berüchtigten Wutanfälle bekam.
«Was wollte er?», wiederholte ich meine Frage.
«Ach, das war wirklich merkwürdig.» Celina machte eine Pause, und ich hörte, wie sie einen Schluck trank.
Ich lechzte ebenfalls nach einem weiteren Glas Wein.
«Wir haben nur kurz miteinander gesprochen. Er hat nicht viel gesagt. Aber er hat gemeint, ich solle ein Auge auf dich haben. Er hat gesagt, du wirst es in nächster Zeit schwer haben.»
Wieder hörte ich sie trinken.
«Stimmt das? Geht es dir nicht gut?»
Ihre Besorgnis irritierte mich noch mehr als die Weissagungen meines Vaters. Es mochte ja angehen, dass er sich als nigerianisches Orakel ausgab – manchmal lag er mit seinen Vorhersagen gar nicht mal so falsch. Aber dass Celina nun die bekümmerte Mutter gab, das ging mir gegen den Strich. Ich hatte mich die letzten Jahrzehnte ohne ihre Unterstützung durchgeschlagen. Das wollte ich ganz gern so beibehalten.
«Mir geht es gut, Celina», sagte ich. «Ich bin nur müde.»
Diesen Wink mit dem Zaunpfahl verstand meine Mutter nicht. «Sag mir, wenn ich was tun kann, ja?»
Das würde ich ganz bestimmt nicht. Meine Mutter war die Letzte, bei der ich Hilfe suchen würde.
Sie schien meine Gedanken zu lesen. «Menschen können sich ändern, Moira», sagte sie.
Ja, klar, und ich würde demnächst im Lotto Millionen gewinnen.
Obwohl ich mir bereits die Zähne geputzt hatte, setzte ich mich auf meine geliebte Fensterbank, öffnete das Fenster einen Spalt und zündete mir eine Zigarette an. Meine Mutter schwadronierte derweil über meinen Vater und erzählte, was er sonst noch gesagt hatte, und was sie gesagt hatte, und wie er wohl lebte, da unten, in Afrika, und wie lange doch alles her sei. Ich starrte in die Dunkelheit, rauchte, hörte mit einem Ohr meiner Mutter zu. Irgendwann legte ich einfach auf. Sie war mittlerweile so betrunken, dass sie es wahrscheinlich nicht einmal merkte.
14 In der Nacht wurde ich von Träumen heimgesucht. Ich träumte von Nina, nachts in einem dunklen Park, aber plötzlich war es nicht mehr Nina, die da ging, sondern meine Schwester Maria. Maria in ihrem pink-schwarz gestreiften Shirt, das sie getragen hatte, als sie verschwunden war. Sie ging durch den Park, und plötzlich war sie weg. Ich wollte ihr nachrennen, aber ich kam nicht vom Fleck. Ich mühte mich ab, ohne Erfolg. Je vergeblicher meine Versuche Maria nachzugehen waren, desto grösser wurde meine Panik. Da tauchte mein Vater auf. Er zeigte mit einem Finger auf mich. «Kommst du nicht mehr weiter?», fragte er und lachte schallend. Seine weissen Zähne waren unnatürlich gross und leuchteten in seinem dunklen Gesicht. «Gib es zu, du steckst fest.» Wieder lachte er. «Sie steckt fest!», rief er.
Ich wachte auf. Ich war benommen und verschwitzt. Trotzdem griff ich als Erstes nach dem Notizheft, das neben meinem Bett lag.
James hatte mir den Auftrag erteilt, meine Träume niederzuschreiben. «Halt fest, woran du dich erinnerst. Bilder, Sequenzen, einfach alles. Wir werden die Träume dann gemeinsam auf wiederkehrende Handlungsmuster oder Gefühle hin analysieren.»
«Das bringt doch nichts», hatte ich gesagt.
«Du solltest davon ausgehen, dass ich weiss, was ich tue, Moira. Sonst hättest du ja keinen Grund, weiterhin zu mir zu kommen», hatte er geantwortet.
So konnte man es auch sehen. Also machte ich seither, was er von mir verlangte. Mal sehen, wozu es gut war.
15 «Ich passe auf Mathilda auf, machen Sie sich keine Sorgen, Frau Martin. Und Gott wird auch ein Auge auf sie haben.» Mathilda ahmt Nina nach, imitiert deren Stimme.
«Das hat Nina echt zu deiner Mom gesagt?», fragt Alisar.
«Echt. ‹Gott wird auch ein Auge auf sie haben›, ich bin fast gestorben.» Mathilda ist aufgedreht, ihre Wangen sind gerötet und sie schwatzt viel mehr als sonst. «Aber meine Mutter hat ihr alles abgekauft. Sobald sie ‹Gott› hört, dreht sie total ab. Dabei – Nina und Gott, ich lach mich tot.»
«Hab ich da grad meinen Namen gehört?» Nina kommt ins Zimmer und posiert theatralisch unter dem Türrahmen. Sie hat die Haare mit Silberspray eingefärbt, die Augenbrauen mit dicken schwarzen Strichen nachgezogen, violette Lippen. Statt der üblichen Jeans trägt sei einen verschlissenen Rock über einem fadenscheinigen Petticoat und löchrige Strumpfhosen.
«O my God, du siehst so geil aus!», kreischt Alisar. «Lass mich mal deine Haare anfassen.»
Die drei Mädchen sind bei Nina und stylen sich für Halloween. Nachdem Nina sich für Mathilda stark gemacht hat, hat Frau Martin ihr im letzten Moment erlaubt, mit den Freundinnen mitzugehen.
«Um zehn muss ich zu Hause sein», murrt Mathilda. «Meine Mutter behandelt mich wie ein Baby.»
«Ach komm», Alisar stösst ihr den Ellbogen in die Seite. «Besser als nichts.»
«Genau. Besser als nichts», bekräftigt Nina. «Und jetzt mach mal vorwärts, los, zieh dich um! Alisar, gib ihr das Kleid.» Sie schaut Alisar misstrauisch an. «Du hast es doch mitgebracht?»
Alisar deutet stumm auf die Tüte zu ihren Füssen. Mathilda bückt sich danach, zieht das hellblaue Kleid hervor, lässt den glatten Stoff durch die Hände gleiten. «Ihr seht richtig halloweenmässig aus», sagt sie verzagt, «ein bisschen gruselig und trotzdem, naja, sexy.» Mathilda errötet und schaut von Nina zu Alisar, die ein enganliegendes schwarzes Kleid und einen schwarzen Schlapphut trägt; die Lippen hat sie blutrot angemalt, und sie hat ein paar falsche Vampirzähne dabei, die sie einsetzen kann. «Aber ich sehe in diesem Kleid einfach nur normal aus. Ich meine – hellblau. Das passt doch nicht.»
Nina und Alisar tauschen einen Blick.
«Wart ab», ergreift Alisar das Wort. «Wir haben da noch ein paar geile Accessoires.» Sie greift nach einer zweiten Tüte und reiht den Inhalt Stück für Stück vor Mathilda auf. Ein lila Tüllschleier. Ein lila Cape. Ein lila Spray für die Haare. Eine venezianische Augenmaske.
«Und dazu eine Tonne Schminke», sagt Nina. «Du wirst unsere Geisterbraut.» Sie schaut Mathilda erwartungsvoll an. «Na, wie gefällt dir das?»
Mathilda schaut sich an, was die Freundinnen da aufgetrieben haben. Alles nur für sie. Tränen treten ihr in die Augen, sie schluckt leer. «Ach ihr», sagt sie, «ihr spinnt ja.» Sie beugt sich vor und umarmt Alisar, streckt einen Arm nach Nina aus.
«Ich störe wohl gerade.» Beatrice Behrens steht im Türrahmen, betrachtet die drei. Sie ist dankbar, hat Nina gute Freundinnen. Und sie ist umso dankbarer, weil alle anständige Mädchen sind, liebe Mädchen. Arme Mathilda. Ihre Mutter hat nicht alle Tassen im Schrank. Dabei ist ohne Vater aufzuwachsen sowieso schon schwer genug.
«Erde an Mom. Hallo, Erde an Mom.» Nina schwenkt die Hand vor ihrem Gesicht.
Beatrice lächelt. «Entschuldigt. Ich war gerade woanders.» Sie betritt das Zimmer, geht zu Ninas Schreibtisch und stellt das Tablar ab. «Ich habe einen kleinen Imbiss für euch vorbereitet. Menschenblut», sie hebt den Krug mit Grenadinesirup, «und Schrumpfmumien.» Sie deutet auf die Würstchen im Blätterteig, denen sie mit Senf Augen aufgemalt hat.
«Mein Gott, Mama», sagt Nina. «Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr! Menschenblut und Schrumpfmumien. Wie peinlich ist das denn?»
Es ist Frau Behrens anzusehen, dass Ninas harsche Art sie verletzt. Trotzdem lächelt sie ein schiefes Lächeln: «Du hast recht, Nina. Ich habe nicht nachgedacht.»
«Es sieht lecker aus, Frau Behrens», sagt Alisar.
Ninas Mutter schaut sie dankbar an, bevor sie das Zimmer verlässt.
«Mann, Nina», herrscht Alisar Nina an. «War das wirklich nötig? Sie hat es gut gemeint.»
Nina grummelt etwas vor sich hin.
Mathilda hat das Zwischenspiel aufmerksam verfolgt. Sie steht auf, holt sich ein Würstchen. «Du hast wirklich Glück mit deiner Mutter», sagt sie zu Nina und beisst hinein.
16 «Du hast dich mit Luca verabredet. Ihr wolltet euch um Mitternacht auf dem Pausenhof treffen.»
Nina nickte.
Koller sah sie zweifelnd an. Er hatte blassblaue Augen in einem wettergegerbten Gesicht, die grauen Haare waren militärisch kurz. Er sah nicht aus wie ein Polizist. Eher wie ein Bergführer. Dazu passten die gerahmten Fotos an den Wänden: Alpenlandschaften. Ich mochte ihn ganz gern. Er war anständig und vor allem intelligent. Das konnte ich nicht von allen in diesem Gebäude behaupten.
«Weshalb?», fragte er.
«Ich wollte etwas zurück haben. Etwas, das mir gehörte.» Nina verschränkte die Arme vor der Brust. Schützend. Oder abweisend. Ich war mir nicht sicher. Wir sassen zu viert in Kollers Büro; Nina, Koller, eine Protokollführerin und ich. Frau Behrens wartete im Vorzimmer. Nina hatte sie nicht dabeihaben wollen, und ich war ganz froh darüber. Zu viele Emotionen konnten hinderlich sein.
Ich betrachtete Nina von der Seite. Sie hatte Ringe unter den Augen und war sehr blass. Sie hatte wohl nicht viel geschlafen. Kein Wunder. Trotzdem hielt sie sich bis jetzt ganz gut.
«Und das konnte Luca dir nicht tagsüber geben?», hakte Koller nach.
Nina zuckte die Schultern. «Können schon. Wollte er aber nicht.»
«Ihr habt euch also um Mitternacht beim St. Georgen getroffen. Ist das richtig?»
«Ja.»
«Wie habt ihr euch verabredet?»
«Was meinen Sie mit wie?» Nina sah Koller misstrauisch an. Sie zog an den Ärmeln ihres rosafarbenen Kapuzenpullis, versteckte die Hände darin.
«Naja, wie die Verabredung zustande gekommen ist. Habt ihr euch in der Schule unterhalten oder SMS geschrieben oder …» Er zählte keine weiteren Möglichkeiten auf. Vielleicht kamen ihm keine mehr in den Sinn.
«Ich habe ihm eine WhatsApp geschrieben. Er hat zurückgeschrieben.» Wieder zuckte sie mit den Schultern. «So halt.»
Koller nickte zustimmend. «Und was wolltest du von ihm zurückhaben?»
Nina presste die Lippen aufeinander und sah mich an.
Ich nickte ihr auffordernd zu. Sie musste Koller alles erzählen, auch wenn es nicht einfach war.
«Beantworte bitte meine Frage, Nina», sagte er ruhig.
Nina holte tief Luft. «Luca und ich hatten was zusammen. Ich meine, wir waren nicht zusammen oder so, es war nur … Es war … Wir hatten einfach Spass.»
«Ihr hattet keine Beziehung», hielt Koller nochmals fest.
«Das habe ich doch gerade gesagt.» Nina zog die Augenbrauen zusammen und sah ihn finster an. «Wir haben einfach so rumgemacht. Und …»
«Wann war das?», unterbrach Koller.
«Was?» Nina geriet aus dem Konzept.
«Wann das war. Im April oder früher schon? Und über welchen Zeitraum?»
«Mann, Sie unterbrechen mich dauernd! So kann ich mich nicht konzentrieren.» Nina schien den Tränen nahe.
Ich sah von ihr zu Koller. Ich war überzeugt, dass er das absichtlich machte. Ich fragte mich, worauf seine Taktik abzielte. Falls er Nina damit verunsichern wollte, hatte er es auf jeden Fall geschafft.
«Entschuldige, Nina», er lächelte sie versöhnlich an. «Ich versuche, mich zu bessern, ja?»
Sie nickte, war aber nicht überzeugt.
«Gut, dann erzähl weiter. Wann habt ihr euch getroffen, und was ist da passiert?»
«Ich weiss nicht mehr genau. Es war nur ein Mal. Also, getroffen haben wir uns schon mehr, in der Schule und so. Aber zusammen waren wir nur ein Mal. Ende März vielleicht. Oder anfangs April.»
«Vor oder nach Ostern?»
Ostern war dieses Jahr auf Ende März gefallen.
«Ich weiss nicht.» Nina sah Koller ausdruckslos an.
Er nickte, obwohl sie keine Frage gestellt hatte.
«Es war nicht geplant. Ich war in der Stadt und mir war langweilig, meine Freundinnen konnten alle nicht abmachen an diesem Tag. Im Starbucks habe ich Luca getroffen, und dann haben wir zusammen abgehängt, und er hat gefragt, ob ich nicht noch zu ihm kommen will. Und dann bin ich mit zu ihm, und dann ist es passiert.» Nina ratterte das alles im Eiltempo herunter; sie wollte es hinter sich bringen.
«Habt ihr miteinander geschlafen?»
Nina nickte stumm. Sie warf der Protokollführerin einen Blick zu. Es war ihr nicht angenehm, vor so vielen Unbekannten ihre intimste Geschichte auszubreiten. Kein Wunder, immerhin war sie erst fünfzehn.
«Danach sind wir dagelegen, und ich bin halb eingeschlafen, er steht auf, und plötzlich höre ich so ein Geräusch von seinem Telefon, und ich mache die Augen auf, und da steht der Arsch und macht einfach Fotos von mir. Dabei habe ich doch nichts an. So ein Arsch.» Nina klingt wütend. «Und diese Fotos wollte ich zurückhaben. Oder besser: Luca sollte sie löschen.»
Deswegen hatte Nina sich mit Luca mitten in der Nacht getroffen. Er hatte sie erpresst. Entweder du kommst, oder ich verschicke die Fotos an die Jungs aus der Schule.
«Schwein», sagte Nina. Ihr Gesicht war ausdruckslos. «Und als ich ihn dann getroffen habe, da hat er sich über mich lustig gemacht.»
«Du scheinst mir nicht der Typ zu sein, der sich so leicht erpressen lässt», warf Koller ein.
«Was wissen Sie schon über mich. Ausserdem – was hätte ich machen sollen?»
Koller kritzelte etwas auf ein Stück Papier.
«Soll ich weitermachen, oder was? Ich meine, irgendwie klingt es, als würden Sie mein Geständnis gar nicht wollen. Ich kann auch wieder gehen, wenn Ihnen das lieber ist», sagte Nina trotzig.
«Mach bitte weiter, Nina.» Koller liess sich nicht aus der Ruhe bringen.
«Ich habe zu Luca gesagt, ich bin hier, nun lösch die Fotos. Er hat gelacht. ‹Erst will ich was dafür›, hat er gesagt. ‹Was hast du zu bieten, Nina?› Ich bin wütend geworden, so furchtbar wütend, ich werde manchmal einfach so wütend, jähzornig sagt meine Mutter. Und da habe ich ihn gestossen. Er ist nach hinten gefallen und mit dem Kopf auf den Tischtennistisch aufgeschlagen, genau hier.» Sie berührt die Ecke des Schreibtischs. «Es hat ein ganz komisches Geräusch gemacht, wie ein Knacken. Und dann hat er am Boden gelegen, und da war plötzlich alles voller Blut, und ich habe Luca gerufen, aber er hat nicht geantwortet.» Sie machte eine Pause und starrte vor sich hin.
Im Raum war kein Laut zu hören.
«Ich habe ihn hier angefasst.» Nina deutet auf die Halsschlagader. «Ich habe keinen Puls gespürt. Da bin ich weggerannt.»
«Und sein Handy? Hast du das mitgenommen? Wir haben bei Luca keines gefunden.»
Nina zögerte einen Moment. «Ich habe es mitgenommen und danach weggeworfen.»
«Weshalb hast du es mitgenommen?»
«Na wegen der Fotos halt.» Ihr Gesichtsausdruck sprach Bände: Wie konnte man nur so dumm fragen.
«Wo?»
«Was?» Sie warf ihm einen verständnislosen Blick zu.
«Wo hast du das Handy weggeworfen?»
«Ich … Bei diesem Spielplatz im Inneren Lind, der mit der orangefarbenen Rutschbahn, da habe ich es in einen Mülleimer geworfen.»
Ich betrachtete Nina. Sie sah Koller mit weit geöffneten Augen an. Sie sah aus wie jemand, der die Wahrheit sagt. Aber mir hatte sie gestern etwas anderes erzählt. Mir hatte sie erzählt, sie habe das Handy in einen Mülleimer im Münzpark geworfen. Ein Detail nur. Trotzdem.
«Weshalb hast du keine Hilfe geholt?», wollte Koller wissen.
«Ich hatte Angst.»
Koller nickte. Er schien zu überlegen und klickte mit einem Kugelschreiber. Im Raum war nur dieses Klicken zu hören. Nina starrte Koller an. Koller war in die Betrachtung seines Kugelschreibers vertieft.
«Kannst du mir die WhatsApp zeigen?»
«Was?», fragte Nina verwirrt.
«Die WhatsApp, mit denen ihr euch verabredet habt. Kannst du sie mir auf deinem Handy zeigen?»
Nina errötete leicht und schüttelte den Kopf. «Die habe ich gelöscht.»
Wieder nickte Koller. Wieder betrachtete er seinen Kugelschreiber. Dann sah er auf: «Nina, würdest du bitte zu deiner Mutter gehen? Ich muss mich kurz allein mit Frau van der Meer unterhalten.» Er stand auf und öffnete die Tür für sie. «Es dauert nicht lange. Frau Moser wird dir eine Cola bringen.» Er machte mit dem Kinn eine Bewegung zur Protokollführerin. Die erhob sich ebenfalls.
Nina sah fragend zu mir.
«Ist in Ordnung, Nina», sagte ich.
Sie machte die gleiche Bewegung wie gestern: Sie nestelte an ihrem Pferdeschwanz, löste das Haargummi und arrangierte die Haare neu. Bevor sie die Tür hinter sich schloss, warf sie mir einen ängstlichen Blick zu.