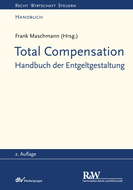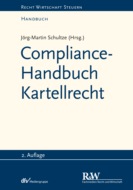Kitabı oku: «Kartellrechtliche Schadensersatzklagen», sayfa 20
1. Zusammenfassung
| Tatbestandsmerkmal | Beweislast | Beweismaß4 | Darlegungs- und Beweiserleichterungen5/Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Aktivlegitimation/Betroffenheit(siehe Rn. 62; Kapitel H, Rn. 26ff.) | Kläger | § 286 | Betroffenheit: Nach zwischenzeitlich von einigen Gerichten vertretener strengen Prüfung, ob sich das Kartelldelikt auf die jeweilige Transaktion kausal ausgewirkt habe, nunmehr Klarstellung durch den BGH.Es reicht jedes wettbewerbsbeschränkende Verhalten, das in irgendeiner Weise geeignet ist, einen Schaden des Anspruchstellers mittelbar oder unmittelbar zu begründen (BGH, 28.1.2020, KZR 24/17, juris Rn. 25 – Schienenkartell II) |
| Kartellrechtsverstoß(siehe Rn. 19–21) | Kläger | § 286 | Bindungswirkung kartellbehördlicher Entscheidungen, § 33b, Art. 16 VO 1/2003 |
| Passivlegitimation(siehe Kapitel H Rn. 136ff.) | Kläger | § 286 | In erster Linie rechtliche Fragestellung |
| Rechtswidrigkeit/Verschulden(siehe Rn. 31f.; Kapitel H Rn. 231ff.) | Kläger | § 286 | In der Praxis bislang eher unproblematischRechtswidrigkeit indiziert durch VerstoßVerschulden nach str. Ansicht bereits von Bindungswirkung umfasst. Im Übrigen str., ob Anscheinsbeweis/Vermutung für Verschulden streitet |
| Schadenseintritt („ob“)(siehe Rn. 26; 55f.; 76–81) | Kläger | § 287 | – Tatsächliche Vermutung– Beweislastumkehr: § 33a Abs. 2– Sekundäre Darlegungslast/Auskunftsansprüche |
| Haftungsausfüllende Kausalität inkl. Kartellbefangenheit und Pass-on bei Klagen der 2. Marktstufe(siehe Rn. 26–28; 41f.; 45f.; 76–81) | Kläger | § 287 | – Beweislastumkehr: § 33a Abs. 2– Kartellbefangenheit: tatsächliche Vermutung und § 33a Abs. 5 RefE-GWBPass-on:– Beweislastumkehr im Aktivprozess eines mittelbaren Abnehmers, § 33c Abs. 2– „Glaubhaftmachung“ der Nicht-Weiterreichung, § 33c Abs. 3– Sekundäre Darlegungslast/Auskunftsansprüche |
| Schaden (Höhe)(siehe Rn. 37–39; 43–55) | Kläger | § 287 | Schadenspauschalisierungsklauseln Entgangener Gewinn, § 252 BGB |
| Einwendung (insb. Passon)(siehe Rn. 76–81) | Beklagter | § 286 | Ggf. sekundäre Darlegungslast/Auskunftsansprüche |
| Einreden (insb. Verjährung)(siehe Kapitel K) | Beklagter | § 286 | |
| Streitwertanpassung, § 89a Abs. 1 GWB(siehe Rn. 41; 171ff.) | Kläger | § 294 | Eidesstattliche und anwaltliche Versicherungen sowie schriftliche Zeugenaussagen als Mittel der Glaubhaftmachung zulässig |
2. Grundregel
9
Der Kartellschadensersatzprozess unterliegt als Zivilprozess dem Beibringungsgrundsatz. Danach obliegt den Parteien die Verfügungsfreiheit über den zu berücksichtigenden Tatsachenstoff. Sie führen den Streitstoff in den Prozess ein (Darlegung), sie entscheiden über seine Feststellungsbedürftigkeit (Bestreiten), und sie betreiben grundsätzlich die Feststellung der streitigen Tatsachen (Beweisführung).
10
Darin liegt ein entscheidender Unterschied zur hoheitlichen (behördlichen) Durchsetzung des Kartellrechts. Für Letztere gilt der Untersuchungsgrundsatz, wonach die Stoffsammlung, -einführung und der Beweis dem Rechtsanwender (Gericht oder Behörde) obliegt, ohne diesen an Anträge oder das sonstige Verhalten der Parteien zu binden. Auch wenn in der Rechtspraxis eine Annäherung der Verfahrensprinzipien durch eine stärkere Einbindung des Zivilrichters einerseits (§§ 139ff. ZPO) und die Entwicklung von Mitwirkungsobliegenheiten („Anfang-Ende-Satz“) der Parteien in Verwaltungsverfahren andererseits zu beobachten ist,6 so bleibt der entscheidende Unterschied bestehen: die weitreichenden Ermittlungsbefugnisse der Kartellbehörden und die Verwertung der dadurch erlangten Kenntnisse im anschließenden gerichtlichen Beschwerdeverfahren.7
11
Diese Erkenntnismöglichkeiten stehen einer privaten Partei – mit Ausnahme der neuen Auskunftsrechte des § 33g GWB – nicht zur Verfügung. Dafür obliegt einer privaten Partei aber auch – anders als einer Kartellbehörde – nicht die alleinige Beweislast für alle rechtserheblichen Tatsachen. Diese ist vielmehr nach den folgenden Grundsätzen zwischen den Parteien verteilt.
a) Darlegungs- und Beweislast
12
Die objektive Beweislast bestimmt, welche Partei im Falle der Unklarheit über eine entscheidungserhebliche Tatsache unterliegt. In einer solchen Situation ist es dem Gericht trotz Ausschöpfung aller angebotenen bzw. verfügbaren Beweise nicht möglich, die notwendige positive oder negative Überzeugung von der streitigen Tatsache zu erlangen (non liquet).
13
Hierfür gilt die auf Rosenberg zurückgehende Normentheorie, wonach der Anspruchssteller die Beweislast für die (auch negativen) tatsächlichen Voraussetzungen der rechtsbegründenden und rechtserhaltenden Tatbestandsmerkmale trägt, während der Anspruchsgegner die Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der rechtshindernden, rechtshemmenden und rechtsvernichtenden Tatbestandsmerkmale zu beweisen hat.8 Bisweilen wird diese Formel verkürzt zu: Jede Partei trägt die Beweislast für die ihr günstigen Tatsachen.
14
Die Verteilung der objektiven Beweislast zwischen den Parteien für eine Tatsache bestimmt zugleich über die initiale Verteilung der Darlegungs- und Beweisführungslast. Die Darlegungslast bezeichnet die Last der Parteien, das Vorliegen der Tatsache (hinreichend substantiiert) zu behaupten. Die Beweisführungslast bezeichnet die den Parteien auferlegte Last, den Beweis einer streitigen Tatsache durch eigene Tätigkeit zu führen. Initial daher, da die Darlegungs- und Beweisführungslasten zwischen den Parteien wechseln können. Die Darlegungslast geht in dem Moment über, in dem die Tatsache hinreichend substantiiert vorgetragen wurde. Es ist dann an der Gegenpartei, das Vorliegen der Tatsache entsprechend substantiiert (oder ausnahmsweise mit Nichtwissen, § 138 Abs. 4 ZPO) zu bestreiten. Die Beweisführungslast geht auf die gegnerische Partei in dem Moment über, in welchem der beweisführungsbelasteten Partei der Hauptbeweis gelingt. Hauptbeweis, da die volle Überzeugung des Gerichts nach Maßgabe des jeweiligen Beweismaßes erforderlich ist. Die Gegenpartei trägt nunmehr die konkrete Beweisführungslast für den Gegenbeweis. Hierfür reicht es aus, die Überzeugung des Gerichts durch Führung eines Beweises zu erschüttern.
b) Beweismaß und Beweiswürdigung
15
Das Beweismaß bestimmt, welches Quantum an Wahrscheinlichkeit für die Überzeugungsbildung des Richters erforderlich ist, damit ein Hauptbeweis erfolgreich geführt ist. Je niedriger das Beweismaß, umso einfacher ist ein Beweis zu führen.
16
Im Zivilprozess darf und muss sich der Richter zur Erfüllung des Regelbeweismaßes des § 286 ZPO nach ständiger Rechtsprechung mit einem für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit begnügen, der Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen.9 Dem entspricht eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, falls sie dem Richter persönliche Gewissheit verschafft.10 Eine nur überwiegende Wahrscheinlichkeit reicht dagegen grundsätzlich nicht aus, wie das Regel-Ausnahme-Verhältnis von § 286 ZPO (für wahr zu erachten) zu § 287 ZPO (freie Überzeugung ohne Bezug auf die Wahrheit) und § 294 ZPO (Glaubhaftmachen) zeigt.
17
Der Richter ist in seiner Beweiswürdigung frei, d.h. er ist vor allem grundsätzlich nicht an feste Beweisregeln gebunden. Ob er zu der erforderlichen Überzeugung in Tatsachen kommt, steht in seinem alleinigen Ermessen. Preis dieser Freiheit ist, dass der Richter seine Beweiswürdigung schriftlich darlegen muss, § 286 Abs. 1 Satz 2 ZPO. Die Beweiswürdigung ist Aufgabe und Verpflichtung des Tatrichters (§ 561 ZPO). Sie ist daher nur eingeschränkt revisibel, nämlich ob die Beweiswürdigung vollständig und rechtlich möglich ist und nicht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstößt.11
3. Beweiserleichterungen
18
Von den vorstehenden skizzierten Grundregeln gibt es Erleichterungen, um der sich in Unkenntnis oder Beweisnot befindlichen Partei zu helfen. Diese Erleichterungen können entweder bereits die Darlegung oder aber den Beweis der fraglichen Tatsache betreffen.
a) Bindungswirkung kartellbehördlicher Entscheidungen
19
Die größte Erleichterung für die an sich beweisbelastete Partei ist es ohne Zweifel, wenn eine Tatsache für das Gericht als unwiderlegbar festgestellt gilt. Denn dann entfällt sowohl die Darlegungs- als auch die Beweisbedürftigkeit der festgestellten Tatsache. Eine solche Feststellungswirkung kommt (bestandskräftigen) kartellbehördlichen Entscheidungen für die Feststellung des (Kartell-)Verstoßes zu.12 Diese sind von Gerichten von Amts wegen zu berücksichtigen, ohne dass sich eine Partei darauf berufen müsste (was in der Praxis freilich stets geschehen wird). Das von der Feststellungswirkung betroffene Gericht verliert zugleich die Kompetenz, die Kartellrechtswidrigkeit des Verhaltens selbst zu beurteilen.13 Es handelt sich um eine ausnahmsweise zulässige Beweisregel nach § 286 Abs. 2 ZPO.
20
Diese Bindungswirkung für Entscheidungen der Europäischen Kommission ist bereits seit der Masterfoods-Entscheidung14 des EuGH aus dem Jahre 2000 anerkannt. Danach dürfen nationale Gerichte, wenn sie über Vereinbarungen oder Verhaltensweisen zu befinden haben, die bereits Gegenstand einer Entscheidung der Kommission waren, keine Entscheidungen erlassen, die der Kommissionsentscheidung zuwiderlaufen.15 Weitergehend müssen nationale Gerichte es sogar vermeiden, sich in Widerspruch zu nur beabsichtigten Entscheidungen der Kommission über Art. 81 und 82 EG (heute: Art. 101 und 102 AEUV) in derselben Rechtssache zu setzen, etwa indem sie das nationale Verfahren bis zu einer Entscheidung der Kommission aussetzen.16 Diese Rechtsprechung ist 2004 mit Art. 16 VO 1/2003 kodifiziert worden.17 Anders als nach nationalem Recht ist die Bindung nicht davon abhängig, ob die Entscheidung der Kommission bestandskräftig ist.18 Die Bindung besteht vielmehr schon von Erlass der Kommissionsentscheidung an und endet erst mit einem aufhebenden Urteil der Unionsgerichte. Das folgt bereits aus Art. 278 AEUV, wonach Klagen bei dem Gerichtshof der Europäischen Union keine aufschiebende Wirkung haben. Die Bindungswirkung gilt nach Auffassung des EuGH selbst dann, wenn der Präsident des EuG im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes den Vollzug der Entscheidung aussetzt, da Rechtsakte der Gemeinschaftsorgane grundsätzlich die Vermutung ihrer Gültigkeit in sich tragen, solange sie nicht aufgehoben oder zurückgenommen worden sind.19 In einem solchen Fall wird das mitgliedstaatliche Gericht das nationale Verfahren i.d.R. nach § 148 Abs. 1 Alt. 1 ZPO bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage aussetzen.20
21
Der deutsche Gesetzgeber hat mit der 7. GWB-Novelle 2005 die Bindungswirkung von kartellbehördlichen Entscheidungen (samt etwaiger Rechtsmittelentscheidungen) in § 33 Abs. 4 GWB normiert, seit der 9. GWB Novelle findet sich die Bindungswirkung inhaltlich unverändert in § 33b GWB. Soweit Art. 16 VO 1/2003 weiter als § 33b GWB reicht, geht Art. 16 VO 1/2003 für Entscheidungen der Kommission vor.21
b) Beweislastumkehr
22
Eine weitere weitreichende Erleichterung ist es, die Beweislast für eine bestimmte Tatsache abweichend von der dargelegten Rosenberg’schen Normentheorie der Gegenpartei zu überantworten. Zusammen mit der Beweislast geht dann auch die initiale Darlegungs- und Beweisführungslast für den Hauptbeweis über. Der Gesetzgeber kann eine abweichende Beweislastverteilung entweder durch ausdrückliche Beweislastregeln oder aber durch gesetzliche Vermutung (§ 292 ZPO) zum Ausdruck bringen. Die Rechtsprechung kann richterrechtlich eine abweichende Beweislastverteilung entwickeln. Voraussetzung ist aber stets eine abstrakte Normierung; eine Beweislastumkehr im Einzelfall kommt nicht in Betracht. Schließlich können die Parteien sich privatautonom auf eine andere Beweislastverteilung einigen, wie dies vor allem durch Schadenspauschalisierungsklauseln geschieht.
aa) Ausdrückliche Beweislastumkehr
23
Ausdrückliche Beweislastregeln zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen regelmäßig entweder von „Beweislast“ oder „zu beweisen“ gesprochen wird oder aber die Erweislichkeit selbst zum Bestandteil des materiellen Tatbestandes erhoben wird. Das GWB enthält in den §§ 18 Abs. 7, 19 Abs. 2 Nr. 4 Hs. 2, 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 3 GWB bereits entsprechende Regelungen. Im Zuge der 8. GWB-Novelle ist eine weitere Beweislastumkehr in § 29 Satz 1 Nr. 1 GWB eingeführt worden, die allerdings nur für das Kartellverwaltungsverfahren und nicht für das Kartellzivil- und Kartellbußgeldverfahren gilt. Die 10. GWB-Novelle22 sieht ebenfalls eine Beweislastumkehr in § 19a Abs. 2 GWB zur effektiveren Kontrolle von Digitalkonzernen mit überragend marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb vor.23 Ob sich diese auf das Kartellzivilverfahren erstreckt, ist noch offen.
bb) Gesetzliche Vermutung (§ 292 ZPO)
24
Auch durch (widerlegliche) gesetzliche Vermutungen (§ 292 ZPO) erfolgt eine Sonderregelung der Beweislast. Bei Vorliegen der Vermutungsbasis wird die Feststellung bestimmter Tatsachen (Tatsachenvermutung) oder Rechtspositionen (Rechtsvermutung) fingiert. Die Partei, gegen die sich die Vermutung richtet, trägt dann die abstrakte Beweislast für das Nichtvorliegen der vermuteten Tatsache. Dieser Beweis ist nur durch den Beweis des Gegenteils, der zur vollen Überzeugung des Gerichts führt, möglich und nicht etwa durch einen schlichten Gegenbeweis, vgl. § 292 Satz 1 ZPO.
25
Das GWB enthält eine Reihe von gesetzlichen Vermutungen, wie in § 18 Abs. 4 GWB die Monopol-, in § 18 Abs. 6 GWB die Oligopol- und in § 20 Abs. 1 Satz 2 GWB die Abhängigkeitsvermutung. Von besonderer Bedeutung für kartellrechtliche Schadensersatzklagen sind die durch die 9. GWB-Novelle eingeführten Vermutungen der Schadensentstehung in § 33a Abs. 2 GWB und der Vermutung des Pass-on im Aktivprozess eines mittelbaren Abnehmers in § 33c Abs. 2 GWB.24
26
Nach § 33a Abs. 2 Satz 1 GWB, der Art. 17 Abs. 2 der Kartellschadensersatzrichtlinie umsetzt, wird sowohl die Existenz eines Schadens durch ein Kartell als auch die Verursachung des Schadens durch einen Kartellverstoß (Kausalität) widerleglich vermutet. Voraussetzung für das Eingreifen der Vermutung ist das Vorliegen eines „Kartells“ im Sinne von § 33a Abs. 2 Satz 2 und 3 GWB und Art. 2 Nr. 14 Kartellschadensersatzrichtlinie (Vermutungsgrundlage). Danach sind nur horizontale Absprachen und abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Wettbewerbern erfasst (u.a. Preisabsprachen und Kundenaufteilungen), nicht aber einseitiges wettbewerbswidriges Verhalten marktbeherrschender Unternehmen oder Vertikalabreden.25 Die Vermutung gilt nicht für die Existenz des Kartells,26 die (Kartell-)Betroffenheit27 und die Höhe des Schadens28.
27
Nach § 33c Abs. 2 GWB, der Art. 14 Abs. 2 Kartellschadensersatzrichtlinie umsetzt, gilt zugunsten mittelbarer Abnehmer auf allen (nachgelagerten) Stufen der Lieferkette eine gesetzliche Vermutung dafür, dass ein Preisaufschlag auf ihn abgewälzt worden ist, wenn die kumulativen Voraussetzungen des § 33c Abs. 2 Nr. 1–3 GWB erfüllt sind. Der Kartellant muss einen Kartellverstoß (eine wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung oder einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung29) begangen, der Kartellverstoß muss zu einem Preisaufschlag für den unmittelbaren Abnehmer geführt und der Abnehmer Waren oder Dienstleistungen erworben haben, die Gegenstand des Verstoßes waren, diese enthalten oder aus ihnen hervorgegangen sind.30 Hierfür trägt der mittelbare Abnehmer die Darlegungs- und Beweislast, wobei er sich hinsichtlich des Preisaufschlags auf Ebene der unmittelbaren Abnehmer auf die Vermutung aus § 33a Abs. 2 GWB berufen kann.31 Die Vermutung gilt nur dem Grunde nach, d.h. die Höhe der Abwälzung muss der mittelbare Abnehmer darlegen und beweisen.32 Die Vermutung gilt nicht für den Kartellbeteiligten, der sich gegen eine Inanspruchnahme durch einen unmittelbar Geschädigten mittels des Pass-on-Einwands gem. § 33c Abs. 1 GWB verteidigt und auch nicht für Abnehmer von Waren und Dienstleistungen von Kartellaußenseitern.33 Die Vermutung kann durch Beweis des Gegenteils (§ 292 ZPO) widerlegt werden. Alternativ kann der Kartellbeteiligte gemäß § 33c Abs. 3 GWB glaubhaft machen, dass der Preisaufschlag nicht oder nicht vollständig an den mittelbaren Abnehmer weitergegeben worden ist.34
28
Zur weiteren Stärkung der privaten Kartellrechtsdurchsetzung enthält die 10. GWB-Novelle eine neue Vermutung der Kartellbefangenheit vor. Nach § 33a Abs. 2 Satz 4 GWB soll künftig vermutet werden, dass Rechtsgeschäfte über Waren oder Dienstleistungen mit Kartellbeteiligten, die sachlich, zeitlich und räumlich in den Bereich des Kartells fallen (Vermutungsbasis), von diesem Kartell erfasst waren (Kartellbefangenheit). Nach § 33c Abs. 3 Satz 2 GWB soll diese Vermutung entsprechend für mittelbare Abnehmer gelten. Nach geltendem Recht müssen Kartellgeschädigte darlegen und beweisen, dass sie ein kartellbefangenes Produkt/Dienstleistung erworben haben.35 Hintergrund dieses gesetzgeberischen Vorschlags im Referentenentwurf vom Januar 2020 war die Rechtsprechung des BGH in Sachen Schienenkartell I sein, wonach für die Kartellbefangenheit statt eines Anscheinsbeweises „nur“ eine tatsächliche Vermutung streiten könne.36 Allerdings hat der BGH seine Auffassung in den nachfolgenden Schienenkartell-Urteilen Ende 2019 und Anfang 2020 dahingehend korrigiert, dass die Kartellbefangenheit der einzelnen Beschaffungsvorgänge für den haftungsbegründenden Tatbestand – für den das Beweismaß nach § 286 ZPO gilt – nicht festgestellt werden muss.37 Auch für die Schadenshöhe – für die der abgesenkte Beweismaßstab des § 287 ZPO gilt – müssen nicht zwingend Feststellungen zur Kartellbefangenheit einzelner Umsatzgeschäfte getroffen werden, wenn der Tatrichter zu der Überzeugung gelangt, dass sich die Kartellabsprache allgemein auf die durchsetzbaren Preise ausgewirkt hat.38 Richtigerweise hat der Gesetzgeber trotz dieses Hintergrundes die gesetzliche Vermutung nicht wieder fallen gelassen,39 sondern als sinnvolle Regelung im haftungsausfüllenden Tatbestand beibehalten.
cc) Auslegung und richterrechtliche Beweislastumkehr
29
Ist keine ausdrückliche Beweislastregel einschlägig, so ist im Wege der Auslegung zu ermitteln, ob dennoch eine abweichende Beweislastverteilung in Betracht kommt. Dabei muss die abweichende Beweislastverteilung abstrakt verallgemeinerungsfähig, d.h. für weitere Anwendungsfälle derselben Sachnorm praktikabel sein. Diese kann bereits durch Wortlaut und Satzbau der einschlägigen materiellen Norm(en) vorgegeben sein, wie durch „es sei denn, dass“, „dies gilt nicht“, eine Rechtsfolge „tritt nicht ein“, „fällt weg“, „beschränkt sich“ oder aufgrund von negativen Konditionalsätzen. Im GWB gibt es solche abweichende Beweislastverteilungen vor allem im Bereich der einseitigen Verhaltensweisen, und zwar für die Frage der sachlichen Rechtfertigung eines tatbestandlichen Verhaltens nach §§ 19 Abs. 2 Nr. 3, 20 Abs. 3 Satz 2 a.E. GWB sowie § 29 Satz 1 Nr. 1 GWB.40
30
Hilft der Wortlaut nicht weiter, kommt eine abweichende Beweislastverteilung unter teleologischen Aspekten in Betracht. Es ist zu ermitteln, ob die Verwirklichung des Normzwecks durch die bestehende Beweislastverteilung noch gewährleistet wird und welche sachlichen Gründe für bzw. gegen die bestehende Beweislastverteilung sprechen.41 Dabei sind vor allem Aspekte der Beweisnähe (Sphärengedanke), Wahrscheinlichkeitserwägungen und die Waffengleichheit der Parteien zu berücksichtigten. Wichtig ist auch hier, dass eine solche abweichende Beweislastverteilung generalisierbar sein muss. Sie darf daher nur im Wege der richterrechtlichen Rechtsfortbildung erfolgen und nicht etwa aus Billigkeitsgründen im Einzelfall, um der beweisbelasteten Partei im Falle von Beweisschwierigkeiten die Beweisführung zu erleichtern.
31
Die Rechtsprechung hat solche Beweislastumkehrungen etabliert, etwa bei der deliktischen Produzentenhaftung, bei groben ärztlichen Behandlungsfehlern sowie bei der groben Verletzung von sonstigen Berufspflichten.42 In der Literatur wird vertreten, dass bei einem Verstoß im Sinne von § 33 Abs. 1 GWB die Beweislast für das Nicht-Verschulden den Kartellanten trifft.43 Eine einheitliche Linie besteht noch nicht. Zum Teil soll das Verschulden auch bereits von der Bindungswirkung kartellbehördlicher Entscheidungen erfasst sein44, so dass schon keine Beweisbedürftigkeit entsteht. Wiederum andere wollen nur einen Anscheinsbeweis für das Verschulden akzeptieren.45 Die Rechtsprechung begnügt sich i.d.R. mit einer kurzen Feststellung des Verschuldens.46 Nur in wenigen Fällen wird näher zum Vorliegen von Fahrlässigkeit oder Vorsatz ausgeführt.47 Zum Teil legen die Formulierungen dabei nahe, dass die Gerichte das Verschulden als bereits von der Bindungswirkung kartellbehördlicher Entscheidungen umfasst ansehen.48 In anderen Entscheidungen weisen die Gerichte darauf hin, dass die Kartellanten als juristische Personen jedenfalls ein Organisationsverschulden treffe.49 Daraus folgt nach allgemeinen Grundsätzen für den Geschädigten, der keinerlei Einblick in den Organisations- und Herrschaftsbereich der Kartellanten hat, eine Beweiserleichterung. Weist der Geschädigte eine Pflichtverletzung des „Unternehmens“ nach, obliegt es dem Schädiger sich für sämtliche Repräsentanten und Verrichtungsgehilfen sowie dem Vorwurf des Organisationsverschuldens zu entlasten.50 Ob dies nur zu einer sekundären Darlegungslast oder zu einer Beweislastumkehr führt, ist nicht geklärt.51
32
Jedenfalls soweit sich der Kartellant auf einen Ausschlussgrund für sein Verschulden, namentlich einen unvermeidbaren Rechtsirrtum beruft, hat er die hierfür maßgebenden Umstände darzulegen und zu beweisen.52 Die Rechtsprechung stellt insoweit hohe Anforderungen.53 Steht zudem ein Verstoß gegen das europäische Kartellverbot im Raum, ist zu beachten, dass das nationale – durch die Kartellschadensersatzrichtlinie nicht vorgesehene – Verschuldenserfordernis nicht abschreckend auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wirken darf.54 Insoweit fordert das unionsrechtliche Effektivitätsprinzip,55 dass das Verschuldenserfordernis möglichst geringe Hürden für den Kläger bei der Anspruchsdurchsetzung aufstellt.