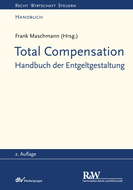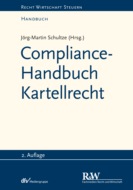Kitabı oku: «Kartellrechtliche Schadensersatzklagen», sayfa 21
dd) Beweisvereitelung
33
Die Rechtsprechung sanktioniert die Vernichtung bzw. Nichtbewahrung von Beweismitteln durch die nicht darlegungs- und beweisbelastete Partei als sog. Beweisvereitelung. Unter Beweisvereitelung ist jedes schuldhafte Verhalten zu verstehen, mit dem der beweisbelasteten Gegenseite die an sich mögliche Beweisführung verhindert oder erschwert wird.56 Ein solches Verhalten kann im Vorfeld oder während eines Prozesses auftreten. Das subjektive Element (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) muss sich sowohl auf die Entziehung des Beweisobjektes beziehen als auch darauf, die Beweislage des Gegners nachteilig zu beeinflussen.57 Es ist dabei nicht auf die objektive Beweislast, sondern auf die konkrete Beweisführungslast abzustellen.58 Die Beweisvereitelung kann also sowohl die Führung des Hauptbeweises als auch des Gegenbeweises betreffen.59 Betrifft die Beweisvereitelung hingegen die beweisführungsbelastete Partei selbst, vereitelt sie nur den ihr selbst obliegenden Beweis und bleibt damit schlicht beweisfällig.60
34
Beispiele für Beweisvereitelungen sind etwa die Verletzung von Dokumentationspflichten,61 die Beseitigung von Beweismitteln,62 die Weigerung der Benennung von Zeugen ohne triftigen Grund,63 die Verletzung handelsrechtlicher Buchführungs- und Aufbewahrungspflichten,64 die Zurückhaltung von Beweisurkunden65 und die Prozessverschleppung.66 Eine Beweisvereitelung ist abzulehnen, wenn die betroffene Partei den Beweis auch selbst hätte sichern können67 oder wenn höherrangige Interessen (bspw. der Schutz von Geschäftsgeheimnissen68) die Vorenthaltung eines Beweismittels rechtfertigen.69
35
Welche Rechtsfolgen eine Beweisvereitelung auf die Darlegungs- und Beweislast der Parteien hat, ist höchst umstritten. Für den Beweis durch Augenschein (§ 371 Abs. 3 ZPO) sowie für den Urkundsbeweis (§§ 427, 441 Abs. 3, § 444 ZPO) sieht die ZPO eine fragmentarische Regelung der Beweisvereitelung vor. Danach hat der Richter im Rahmen der Beweiswürdigung (§ 286 ZPO) darüber zu befinden, ob der vereitelte Beweis als geführt anzusehen ist. Im Übrigen ist viel streitig.70 Der BGH spricht in ständiger Rechtsprechung von „Beweiserleichterungen bis hin zur Beweislastumkehr“.71 Damit meint der BGH den Übergang der objektiven Beweislast, d.h. der beweisvereitelnden Partei obliegt der Hauptbeweis.72 Diese Rechtsprechung wurde in der Literatur vielfach kritisiert, vor allem weil die Verteilung der objektiven Beweislast nicht einzelfallbezogen von Billigkeitserwägungen und dem Parteiverhalten abhängig gemacht werden könne.73 Die Literatur vertritt daher überwiegend, dass eine Beweisvereitelung bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen ist und – je nach Grad des Verschuldens – Beweiserleichterungen bis hin zur Umkehr der konkreten Beweisführungslast, nicht aber der Umkehr der objektiven Beweislast, rechtfertigen kann.74
36
In der Praxis dürften die Ergebnisse nicht weit auseinander liegen: die Partei, die zumindest leicht fahrlässig Beweismittel zerstört, muss vertieft dazu vortragen, warum das zerstörte Beweismittel die von der Gegenpartei vorgebrachte Behauptung nicht hätte belegen können. Gelingt dieser Vortrag nicht zur Überzeugung des Gerichts, wird die Tatsache als bewiesen angesehen werden.
ee) Schadenspauschalisierungsklauseln
37
Eine spezielle Form der Beweislastumkehr stellen Schadenspauschalisierungsklauseln dar.75 Sofern sie wirksam in den Vertrag eingeführt wurden,76 das Kartelldelikt aus diesem Vertragsverhältnis resultiert und dem Anspruchssteller ein Schadensersatzanspruch dem Grunde nach zusteht, führen sie dazu, dass den Anspruchsgegner die Darlegungs- und Beweislast für eine geringere Höhe als die in der Klausel angegebene Schadenshöhe trifft.77 Entgegen bisweilen missverständlicher Formulierungen78 („Gegenbeweis“) handelt es sich hierbei um einen Hauptbeweis, also um den Beweis des Gegenteils. Das Gericht muss zum vollen Beweismaß des § 286 ZPO überzeugt sein, dass eine geringere als die in der Klausel angegebene Schadenshöhe zutrifft. Das reine Zweifelhaftmachen der vereinbarten Schadenshöhe (Gegenbeweis) reicht hingegen nicht aus. Für einen über die Pauschale hinausgehenden Schaden trifft wiederum den Kläger die (volle) Beweislast.79
38
Die Beweislastumkehr betrifft in einem zweiten Schritt die Frage, in welcher Höhe dem Kartellgeschädigten ein Schaden entstanden ist.80 In einem ersten Schritt muss der Kläger darlegen und beweisen, dass ihm überhaupt ein Schaden (in irgendeiner Höhe) entstanden ist.81 Dieser Nachweis ist im Kartellschadensersatz indes durch eine tatsächliche Vermutung nach altem Recht bzw. eine gesetzliche Vermutung nach dem neuen Recht der 9. GWB-Novelle in § 33a Abs. 2 GWB sowie in jedem Fall durch das reduzierte Beweismaß des § 287 ZPO erleichtert (siehe sogleich).
39
Die Beweislastumkehr greift ferner nur dann, wenn die Pauschalierungsklausel wirksam ist. Insbesondere darf die Schadensersatzpauschale den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht (wesentlich) übersteigen.82 Es ist streitig, wer für diesen Umstand die Beweislast trägt.83 Nach der wohl überwiegenden Rechtsprechung trägt der Verwender, d.h. der Kläger, hierfür die Beweislast.84 Dabei bejahte die instanzgerichtliche Rechtsprechung überwiegend die Wirksamkeit einer Pauschale bis zu einer Höhe von 15 %, soweit der Gegenseite der Nachweis eines niedrigeren Schadens nicht ausdrücklich abgeschnitten wurde.85 Eine höchstrichterliche Klärung steht hierzu noch aus. In den Schienenkartell-Entscheidungen hat der BGH nicht zur Wirksamkeit und Einbeziehung von Pauschalierungsklauseln Stellung bezogen, da er die Zulässigkeit von Grundurteilen beurteilte. Hierfür spielt die Wirksamkeit und Einbeziehung von Pauschalierungsklauseln gerade keine Rolle, da sich diese nur auf den haftungsausfüllenden und nicht den haftungsbegründenden Tatbestand auswirken.86
c) Beweismaßreduzierung
40
Das Beweismaß behandelt die Frage, welches Quantum an Wahrscheinlichkeit für die Überzeugungsbildung des Richters erforderlich ist. Das Regelbeweismaß des § 286 ZPO verlangt einen für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit, der Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen.87 Dem entspricht eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, falls sie dem Richter persönliche Gewissheit verschafft. Von diesem – im internationalen Vergleich hohen – Regelbeweismaß gibt es verschiedene Erleichterungen.
aa) Glaubhaftmachung (§ 294 ZPO)
41
Dazu gehören zunächst alle Vorschriften, die das Glaubhaftmachen (vgl. § 294 ZPO) einer Tatsache ausreichen lassen.88 Hierfür reicht es aus, dass der Richter die Wahrheit der behaupteten Tatsache für überwiegend wahrscheinlich hält. Überdies sind als Mittel der Glaubhaftmachung neben den üblichen Beweismitteln die eidesstattliche und anwaltliche Versicherung sowie die schriftliche Zeugenaussage zulässig, wobei alle Beweismittel in der mündlichen Verhandlung präsent sein müssen (§ 294 Abs. 2 ZPO). Das GWB sieht im Bereich der Kartellschadensersatzklagen Glaubhaftmachungen bei der Schadensabwälzung nach § 33c Abs. 3 GWB,89 bei dem Auskunftsanspruch nach § 33g Abs. 1 GWB90 sowie bei der Streitwertanpassung nach § 89a Abs. 1 GWB91 vor.
42
Problematisch von diesen Normen sind § 33c Abs. 3 und § 33g Abs. 1 GWB. Beide Normen sind mit der 9. GWB-Novelle in das Gesetz eingeführt worden. Die Verwendung des prozessrechtlichen Begriffs der „Glaubhaftmachung“ erschwert das Verständnis beider Vorschriften. Die Glaubhaftmachung i.S.v. § 294 ZPO bezieht sich nämlich auf Tatsachen und nicht auf Ansprüche. Der Einsatz als Voraussetzung eines materiell-rechtlichen Offenlegungsanspruchs (§ 33g Abs. 1 GWB) und zur „Widerlegung“ der gesetzlichen Vermutung des Pass-on (§ 33c Abs. 3 GWB) wird von vielen Stimmen als systemfremd kritisiert.92 Zumindest trägt diese Formulierung nicht zur Rechtssicherheit bei. Unklar ist etwa, ob die Glaubhaftmachung i.S.d. GWB-Normen die gleichen Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden Beweismittel hat. So soll eine Glaubhaftmachung nicht auf präsente Beweismittel – wie es § 294 Abs. 2 ZPO vorsieht – beschränkt sein.93 Ob sich der Kläger bei § 33g Abs. 1 GWB und der Beklagte bei § 33c Abs. 3 GWB über die Strengbeweismittel in §§ 371–455 ZPO hinaus auch eidesstattlicher Versicherungen, anwaltlicher Versicherungen und schriftlicher Zeugenaussagen bedienen kann, ist noch offen.94 Bei § 33g Abs. 1 GWB ist zudem – aufgrund der Abweichung von den Vorgaben der Kartellschadensersatzrichtlinie95 – unklar, welche konkreten Anforderungen für den Offenlegungsanspruch gelten. Für § 33c Abs. 3 GWB stellt sich die Folgefrage, ob der Kläger die Glaubhaftmachung des Beklagten durch eine (Gegen-)Glaubhaftmachung widerlegen kann oder nun den Vollbeweis für den Pass-on des Preisaufschlags erbringen muss.96
bb) Schadensschätzung (§ 287 ZPO, § 252 BGB)
(1) § 287 ZPO
43
Nach § 33a Abs. 3 Satz 1 GWB gilt für die Bemessung des Schadens § 287 ZPO.97 Hierbei handelt es sich um keine Neuregelung, dies galt in gleicher Weise für Altansprüche. Gemäß § 287 Abs. 1 Satz 1 ZPO darf das Gericht „unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung“ darüber entscheiden, „ob ein Schaden entstanden sei und wie hoch sich der Schaden oder ein zu ersetzendes Interesse belaufe“. Es handelt sich damit um eine Reduzierung des Beweismaßes. Für die richterliche Überzeugungsbildung genügt die deutlich überwiegende, auf gesicherter Grundlage beruhende Wahrscheinlichkeit, dass eine kartellbedingte Überzahlung entstanden ist.98 Der BGH nimmt bei der Wahrscheinlichkeitsbetrachtung und Schätzung nach § 287 ZPO in ständiger Rechtsprechung ausdrücklich in Kauf, dass das Ergebnis „unter Umständen mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt“.99 Die Schätzung muss (und kann) nicht exakt sein, sondern nur auf die ungefähre Höhe der Überzahlung abzielen.
44
Der BGH hat diese erhebliche Beweiserleichterung in seiner Lottoblock II-Entscheidung mit dem europarechtlichen Effektivitätsprinzip begründet: „Würde bei der Frage, ob durch einen Kartellrechtsverstoß ein Schaden entstanden ist, statt § 287 Abs. 1 ZPO die Vorschrift des § 286 ZPO angewendet, so bestünde die Gefahr, dass die effektive Durchsetzung des Kartellrechts der Union verhindert würde, weil im Hinblick auf die Vielzahl auf dem Markt wirksamer Einflüsse häufig nicht zur vollen Überzeugung des Gerichts feststehen wird, dass ein durch einen Kartellrechtsverstoß betroffener Marktteilnehmer auch tatsächlich einen Schaden erlitten hat.“100
45
Dabei unterliegt der gesamte haftungsausfüllende Tatbestand der Beweiserleichterung des § 287 ZPO. Die Existenz eines Schadens („ob“), die damit zusammenhängende haftungsausfüllende Kausalität und die Höhe dieses Schadens muss der Kläger danach nicht nach dem Vollbeweis dartun. Vielmehr gilt ein abgesenktes Maß an richterlicher Überzeugungsbildung. Meist formuliert die Rechtsprechung, dass eine „deutlich überwiegende, auf gesicherter Grundlage beruhende Wahrscheinlichkeit“ ausreicht.101 Teils stellt sie auch auf eine einfach „überwiegende“102, „erhebliche“103 oder „höhere oder deutlich höhere“104 Wahrscheinlichkeit ab, offenbar ohne dass sie den verschiedenen Begriffen unterschiedliche Bedeutungen beimisst.105 Dabei scheint die Rechtsprechung innerhalb des haftungsausfüllenden Tatbestands keine Abstufung vorzunehmen, sondern für die Ermittlung des Schadenseintritts dasselbe Maß an richterlicher Überzeugungsbildung genügen zu lassen, wie für die Kausalität und die Höhe des Schadens.106
46
Bei kartellrechtlichen Schadensersatzansprüchen, die unabhängig von der Verletzung eines bestimmten Rechtsguts entstehen, gehört bereits der erste Schadenseintritt zur haftungsausfüllenden Kausalität.107 Ebenfalls zur Schadensfeststellung und damit zur haftungsausfüllenden Kausalität gehört die Frage, ob sich die Kartellabsprache auf einen Beschaffungsvorgang tatsächlich ausgewirkt hat und das Geschäft damit „kartellbefangen“ war.108 Dies hat der BGH jüngst in der Schienenkartell-Entscheidung zum Jahreswechsel 2019/2020 klargestellt.109 Zur Schadensschätzung müssen daher nicht zwingend Feststellungen zur Kartellbefangenheit eines bestimmten Umsatzgeschäftes getroffen werden; es reicht aus, dass der Tatrichter zu der Überzeugung kommt, dass sich auf dem betroffenen Markt die Kartellabsprache allgemein auf die durchsetzbaren Preise ausgewirkt hat.110
47
Grundsätzlich sind alle Positionen einer Schadensberechnung einer Schätzung nach § 287 ZPO zugänglich, „soweit deren exakte Ermittlung unverhältnismäßig schwierig ist“.111 Dabei geht es vor allem um die von Kartellverstößen ausgehende Preiserhöhungswirkung.112 Erforderlich ist, dass der Geschädigte tatsächliche Umstände darlegt, auf deren Grundlage die Schadensschätzung durchgeführt werden kann.113 Erhält der klägerische Vortrag Lücken oder Unklarheiten, so ist es i.d.R. nicht gerechtfertigt, dem Kartellgeschädigten jeden Ersatz zu versagen. Der Tatrichter muss vielmehr nach pflichtgemäßem Ermessen beurteilen, ob nicht wenigstens die Schätzung eines Mindestbetrages möglich ist. Eine solche Schätzung darf nur dann unterbleiben, wenn sie mangels jeglicher konkreten Anhaltspunkte völlig aus der Luft gegriffen und daher willkürlich wäre.114
48
Den Schaden kann der Tatrichter unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeugung bestimmen.115 Dabei spielen Erfahrungssätze eine erhebliche Rolle,116 befreien den Tatrichter aber nicht davon, die konkrete Ausgestaltung und Durchführung des Kartells sowie weitere Umstände, die für und gegen einen Preiseffekt der Kartellabsprache sprechen, zu berücksichtigen.117
49
Nur eingeschränkt gilt der Beweiserschöpfungsgrundsatz: der Tatrichter ist (anders als im Rahmen der Tatsachenfeststellungen nach § 286 ZPO) nicht gezwungen, jeden angebotenen (und relevanten) Beweis zu erheben oder stets ein Sachverständigengutachten einzuholen.118 Diesen Grundsatz betonte der BGH jüngst in den Schienenkartell-Entscheidungen für wettbewerbsökonomische Schadensgutachten. Weder entsprechende Beweisanträge noch die Vorlage eines Parteigutachtens zwingen den Tatrichter ein Sachverständigengutachten einzuholen, wenn ihm bereits hinreichende Grundlagen für ein Wahrscheinlichkeitsurteil zur Verfügung stehen.119 Das Vorliegen oder Fehlen eines Kartellschadens könne ohnehin nie allein durch ein ökonomisches Gutachten angetreten werden, denn auch solche Gutachten können sich dem hypothetischen Wettbewerbspreis nur annähern.120 Weder kann ein Sachverständigengutachten die richterliche Gesamtwürdigung aller relevanten Anknüpfungstatsachen ersetzen noch kann die Vorlage eines Parteigutachtens diese Würdigung in die eine oder andere Richtung präjudizieren.121 Der BGH dürfte hier Konstellationen vor Augen haben, in denen die Kosten für ein ökonomisches Gutachten in keinem Verhältnis zu den zu erwartenden Schadensersatzbeträgen stehen. In diesen Fällen muss der Kläger, auch wenn der Beklagte ein Schadensgutachten vorlegt, nicht zwingend selbst ein Privatgutachten einholen. Es genügt, wenn er alle für die Schadensschätzung relevanten und ihm bekannten Anknüpfungstatsachen vorträgt.122 Das Gericht kann dann aufgrund eigener Sachkunde (ggf. unterstützt durch eine Stellungnahme der Kartellbehörden nach § 90 Abs. 5 GWB123) einen (Mindest-)Schaden schätzen.124
50
Nicht zulässig ist es jedoch, kartellrechtliche Schadensersatzklagen unter Verweis auf die Möglichkeit einer Beweisantizipation abzuweisen, nur weil der Kläger – anders als der Beklagte – (ggf. auch aufgrund fehlender finanzieller Möglichkeiten) kein Privatgutachten vorgelegt hat. Einer solchen Vorgehensweise steht entgegen, dass sich die Instanzgerichte nach den klaren Vorgaben des BGH in den Schienenkartell-Entscheidungen nicht allein auf ein privates Schadensgutachten stützen dürfen, sondern alle Umstände und insbesondere Erfahrungssätze (ob nun einen Anscheinsbeweis oder eine tatsächliche Vermutung125) für die Entstehung des kartellbedingten Schadens berücksichtigen müssen.126 Der Verzicht auf eine weitere Beweiserhebung – durch Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens – entspräche in solchen Fällen in aller Regel nicht pflichtgemäßem127 Ermessen. Gleiches dürfte in Fällen gelten, in denen beide Parteien – gleichermaßen plausible, auf aussagekräftiger Datenbasis beruhende – Privatgutachten eingereicht haben und dem Tatrichter eine eigene Schadensschätzung ohne sachverständige Unterstützung nicht möglich ist.
51
Die Einschätzung des Tatrichters ist mit der Revision nur daraufhin überprüfbar, ob er Rechtsgrundsätze der Schadensbemessung verkannt, wesentliche Bemessungsfaktoren außer Betracht gelassen oder seiner Schätzung unrichtige Maßstäbe zugrunde gelegt hat.128
52
Die Schätzungsbefugnis nach § 287 ZPO hat auch Einfluss auf die Zulässigkeit der Klage. Abweichend von § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf der Kläger einen unbezifferten Klageantrag stellen. Hierzu muss er in der Klagebegründung die Schätzungsgrundlagen darlegen und einen Mindestbetrag angeben.129
(2) § 252 BGB
53
Soweit der Geschädigte Ersatz des entgangenen Gewinns (etwa durch Absatzrückgang aufgrund teilweiser oder vollständiger Weitergabe der Preiserhöhung) geltend macht, gewährt § 252 Satz 2 BGB dem Kartellgeschädigten eine § 287 ZPO ergänzende Beweiserleichterung, indem dieser nur die Umstände darzulegen und in den Grenzen des § 287 ZPO zu beweisen hat, aus denen sich nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge (abstrakt) oder den besonderen Umständen des Falles (konkret) die Wahrscheinlichkeit des Gewinneintritts ergibt.130 Gelingt dem Kläger der Nachweis, dass ein bestimmter Gewinn wahrscheinlich war, wird vermutet, dass der Gewinn auch tatsächlich angefallen wäre; es obliegt dann dem Beklagten, zu beweisen, dass der Gewinn nach dem späteren Verlauf oder aus anderen Gründen dennoch nicht erzielt worden wäre.131
54
Wenn der Vortrag des Geschädigten Lücken oder Unklarheiten enthält, darf der Tatrichter nicht vorschnell auf die Unsicherheit möglicher Prognosen verweisen und daraus v.a. nicht herleiten, dass kein Schaden eingetreten sei. Auch in diesem Fall ist zu prüfen, ob nicht wenigstens ein Mindestschaden geschätzt werden kann.132
d) Anscheinsbeweis
55
Beim Anscheinsbeweis handelt es sich um eine von der Rechtsprechung entwickelte Beweiserleichterung von hoher praktischer Relevanz. Rechtstechnisch ähnlich der gesetzlichen Vermutung (und dem Indizienbeweis, s. sogleich) handelt es sich um eine Form der Beweisverlagerung. Anstelle der fraglichen Haupttatsache wird von einer anderen, an sich nicht erheblichen Tatsache (der sog. Hilfstatsache) auf die zu beweisende Haupttatsache geschlossen. Dieser Schluss beruht dabei auf der Erfahrung, dass typische Umstände gewisse Folgen nach sich ziehen, die deshalb ohne weiteren Nachweis rein erfahrungsmäßig nach dem ersten Anschein unterstellt werden dürfen.133 Es kommt damit darauf an, ob die Haupttatsache nach allgemeiner Lebenserfahrung eine derart typische Folge der bewiesenen Hilfstatsache(n) ist, dass auch vom Vorliegen der Haupttatsache ausgegangen werden kann. Entscheidend ist die Typizität des Geschehensablaufs, die es entbehrlich macht, die konkreten Einzelumstände des historischen Geschehens nachzuweisen (sog. Irgendwie-Schluss).134 Umstritten ist, ob dem Erfahrungssatz, der zu der Schlussfolgerung führen soll, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit zukommen muss (sog. Erfahrungsgrundsätze135) oder ob auch Erfahrungssätze, für die nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht (sog. einfache Erfahrungssätze), zur Führung eines Anscheinsbeweises ausreichen.136 Für den Bereich des Kartellschadensersatzrechts hat der Kartellsenat des BGH wiederholt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit verlangt, also Erfahrungsgrundsätze.137
56
Der Anscheinsbeweis greift ein, wenn die Tatsachen, die den typischen Lebenssachverhalt bilden (Hilfstatsachen), feststehen. Sofern diese Tatsachen streitig sind, müssen sie nach den allgemeinen Regeln zur vollen Überzeugung des Gerichts bewiesen werden. Die Überzeugung des Gerichts von dem Vorliegen dieser Hilfstatsachen kann durch einen einfachen Gegenbeweis erschüttert werden. Wendet sich der Gegner gegen den Anscheinsbeweis selbst, d.h. gegen den typischen Geschehensablauf, so sind die Anforderungen an die Erschütterung des geführten Anscheinsbeweises höher. Zwar besteht heute Einigkeit darüber, dass der Anscheinsbeweis nicht zu einer Umkehr der Feststellungslast führt, so dass kein Beweis des Gegenteils, d.h. kein zur vollen Überzeugung des Gerichts führender Beweis, erbracht werden muss.138 Doch reicht ein schlichter Gegenbeweis auch nicht aus. Vielmehr müssen konkrete und ernstliche Zweifel an dem erfahrungsgemäßen Geschehensablauf hervorgerufen werden.139 Gelingt dies der Gegenpartei durch die Behauptung und ggf. den Beweis entsprechender Tatsachen, so greift die ursprüngliche Beweislage wieder ein, d.h. die beweisbelastete Partei muss den Vollbeweis für die fragliche Haupttatsache erbringen. Die individuelle Beweiswürdigung durch die Tatsacheninstanz verdichtet sich beim Anscheinsbeweis damit auf die Frage der Erschütterung des Anscheins. Während die Beweiswürdigung des Tatrichters vom Revisionsgericht grundsätzlich nur eingeschränkt nachgeprüft wird, unterliegen die Existenz und der Inhalt eines Erfahrungssatzes und seine Anwendung durch den Tatrichter der vollen revisionsgerichtlichen Überprüfung.140
57
In der Entscheidung Schienenkartell I hat der BGH von diesem Prüfungsrecht Gebrauch gemacht und zwei in der Instanzrechtsprechung weit verbreitete Anscheinsbeweise folgenden Inhalts zurückgewiesen:141 Es entspreche erstens dem typischen Geschehensablauf, dass Produkte, die ein Kunde von einem Kartellanten auf einem von der Absprache betroffenen Markt erwirbt, von diesem Preiserhöhungseffekt erfasst werde (Kartellbefangenheit). Und eine Kartellabsprache führe zweitens bei den von ihr erfassten Produkten nach aller Lebenserfahrung zu einer Preiserhöhung (Schaden).
58
Der BGH widersprach und führte an, dass es jeweils an der für den Anscheinsbeweis erforderlichen „sehr großen Wahrscheinlichkeit“ eines typischen Geschehensablaufs zwischen der (behördlich) festgestellten Hilfstatsache und der zu beweisenden Haupttatsache gemangelt habe; es bestehe keine „sehr große Wahrscheinlichkeit“ dafür, dass Aufträge, die sachlich, zeitlich und räumlich in den Bereich der Absprache fallen, von dieser erfasst werden (Kartellbefangenheit), da es an der Kartelldisziplin oder an der Kartellkompetenz mangeln könne.142 Auch bestehe keine „sehr große Wahrscheinlichkeit“ dafür, dass ein langjährig bundesweit praktiziertes Kundenschutzkartell zur Erhöhung des Preisniveaus (Schaden) führe, da es wiederum an der Kartelldisziplin mangeln könne.143 Der BGH hat die beiden Anscheinsbeweise indes nicht ersatzlos gestrichen, sondern durch tatsächliche Vermutungen ersetzt (siehe sogleich).