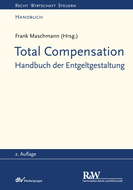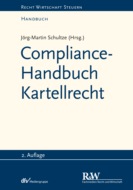Kitabı oku: «Kartellrechtliche Schadensersatzklagen», sayfa 22
e) Indizienbeweis und tatsächliche Vermutung
59
Eng mit dem Anscheinsbeweis verwandt ist der Indizienbeweis (mittelbarer Beweis). Auch bei diesem handelt es sich um eine Beweisverlagerung, bei der von an sich unerheblichen Hilfstatsachen (Indizien) auf die zu beweisende Haupttatsache geschlossen wird. Anders als beim Anscheinsbeweis liegt jedoch keine so hohe Wahrscheinlichkeit (Typizität) vor, dass diese Schlussfolgerung ohne Beweiswürdigung im Einzelfall gezogen werden könnte. Vielmehr darf das Gericht erst nach Würdigung aller Einzelindizien einen positiven Schluss auf die Haupttatsache ziehen. Der Indizienbeweis stellt damit eine Entscheidung im Einzelfall dar und bedarf des Vortrages und ggf. Beweises einer möglichst großen Zahl schlüssiger Indizientatsachen. Aus der Gesamtheit dieser Details des konkreten Sachverhalts kann das Gericht seine volle Überzeugung bilden. In der Rechtsprechung werden Indizienbeweise bisweilen auch als sog. tatsächliche Vermutungen bezeichnet.144
60
Im Kartellschadensersatzrecht wies der BGH in der Schienenkartell I-Entscheidung die soeben angesprochenen Anscheinsbeweise für die Betroffenheit und für das „Ob“ eines Schadens zurück, da es den Erfahrungssätzen an der erforderlichen sehr großen Wahrscheinlichkeit mangele. Nach der Schienenkartell IV-Entscheidung gilt dies ausdrücklich auch für die Frage, ob und in welcher Höhe ein Preisschirmeffekt auf einem kartellbeeinflussten Markt zu verzeichnen ist.145 Der BGH störte sich erkennbar daran, dass sich viele Instanzgerichte (gerade bei Grundurteilen) hinter dem Anscheinsbeweis verschanzt hatten und dessen Erschütterung offenbar nicht ernsthaft in Betracht zogen.
61
Durch die Zurücknahme des Anscheinsbeweises zwingt der BGH die Instanzgerichte nunmehr zur erwünschten Gesamtwürdigung der Umstände. Allerdings erkennt der BGH die tatsächliche Vermutung an, wonach den Hilfstatsachen „regelmäßig eine starke indizielle Bedeutung“ für die zu beweisende Haupttatsache zukommt, die im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu berücksichtigen seien.146 Der Hilfstatsache „Transaktion, die sachlich, zeitlich und räumlich in den Bereich der Absprache fällt“ kommt danach regelmäßig eine starke indizielle Bedeutung für die Kartellbefangenheit derselben zu. Und der Hilfstatsache „langjährig bundesweit praktiziertes Kundenschutzkartell“ kommt danach eine regelmäßig eine starke indizielle Bedeutung für die Entstehung eines Schadens („ob“) zu. Im Ergebnis dürften die Unterschiede marginal sein.147 Der Unterschied zwischen einer „sehr großen Wahrscheinlichkeit“ und einer „starken indiziellen Bedeutung“ ist hierfür zu graduell.148 Die seitdem ergangenen Urteile gelangen auf Basis der Indizien auch tatsächlich zum selben Ergebnis, wenn auch in Teilen – wie durch den BGH gewünscht – nach ausführlicherer Beweiswürdigung.149
62
Zwischenzeitlich hat der BGH in den nachfolgenden Schienenkartell-Entscheidungen die Frage der Kartellbefangenheit (ist eine Transaktion von dem kartellrechtswidrigen Verhalten beeinflusst?) überzeugend von der persönlichen Anspruchsberechtigung („Betroffenheit“) gelöst und der haftungsausfüllenden Kausalität zugeordnet.150 Damit gilt für beide Elemente, Kartellbefangenheit und Ob des Schadens neben der tatsächlichen Vermutung das reduzierte Beweismaß des § 287 ZPO.151
4. Darlegungserleichterungen
63
Der Beweiserhebung vorgelagert ist die Darlegung der relevanten Tatsachen. In vielen Fällen bereitet bereits dieser Umstand den Parteien in Kartellschadensersatzverfahren Probleme, da es an der erforderlichen Sachverhaltskenntnis fehlt. Einer solchen Situation kann zunächst durch eine adäquate Beweislastverteilung anhand der Herrschaftssphäre über die fragliche Tatsache entgegengewirkt werden, die sich als Reflex auf die Darlegungslast auswirkt. Aber auch wo eine solche Beweislastverteilung nicht möglich oder gewünscht ist, sind Erleichterungen auf der Ebene der Darlegung möglich. Überdies dürfen keine überzogenen Anforderungen an die sog. Substantiierung gestellt werden.
a) Keine überzogenen Substantiierungsanforderungen
64
Die Darlegungslast erschöpft sich nicht im schlichten Behaupten der relevanten Tatsache durch die jeweils (konkret) beweisführungsbelastete Partei. Vielmehr umfasst die Darlegungslast auch die Last, hinreichend substantiiert vorzutragen. Hinsichtlich der konkreten Anforderungen an diese sog. Substantiierungslast ist vieles umstritten. Die Frontlinie verläuft dabei tendenziell zwischen unter- und oberinstanzlichen Gerichten. Dabei kommt den Anforderungen an die Substantiierung eine erhebliche Bedeutung für kartellrechtliche Zivilverfahren zu, denn überzogene Anforderungen an die Substantiierung könnten der darlegungsbelasteten Partei angesichts der regelmäßig bestehenden Informationsasymmetrien von vornherein den Weg zur Beweiserhebung versperren.
65
Einigkeit besteht noch darüber, dass sich im Verlaufe des Verfahrens die Anforderungen an die Substantiierung nach den Einlassungen des Gegners richten.152 Wenn der Vortrag des Klägers, der seine Klage zunächst nur pauschal begründet, durch das (zulässige) einfache Bestreiten des Gegners wieder unklar wird, muss der Kläger die Anspruchsvoraussetzungen näher darlegen und substantiieren. Kommt der Kläger dieser Anforderung nach, ist es nunmehr an dem Beklagten, entsprechend substantiiert zu erwidern. Im Idealfall steigert sich der Substantiierungsgrad der Behauptungen im Prozess damit spiralförmig – es wird auch oft das Bild der miteinander kommunizierenden Röhren bemüht.
66
Streitig ist dagegen, welche (Mindest-)Anforderungen an den ersten klägerischen Vortrag gestellt werden. Der BGH153 und mit ihm die überwiegende Literatur154 verlangen lediglich, dass das Gericht in die Lage versetzt wird, aufgrund des tatsächlichen Vorbringens zu entscheiden, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für das geltend gemachte Recht vorliegen. Zu Beginn des Prozesses reicht es für den Kläger damit aus, Tatsachen vorzutragen, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet und erforderlich sind, das geltend gemachte Recht als in seiner Person entstanden erscheinen zu lassen. Es kommt zunächst nicht darauf an, das Gericht von der Wahrheit einer Sachverhaltsschilderung zu überzeugen. Es reicht aus, wenn der Richter beurteilen kann, ob nach dem eigenen Vorbringen der Partei die Voraussetzungen der Anspruchsnorm gegeben sind (Schlüssigkeit). Ein weiterer Vortrag von Einzelheiten ist nicht erforderlich, da für die Substantiierung ohne Bedeutung ist, wie wahrscheinlich die Darstellung ist.155 Weiterhin muss der Vortrag so bestimmt sein, dass er geeignet ist, die Erklärungslast des Gegners auszulösen.156 Dafür muss das Vorbringen nach Zeit, Ort und näheren Umständen so konkret sein, dass es dem Gegner eine sachgerechte Verteidigung ermöglicht.
67
Abzulehnen ist die Praxis einiger Instanzgerichte, das Vorbringen der Parteien unter dem Aspekt der Substantiierung einer Plausibilitätskontrolle zu unterziehen, denn das stellt eine verbotene vorgezogene Beweiswürdigung dar. Auch der BGH wird nicht müde, Urteile von Instanzgerichten wegen übersteigerter Anforderungen an die Substantiierungslast aufzuheben.157
b) Kein Schutz vor Selbstbelastung
68
Trägt die darlegungsbelastete Partei hinreichend substantiiert vor, so muss sich der Prozessgegner zu den vorgetragenen Tatsachen in gleicher Weise substantiiert erklären (§ 138 Abs. 2 ZPO). Ein Kartellbeteiligter kann sich dieser Mitwirkungspflichten im Prozess nicht unter Berufung auf den Nemo-tenetur-Grundsatz entziehen.158 Dieser Grundsatz schützt Beschuldigte einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit davor, sich selbst belasten zu müssen. Dieser Grundsatz gilt allerdings nicht unmittelbar in einem Schadensersatzprozess zwischen zwei Privatpersonen. Andernfalls wären, da bereits fahrlässige Verstöße gegen das Kartellrecht eine Ordnungswidrigkeit darstellen (§ 81 GWB), keine Fälle denkbar, in denen Kartellbeteiligte eine Mitwirkungspflicht aus § 138 Abs. 2 ZPO träfe. Dies ließe sich mit dem Gedanken effektiver privater Kartellrechtsdurchsetzung nicht in Einklang bringen.159
69
Schließlich finden die Zivilprozesse typischerweise erst im Anschluss an eine bestandskräftige behördliche Entscheidung statt (follow-on). Sofern es sich bei dieser behördlichen Entscheidung – wie zumeist – um eine Geldbußentscheidung gehandelt hat, besteht schon wegen des Verbots einer Doppelbestrafung (ne bis in idem) keine Gefahr der Selbstbelastung mehr.
c) Erklärung mit Nichtwissen und Wahrheitspflicht
70
Eine Darlegungserleichterung für die (objektiv) nicht darlegungs- und beweisbelastete Partei stellt die Erklärung mit Nichtwissen nach § 138 Abs. 4 ZPO dar. Nach § 138 Abs. 4 ZPO ist eine Erklärung mit Nichtwissen über sämtliche Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer Wahrnehmung gewesen sind; bei einer juristischen Person kommt es auf ihre Organe an. Eine zulässige Erklärung mit Nichtwissen steht dem Bestreiten gleich und führt zur Beweisbedürftigkeit der Tatsache (daher auch als Bestreiten mit Nichtwissen bezeichnet).
71
Die Erklärung mit Nichtwissen ist in deutschen Zivilverfahren eine beliebte Verteidigungstaktik. Ihr Reiz besteht darin, nicht lügen zu müssen und zugleich die Gegenseite im Schleier der Unwissenheit zurückzulassen. Erlangt die darlegungsbelastete Partei nicht auf andere Weise weitergehende Kenntnisse, wird ihr entweder schon der Beweisantritt misslingen oder aber das Gericht nicht überzeugen können (non liquet). In jedem Fall kann diese Taktik aus Sicht der nicht beweisbelasteten Partei – häufig der Beklagtenseite – sehr effektiv sein. Liegen die Voraussetzungen der Erklärung mit Nichtwissen indes nicht vor, bliebt das „Bestreiten“ folgenlos und der Vortrag des Gegners gilt gemäß § 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden.160 Die Beweislast für das Vorliegen der Erklärung mit Nichtwissen obliegen demjenigen, der sich mit Nichtwissen erklärt.161
72
Auch in Kartellschadensersatzverfahren wird notorisch mit „Nichtwissen“ bestritten. Dabei liegen die Voraussetzungen häufig nicht vor.162 Denn regelmäßig stehen Tatsachen im Streit, die entweder eigene Verhaltensweisen des Beklagten sind (Kartellverstoß) oder aber zumindest Tatsachen betreffen, die Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind. Darüber hinaus besteht über den Wortlaut des § 138 Abs. 4 ZPO hinaus eine Erkundigungs- und Informationsbeschaffungspflicht, sofern die maßgebenden Tatsachen solchen Personen bekannt sind, die unter Anleitung, Aufsicht oder Verantwortung derjenigen Partei tätig geworden sind, die sich im Prozess zu den Behauptungen des Gegners zu erklären hat.163 Nach Auffassung des OLG Karlsruhe164 und des OLG Düsseldorf165 sind hiervon auch andere Kartellbeteiligte umfasst. Es sei einem verklagten Kartellbeteiligten regelmäßig zuzumuten, sich die notwendigen Informationen dort zu beschaffen. Bestreitet der Kartellbeteiligte Vorgänge, die Handlungen anderer Kartellbeteiligter betreffen, vor einem Versuch der Informationseinholung mit Nichtwissen, sei dies unzulässig.166 Gesamtschuldnern sei es regelmäßig zumutbar, sich gegenseitig die zur Rechtsverteidigung notwendigen Informationen zu beschaffen. Ein entsprechender Auskunftsanspruch folge dabei aus § 426 Abs. 1 BGB.167
73
Des Weiteren ist ein Bestreiten mit Nichtwissen natürlich nur bei echtem Nichtwissen zulässig. In vielen Fällen wird sich ein Kartellant darauf aber nur schwer überzeugend berufen können. Denn die zivilen Schadensersatzverfahren sind in aller Regel behördlichen Verfahren nachgelagert, in denen sich der Kartellant jahrelang intensiv mit den relevanten Tatsachen befasst hat. Dies gilt in besonderer Weise, wenn es sich bei dem Kartellanten um einen Kronzeugen handelt. Dieser ist verpflichtet, alle relevanten Informationen und Beweise über das Kartell an die Kommission zu übermitteln. Er ist weitergehend gehalten, auch nach Stellung des Erstantrags den Kartellsachverhalt von sich aus weiter aufzuklären und die Zwischenergebnisse unverzüglich der Kommission zur Kenntnis zu bringen.168 Der Kronzeugenmitteilung169 lässt sich entnehmen, über welche Tatsachen der Kartellant aufklären muss. Dazu gehören unter anderem „eine eingehende Beschreibung der Art des mutmaßlichen Kartells, einschließlich z.B. seiner Ziele, Aktivitäten und Funktionsweise; Angaben über das betroffene Produkt bzw. die betroffene Dienstleistung, die räumliche Ausdehnung und die Dauer sowie eine Schätzung des von dem mutmaßlichen Kartell betroffenen Marktvolumens; genaue Angaben über mutmaßliche Kartellkontakte (Daten, Orte, Inhalte und Teilnehmer) und alle relevanten Erläuterungen zu den im Rahmen des Antrags beigebrachten Beweismitteln“.170
74
In diesem Zusammenhang ist auch die Wahrheitspflicht des § 138 Abs. 1 ZPO relevant. Der Kronzeuge kann nur dann abweichend von dem Inhalt der Kronzeugenerklärung vortragen, wenn sich seine Tatsachenkenntnis inzwischen verändert hat und der damalige Vortrag nicht mehr richtig ist. Dies ist auch vor dem Hintergrund von Settlements zu berücksichtigen. Diese umfassen nach der sog. Vergleichsmitteilung171 „ein eindeutiges Anerkenntnis der wesentlichen Elemente der Zuwiderhandlung auf der Grundlage des während der Vergleichsgespräche erzielten gemeinsamen Verständnisses mit der Kommission. Dies umfasst den Sachverhalt einschließlich der Teilnehmer, des betroffenen Produkts, des Ziels und der Modalitäten der Verletzungshandlung, der geographischen Reichweite und der Dauer sowie die rechtliche Bewertung sowie ein eindeutiges Anerkenntnis der Verantwortlichkeit für die dargestellte Zuwiderhandlung“.172
75
Eine Erklärung mit Nichtwissen durch einen beklagten Kartellanten mag hingegen zulässig sein, wenn sich der klägerische Vortrag auf sehr lang zurückliegende Beschaffungsvorgänge bezieht und sämtliche Kauf- und Vertragsdokumente nach Ablauf entsprechender handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfrist (in der Regel nach zehn Jahren) seitens der Beklagten vernichtet worden sind.173 Der Beklagte muss allerdings in einem solchen Fall zumindest glaubhaft machen, dass er die Unterlagen nach Ablauf der Fristen tatsächlich vernichtet hat und ihm daher eine Erwiderung nicht möglich ist.174
d) Sekundäre Darlegungslast
76
Eine Darlegungserleichterung für die beweisbelaste Partei und damit das Gegenstück zur Erklärung mit Nichtwissen stellt die sog. sekundäre Darlegungslast dar. Wie ausgeführt, richtet sich der Umfang der Darlegungslast (die Substantiierungslast) der bestreitenden Partei grundsätzlich nach dem Grad der Substantiierung des gegnerischen Behauptens. Trägt die beweisbelastete Partei nur pauschal vor, so darf sich die Gegenpartei auf ein schlichtes Bestreiten beschränken. Die beweisbelastete Partei ist sodann gefordert, nähere Ausführungen zu machen.
77
Dieser Grundsatz führt dann zu unbilligen Ergebnissen, wenn die beweisbelastete Partei außerhalb des Geschehensablaufs steht und den rechtserheblichen Sachverhalt von sich aus nicht oder nur unter größeren Schwierigkeiten ermitteln kann, während die nicht beweisbelastete Gegenpartei die Aufklärung infolge existenten oder leicht beschaffbaren Wissens unschwer leisten kann. In einer solchen Konstellation kann die beweisbelastete Partei zunächst nur pauschal vortragen. Die Gegenpartei könnte sich aus prozesstaktischen Gründen auf ein schlichtes Bestreiten beschränken. Der beweisbelasteten Partei wäre eine erfolgreiche Beweisführung schon aufgrund fehlender Tatsachenkenntnis kaum möglich.
78
Vor diesem Hintergrund hat die Rechtsprechung die sog. sekundäre Beweislast entwickelt, wonach die nicht beweisbelastete Gegenpartei ausnahmsweise verpflichtet ist, ihren Vortrag (Bestreiten) näher zu substantiieren, als es die beweisbelastete Partei getan hat.175 Eine solche sekundäre Darlegungslast trifft den Gegner dann, wenn die primär darlegungsbelastete Partei außerhalb des von ihr darzulegenden Geschehensablaufs steht und keine nähere Kenntnis über die maßgebenden Tatsachen hat, der Gegner alle wesentlichen Tatsachen kennt oder leicht aufklären kann und ihm nähere Angaben zuzumuten sind.176
79
Sind bestimmte Beweismittel nur der nicht beweisbelasteten Partei zugänglich und bekannt, so umschließt deren Erklärungslast auch die Benennung der betreffenden Beweismittel. Kommt der Prozessgegner dieser Pflicht nicht nach, gilt die Behauptung des primär Darlegungspflichtigen als zugestanden im Sinne des § 138 Abs. 3 ZPO. Genügt der Gegner dagegen seiner Darlegungslast, ist die weitere Beweisführung wiederum Sache des an sich Darlegungspflichtigen.177
80
Zentrale Bedeutung für das Bestehen und den Umfang der sekundären Behauptungslast kommt dem Kriterium der Zumutbarkeit zu. Zur Ermittlung der Zumutbarkeit sind die berechtigten Interessen der Parteien gegeneinander abzuwägen. So urteilte der BGH in einem kartellrechtlichen Verfahren, dass es nicht zumutbar sei, die Kostenstruktur und die Gewinnsituation offenzulegen, wenn die Parteien miteinander in hartem Wettbewerb stehen, da in einem solchen Fall die Aufdeckung derartiger Betriebsinterna geeignet sei, die Erfolgsaussichten eines Unternehmens im Wettbewerb nachhaltig zu beeinträchtigten.178 Da es sich bei der Unzumutbarkeit um eine Ausnahme handelt,179 trägt die sekundär behauptungsbelastete Partei die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen von Unzumutbarkeitsgründen.180 Im Einzelfall muss die beweispflichtige Partei allerdings konkrete Anknüpfungstatsachen vortragen, aus denen sich die Zumutbarkeit ergibt.181
81
Umstritten ist, ob dem Kartellbeteiligten die Grundsätze der sekundären Darlegungslast zugutekommen, wenn er sich in einem Kartellschadensersatzprozess mit einem unmittelbaren Abnehmer auf den Pass-on-Einwand beruft. Eine Beweisnot seitens des Kartellbeteiligten dürfte i.d.R. anzunehmen sein, da er keinerlei Einblicke in die Preiskalkulation des unmittelbaren Abnehmers bei der Weiterveräußerung des kartellierten Produktes haben dürfte. Zu dieser Frage hatte sich der BGH in der ORWI-Entscheidung positioniert. Die Bejahung einer sekundären Darlegungslast setze eine umfassende Prüfung ihrer Erforderlichkeit und Zumutbarkeit voraus. Eine sekundäre Darlegungslast ist tendenziell eher zumutbar, „je höher die vom Kartellteilnehmer darzulegende Wahrscheinlichkeit der Weiterwälzung des Schadens“ ist.182 Die Annahme einer sekundären Darlegungslast dürfe allerdings nicht zu einer unbilligen Entlastung des Schädigers führen.183 Aufgrund der Möglichkeit, mittelbaren Abnehmern den Streit zu verkünden, gebiete es die Effizienz privater Kartellrechtsdurchsetzung, eine sekundäre Darlegungslast des unmittelbaren Abnehmers nur „zurückhaltend“ anzunehmen.184
5. Prozessualer Schutz von Geschäftsgeheimnissen
82
In Kartellschadensersatzprozessen stellt sich für die Prozessbeteiligten oft das Problem, wie mit Geschäftsgeheimnissen185 (etwa Angaben zur Kostenstruktur und Gewinnsituation der Unternehmen) umzugehen ist. Sowohl für die Durchsetzung eines Schadensersatzanspruches als auch für die Verteidigung (z.B. mittels des Pass-on-Einwands) können Geschäftsgeheimnisse relevant werden. Die Parteien müssen entweder ihre eigenen Geschäftsgeheimnisse offenbaren oder sind darauf angewiesen, dass der Prozessgegner Geschäftsgeheimnisse offenlegt (z.B. Anknüpfungstatsachen für ein Sachverständigengutachten liefert). Insofern können Geheimhaltungsinteresse und prozessual erforderliche Sachverhaltsaufklärung miteinander in Konflikt stehen.
83
In Kartellschadensersatzverfahren ist der Begriff „Geschäftsgeheimnis“ allgegenwärtig. Doch ist zu berücksichtigen, dass nicht jede Tatsache der gewerblichen Geheimsphäre die Gefahr wettbewerblichen Missbrauchs in gleichem Maße heraufbeschwört. Vollkommen uninteressante Betriebsinterna begründen schon kein objektives Geheimhaltungsinteresse und fallen damit nicht unter die gewerbliche Geheimsphäre. Doch auch für Betriebsinterna, an denen grundsätzlich ein Geheimhaltungsinteresse bestehen mag, ist zu unterscheiden. Kundenlisten, Bezugsquellen, Kostenberechnungen und -strukturen, Preise, Gewinne und Herstellungsverfahren eignen sich in besonderer Weise für die missbräuchliche Ausnutzung. Die Kenntnis des Umsatzes oder der Umsatzentwicklung ist dagegen nur in besonderen Situationen prekär und regelmäßig offenzulegen.186 Überdies kommt dem Zeitfaktor eine große Bedeutung zu. Je geringer die Aktualität der geheimen Tatsache, umso geringer ist auch die Gefahr der Ausnutzung. So sollen Informationen nach fünf Jahren in der Regel ihren vertraulichen Charakter verlieren, es sei denn, der Betroffene weist nach, dass die Informationen trotz ihres Alters immer noch wesentliche Bestandteile seiner wirtschaftlichen Stellung sind.187 Die Kenntnis von aktuellen Preisen der Konkurrenz ist äußerst gefährlich, da sie eine Unterbietungsstrategie ermöglicht. Die Kenntnis vergangener Preise – in Follow-on-Kartellschadensersatzfällen oft viele Jahre später – erscheint weniger brisant, es sei denn, es handelt sich um sehr statische Märkte oder um Preise, die so stark von externen Faktoren (Rohstoffen) abhängen, dass eine Interpolation auf die gegenwärtigen Preise möglich ist.
84
Die Europäische Kommission plant eine (rechtlich nicht bindende) „Mitteilung über den Schutz vertraulicher Informationen im Rahmen der privaten Durchsetzung des EU-Wettbewerbsrechts durch nationale Gerichte“ zu erlassen. Der Entwurf wurde zur öffentlichen Kommentierung188 online zur Verfügung gestellt.189
85
Im Ausgangspunkt hat das Gericht die Aufgabe, zwischen den gleichrangigen verfassungsrechtlichen Positionen des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen (Art. 12 und 14 GG i.V.m. Art. 19 Abs. 3 GG), des Gebotes eines effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) sowie des Anspruches auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) einen größtmöglichen Ausgleich herzustellen.190 Dabei ist im Ausgangspunkt zu beachten, dass „[e]ine Art Geheimverfahren [...] mit dem geltenden Zivilprozessrecht unvereinbar“ ist.191 Sowohl Parteien als auch Streithelfer haben grundsätzlich einen Anspruch auf unmittelbaren und umfassenden Zugang zum Prozessstoff. Dennoch ist nach überwiegender Ansicht eine Einschränkung des Anspruchs auf Prozessteilhabe zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen unter Wahrung der Zumutbarkeit möglich.192
86
Dies zeigt bereits die 9. GWB-Novelle. Hiernach ist die Problematik in den §§ 33g, 89b GWB teilweise geregelt worden. Nach § 89b Abs. 7 GWB kann das Gericht die „erforderlichen Maßnahmen“ zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen treffen.193 Es kann etwa die Parteien dazu veranlassen, vertragsstrafbewehrte Vertraulichkeitsvereinbarungen untereinander abzuschließen, bei denen die Höhe der Vertragsstrafe im Ermessen des Gerichts steht. Unmittelbar bezieht sich die Kompetenz zur Anordnung von Schutzmaßnahmen nur auf Fälle, in denen über einen Auskunftsantrag nach § 33g GWB entschieden wird.194 Die Vorschrift dürfte aber auch Fälle erfassen, in denen das Gericht von sich aus – etwa nach § 142ff. ZPO – die Offenlegung von Beweismitteln anordnet.195 § 89b Abs. 7 GWB gilt jedoch nicht, soweit es um den Schutz von Geschäftsgeheimnissen geht, die der Geheimnisinhaber selbst vortragen möchte. Um eine einheitliche Regelung für den Geheimnisschutz in Kartellverfahren zu erzielen, könnte § 89b Abs. 7 allerdings entsprechend angewendet werden.196
87
§ 89b Abs. 7 GWB gilt aber nur für Klagen, die nach dem 26.12.2016 erhoben wurden. Für noch laufende Altverfahren kann die Vorschrift aufgrund der Stichtagsregelung in § 186 Abs. 4 GWB nicht analog angewendet werden. Insoweit besteht im deutschen Verfahrensrecht de lege lata kein normierter prozessualer Geheimnisschutz. Die möglichen Schutzmaßnahmen greifen nur punktuell.197 Daran ändert auch das zum 26.4.2019 in Kraft getretene Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen („GeschGehG“) nichts; dessen Regelungen zum Schutz von Geheimnissen im Zivilprozess kommen allein bei Verfahren, die die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen zum Gegenstand haben, zur Anwendung.198
88
Die in §§ 172ff. GVG geregelte Möglichkeit, unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu verhandeln und den anwesenden Personen eine Schweigepflicht aufzuerlegen, vermögen dann Linderung zu schaffen, wenn das Geschäftsgeheimnis nicht vor dem Prozessgegner/Streithelfern, sondern vor der Öffentlichkeit gewahrt werden soll. Die Wertung des § 172 Nr. 2 GVG ist dabei auch auf die Ermessensentscheidung zur Gewährung von Akteneinsicht gem. § 299 Abs. 2 ZPO zu erstrecken. Ein Verstoß gegen die Schweigepflicht ist nicht nur eine Straftat gem. § 353d Nr. 2 StGB, sondern darüber hinaus geeignet, eine Schadensersatzpflicht zu begründen. Sollten in einem Kartellschadensersatzverfahren jedoch – wie häufig – Wettbewerber oder Abnehmer bzw. Lieferanten als Partei oder Streithelfer beteiligt sein, so hilft der Ausschluss der Öffentlichkeit nicht weiter.
89
Es bleibt Gerichten nur die Möglichkeit, den Interessenausgleich zwischen effektivem Rechtsschutz und dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen innerhalb der Beweiswürdigung nach § 286 ZPO herzustellen. Dabei ist zunächst zu ermitteln, ob es um die Geheimhaltung einer entscheidungserheblichen Tatsache geht oder um die Geheimhaltung einer Tatsache, die anlässlich der Ermittlung einer entscheidungserheblichen, aber nicht geheimen Tatsachen zwangsläufig mitaufgedeckt würde; so etwa bei Einsicht in Geschäftsunterlagen. In diesem Fall bietet sich die Substituierung des unmittelbaren Beweises (etwa Urkundenbeweis durch Vorlage der Geschäftsunterlagen) durch einen mittelbaren Beweis an (sog. partielles Geheimverfahren).199 Als Beweismittler kommt eine zur Verschwiegenheit verpflichtete Vertrauensperson (zumeist ein Sachverständiger) in Betracht.200 Diese Konstruktion ist auch im Immaterialgüterrecht als sog. Wirtschaftsprüfervorbehalt bekannt.201 Dieser besteht darin, dass die vertraulichen Tatsachen einem vom Kläger gewählten neutralen Dritten (Wirtschaftsprüfer) mitgeteilt oder durch diesen ermittelt werden, der zur Verschwiegenheit verpflichtet ist und der dem Gericht nur die Ergebnisse seiner Prüfung mitteilt. Die Erklärung der Vertrauensperson ist dann das Beweismittel. Diese erfolgt bei Anwesenheit der Gegenpartei unmittelbar vor dem Prozessgericht und muss die entscheidungserheblichen Tatsachen vollumfänglich enthalten. Lediglich die nicht entscheidungserheblichen geheimen Tatsachen, deren Aufdeckung als „Kollateralschaden“ bei einer unmittelbaren Beweisaufnahme gedroht hätte, dürfen verschwiegen werden.
90
Problematischer sind die Fälle, in denen die geheim zu haltenden Tatsachen selbst entscheidungserheblich sind. Hierbei ist richtigerweise danach zu unterscheiden, wer die Beweislast für die geheime Tatsache trägt. Geht es also darum, ob die nicht beweisbelastete Partei eigene Geschäftsgeheimnisse zugunsten der Beweisführung des Gegners offenlegen soll oder ob eine Partei ihre Geschäftsgeheimnisse einsetzen müsste, um der ihr selbst obliegenden Darlegungs- und Beweislast zu genügen.202
91
Im ersten Fall ist auf Wunsch der beweisbelasteten Partei eine Art von Geheimverfahren richtigerweise zu akzeptieren.203 Die freiwillige Einschränkung des eigenen rechtlichen Gehörs ermöglicht erst einen effektiven Rechtsschutz. Verzichtet die darlegungs- und beweisbelastete Partei204 auf eigene Kenntnis im Rahmen der Beweisaufnahme, ist dem Geheimnisinhaber die Offenlegung des Geheimnisses regelmäßig zumutbar.205 Dies gilt erst recht, wenn zudem die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Konkret bedeutet dies, dass die Urkunden- bzw. Bucheinsicht, der Augenschein und die Vernehmung der Zeugen, Sachverständigen und der aufklärungspflichtigen Partei in Abwesenheit der beweisbelasteten Partei erfolgt. In diesem Fall lässt sich die Partei durch ihren Prozessbevollmächtigten und ggf. ökonomischen Sachverständigen vertreten, wobei diese strafbewehrt zur Verschwiegenheit (auch gegenüber der Partei) verpflichtet werden.206 Über das Ergebnis darf die beweisbelastete Partei nur insoweit unterrichtet werden, als dadurch keine Rückschlüsse auf das Geheimnis möglich sind.
92
Auch das Akteneinsichtsrecht gem. § 299 Abs. 1 ZPO ist entsprechend einzuschränken. Die prozessuale Stellung der im Rahmen des Geheimverfahrens aufklärenden Partei bleibt hingegen unangetastet. Sie darf der Beweisaufnahme beiwohnen und dem Gericht gegenüber uneingeschränkt Stellung beziehen. Weiterhin darf sie ohne Einschränkung die gesamten Akten einsehen.207 Auch dem Gericht selbst ist voller Zugang zu allen Informationen zu gewähren. Tenor, Urteilstatbestand und Entscheidungsgründe müssen so gefasst sein, dass ein genauer Rückschluss auf das Unternehmensgeheimnis unmöglich ist.208 Um insbesondere der Rechtsmittelinstanz die tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen zugänglich zu machen, kann eine vertrauliche Beiakte erstellt werden.209 Erklärt sich die beweisbelastete Partei zu einem solchen Verfahren bereit, wäre eine unberechtigte Weigerung des Prozessgegners als Beweisvereitelung in der Beweiswürdigung zu berücksichtigen.210 Besteht die Partei hingegen darauf, dass die Geheimnisse vollständig und gegenüber allen Prozessbeteiligten vorgelegt werden, darf der Prozessgegner die Vorlage verweigern, die Partei bleibt dann beweisfällig.211
93
Die Rechtsprechung hat sich zum Geheimverfahren im Wettbewerbsrecht inkonsistent geäußert. Der Kartellsenat des BGH hat ein solches in einer Entscheidung, in der es um eine marktmachtmissbräuchliche Kostenunterdeckung ging, zurückgewiesen. Die Vorinstanz OLG Karlsruhe hatte einen vereidigten Wirtschaftsprüfer als Sachverständigen beauftragt, sein Gutachten über die entscheidungserhebliche Tatsache der Kostenunterdeckung derart zu erstellen, dass weder Gericht (!) noch der beweisbelastete Kläger von den Befundtatsachen Kenntnis erlangten.212 Weder in seinen beiden schriftlichen Gutachten noch in seiner ergänzenden schriftlichen Stellungnahme hat der Sachverständige die wesentlichen Grundlagen seiner Begutachtung offengelegt.213 Das Verdikt des BGH war eindeutig. Die Verwertung der unter diesen Umständen zustande gekommenen Sachverständigengutachten wahre nicht das Recht des Klägers auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG). Sie entspreche auch nicht der Verpflichtung zur sorgfältigen und kritischen Würdigung des Gutachtens (§ 286 ZPO).214 Der Gutachter müsse die wesentlichen tatsächlichen Grundlagen seines Gutachtens offenlegen. Andernfalls sei sein Gutachten grundsätzlich unverwertbar.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.