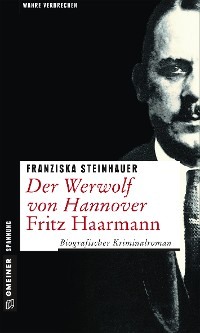Kitabı oku: «Der Werwolf von Hannover - Fritz Haarmann», sayfa 2
4. Kapitel
1924 im Juni
»Ludwig und ich werden eine Radtour machen. An der Leine entlang Richtung Hannover und dann ein Stück weiter, je nachdem, wie viel Zeit dann noch bleibt. Möglich, dass wir weiter kommen, als gedacht und mit dem Zug nach Hause fahren!«, erzählte Theodor begeistert beim Abendessen.
»Aber Junge! Du hast doch gar kein Rad!«, meinte die Mutter und schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen. »Wie soll das dann gehen?«
»Ich habe mir einen alten Drahtesel von Caroline geliehen. Sie braucht ihn nicht und hat mir erlaubt, ihn aufzumöbeln. Den Rost putze ich mit einer scharfen Bürste ab, ein bisschen Öl – und schon sieht das Rad gut aus und läuft ohne Schwierigkeiten. Und ein Zelt hat mir Jakob gegeben. Gehört seinem Onkel. Armeezelt. Da passen Ludwig und ich gemeinsam rein, so viel Platz!«
»Im Zelt?« Die Mutter war entgeistert. »Und wenn es regnet? Dann werdet ihr schnell keinen trockenen Faden mehr am Leib haben. Und die Sachen zum Wechseln sind dann auch nass. Den Tod werdet ihr euch holen!« Sie räumte laut klappernd das Geschirr in den Spülstein, wandte dem Sohn demonstrativ den Rücken zu. Sollte er ruhig sehen, wie übel sie ihm diese Planung nahm. Als der Junge schwieg, setzte sie weinerlich hinzu: »Und wovon wollt ihr leben? Es ist nicht einfach, sich Nahrungsmittel zu besorgen, wenn man fremd in der Gegend ist und nicht weiß, wo man sie bekommen kann«, ergänzte sie ihre Bedenken.
»Wir dachten, wir nehmen einen Grundvorrat mit und finden dann vor Ort heraus, wo wir was einkaufen können.«
»Richtung Hannover, ja?«, fragte der Vater grantig nach.
»Ja. Immer an der Leine lang. Und irgendwann machen wir kehrt und fahren zurück. Ich werde schon pünktlich wieder vor der Tür stehen!«
»Ja, das bezweifle ich ja auch gar nicht. Aber deine Tante hat mir vor ein paar Tagen einen Brief geschickt – und dort steht, man habe an der Leine schon mehrere Totenschädel gefunden. Die Polizei rätselt noch, wie die wohl in den Fluss gelangen konnten.«
»Ach Junge!« Die Mutter weinte leise, wischte dann hastig die Tränen mit dem Zipfel der Schürze fort. »Es ist gefährlich da draußen.«
»Aber Mutter, ich bin ja nicht allein! Der Ludwig ist doch mit mir! Und wir sind schnell wieder zurück. Sie werden kaum bemerken, dass ich fort bin.« Theo spürte Ärger in sich aufsteigen. »Ich bin ja kein kleines Kind mehr! Und wenn wir nur den Frühsommer genießen, was soll uns da schon passieren?«
Zu seinem Vater gewandt ergänzte er: »Schädel in der Leine! Du liebe Güte! Die können ja von Selbstmördern stammen! Warum sollen wir uns fürchten, wenn sich jemand seiner Schwierigkeiten wegen im Fluss ertränkt?«
»Ich verstehe dich, aber die Leute in Hannover machen sich schon länger Sorgen. Es verschwinden so viele Menschen, tauchen nie mehr auf, man hört kein Wort von ihnen. Und tatsächlich gibt es Gerüchte darüber, dass sie nicht verschwunden, sondern ermordet worden sind. Sollte es finstere Gestalten in der Stadt geben, die wahllos töten, so betrifft es Ludwig und dich eben doch!«, gab der Vater aggressiv zurück.
Theo wusste, wann er solche Gespräche besser beendete.
Er stand auf und ging.
Auch Ludwig stieß bei seinen Eltern nicht nur auf schiere Begeisterung.
»Ach Ludwig. Was, wenn ihr euch verletzt? Krank werdet?«
»Dann nehmen wir den nächsten Zug nach Hause und lassen uns vom Vater kurieren«, lachte der unbeschwerte junge Mann. »Was soll uns schon krankmachen? Wir sind jung und widerstandsfähig. Keine Sorge, es wird nichts geschehen.«
»Aber mit dem Rad. Da ist man schnell gestürzt. Und wenn es regnet, werdet ihr nass. Erkältungen kann man nur mit Ruhe und Wärme vertreiben – beides wird euch bei einer Fahrt mit dem Rad abgehen.«
Ludwig zeigte sich unbeeindruckt. »Wir wollten nicht bis Afrika kommen! Nur bis Göttingen vielleicht oder ein kleines Stück weiter. Wenn das Wetter gut ist, fahren wir etwa zehn oder zwölf Tage lang, schaffen es bis Hannover und nehmen den Zug für den Rückweg. Das haben Theo und ich schon besprochen.«
5. Kapitel
1918 Anfang Oktober / Fritz Haarmann
Damit er nicht bei dem zusehen musste, was ich nun seinem toten Körper antun würde, legte ich ein Tuch über seine inzwischen milchig trüben Augen.
Ehrlich gesagt, auch wegen des Gewürms, das sich schon munter tummelte.
Aus der Küche holte ich ein weiteres Tuch, damit ich das Blut aufnehmen konnte, überprüfte auch die Schärfe der Messer und des Beils, um eine unnötige Unterbrechung der Arbeit ausschließen zu können.
Die Sache duldete nun keinen Aufschub mehr, wollte ich vermeiden, dass jedermann ihn riechen konnte.
Der Tote womöglich aufkam.
Die Jungs hinter dem Café »Kröpke« erzählten gestern, ein Mann habe sich nach dem Verbleib seines Sohnes erkundigt. Friedel heiße der, und der Vater zeigte sogar ein Foto herum. Die Jungs sind bei diesen Nachfragen von Natur aus immer wortkarg, sind doch viele von ihnen entlaufene Fürsorgezöglinge – und man wusste ja nie, wer da tatsächlich fragte. Konnte ja jeder behaupten, er sei der Vater.
Eile war also geboten.
Aufschieben ging nicht mehr.
Ich begann mit den Beinen.
Schnell gelang es mir, die Unterschenkel aus den Kniegelenken zu lösen.
Ich legte sie zur Seite.
Begann dann sofort mit dem Trennen der Oberschenkel aus der Hüftpfanne.
Mein kleines Messer war willig, und wo es nicht weiterkam, half das Hackebeilchen.
Natürlich tat ich all das mit Grausen und Entsetzen.
Es war eine widerliche Aufgabe, die Stunden dauern mochte, vielleicht Tage.
Einfach eklig.
Wenn ich mich zurückerinnere glaube ich, ich habe mich mehrfach in einen kleinen Eimer übergeben, weil es so schrecklich war.
In den Eimer habe ich später auch das zerschnittene Gekröse geworfen. Schließlich sollte das ja durch den Abort …
Die Arbeit war aber nicht nur abstoßend, sie strengte mich sehr an. Derartig, dass ich mich immer wieder hinlegen und ausruhen musste.
Sobald es mir besser ging, machte ich weiter. Beeilen musste ich mich damit. Nicht auszudenken, wenn jemand gekommen wäre und ihn dort am Boden entdeckt hätte.
Die Schnitte über die gesamte Körperlänge führte ich mit dem Messer aus – ich wusste ziemlich genau, wie sie zu setzen waren.
Die Rippen – kein Problem.
Die Arme drückte ich weit nach oben, löste sie aus den Schultergelenken.
So wanderte Stück für Stück …
Es ging gut, wenn ich erst mal alle Knochen herausgelöst hatte.
Was blieb war nicht mehr als seine Hülle, die sich gut zerteilen ließ. In schmale Streifen und dann quer in winzige Quadrate.
Die Größe der Stücke richtete sich nach ihrer Schwimmfähigkeit. Waren sie schwer genug, versanken sie sofort, das Leichte, das oben schwamm, durfte nur in geringer Menge in den Fluss gelangen. Das musste besser in den Eimer.
Der Kopf. Wenn ihn jemand fand, konnte er erkennen, wem er zu Lebzeiten gehört hatte? Dem zuvorkommenden und willigen Freund meines Hübschen, dem fiele womöglich ein, wo man manchen Nachmittag und Abend in den letzten Wochen zubrachte. Dieses Risiko! Zu hoch!
Erst die Haare – das erledigte sich nach Art der Indianer.
Ich schabte alles Weiche ab, warf es ebenfalls in den Eimer.
So verfuhr ich auch bei den Knochen.
Die passten in eine Tasche aus Wachstuch.
Den Eimer kippte ich, wie geplant, in den Abort. Damit niemand eine Blick auf seinen Inhalt werfen konnte, deckte ich einen Lappen drüber, als ich damit über den Hof ging.
Die Knochen landeten in der Leine.
Blieb noch immer der Schädel.
Nach dem Lüften, Putzen und Aufräumen wickelte ich ihn in Zeitungspapier ein, stopfte das Päckchen in die Tasche, die mir schon zuvor gute Dienste geleistet hatte, und schob sie hinter den Ofen.
Insgesamt war ich viel unterwegs an jenem Tag und nun rechtschaffen müde.
Und das Zimmer gehörte wieder mir allein!
Glück im Unglück: Die Polizei, die mein Zimmer später durchsuchte, fand nur einen Freund des vermissten Jungen in meinem Bett. Der war ja quicklebendig.
Wegen der Unzucht gab es ein peinliches Verhör.
Den Schädel hinter dem Ofen entdeckten die Beamten aber nicht.
Hat eben keiner in die Tasche geguckt.
Wie sollten sie auch wissen, dass sie den Hübschen nie mehr lebendig finden konnten!
6. Kapitel
1924 Presseclub im Restaurant »Falkennest«
Eine Gruppe Zeitungsreporter traf wie üblich im »Falkennest« zusammen.
Einem kleinen, sauberen Restaurant in der Nähe des Bahnhofs, dessen Wirtin einen soliden Eindruck machte und für jeden Gast ein freundliches Wort hatte.
Schnell kam das Gespräch auf den Schädelfund in der Leine.
»Heute haben sie wieder einen gefunden. An der Brückmühle! Wieder mit ein paar Halswirbeln dran.« Ahab, der ein Holzbein hatte, hieß im wahren Leben Franz Kraus.
»Ja, das habe ich auch gehört! Und es soll sich um zwei Selbstmörder handeln. Bei der Zersetzung geht der Schädel schon mal verloren«, wusste ein anderer.
»Ne! So ist das nicht. Es waren ja an beiden noch Halswirbel! Da hat sich nichts gelöst. Und meine Quelle bei der Polizei erzählte mir, die Wirbelsäule sei im Nacken scharf durchtrennt worden. Dekapitieren sich selbst! Komische Selbstmörder dieser Tage, was?«, lachte der Pirat rau und ließ das Gummiband seiner Augenklappe gegen die Schläfe schnalzen.
»Ach Gustav, was bist du zynisch! So werden es wohl Unfallopfer sein.«
»Was soll das denn für ein Unfall gewesen sein? Arbeiteten beide für Carl Gröpler und wurden beim Putzen des Richtblocks vom heruntersausenden Fallbeil überrascht?«, lachte der Pirat Gustav Kieslinger kehlig. »Montag der Erste, dann der, den man damit beauftragt hatte, die Schweinerei zu beseitigen!«
»Also wirklich, das ist jetzt aber richtig geschmacklos!«, beschwerte sich Richard Schulz und der Pirat versuchte dem Kollegen in das Auge zu sehen, das nicht aus Glas war. Schwere Entscheidung.
»Na, müssen ja keine Selbstmörder gewesen sein«, bemühte sich Alfred Schubert um ein Glätten der Wogen. »Mein Bekannter bei der Polizei meint, es könnten auch Typhusopfer sein. Oder freigespülte Leichenteile aus dem überschwemmten Friedhof.« Hans zog ein kleines Notizbuch aus der Tasche. »Hier, ich hab’s mir aufgeschrieben.«
»Ich hab gehört, es könnte sich auch um einen Scherz der Studentenschaft in Göttingen handeln. Frisch aus dem Sektionssaal in die Leine. Aber das weiß natürlich auch niemand genau. Man zählt wohl gerade nach, ob noch alle da sind«, wusste Ahab. »Gerüchte sind in diesen Zeiten wohlfeil.«
»Na, das wäre aber ein wirklich grober Scherz!«
»Sicher. Aber man weiß doch, wie die Studenten so sind. Gaudeamus igitur!« Der Pirat zog wieder am Gummiband.
»Kannst du das bitte mal lassen? Das macht mich ganz nervös.« Alfreds Stimme klang gereizt.
»Das beschleunigt das Denken. Solltest du bei dir auch mal versuchen! Kannst ja probeweise einfach mit dem Finger gegen die Schläfe schnippen, dir geht das Band ja ab«, grinste Gustav hämisch.
»Die Leute auf der Straße sind beunruhigt. Einige munkeln von Mord. Behaupten, in Hannover gäbe es Menschenfallen, in denen junge Leute gefangen werden. Weil so viele vermisst werden.«
»Und nun haben alle Mordbuben in der Gegend sich darauf verständigt, ihre Opfer in die Leine zu werfen?« Richard zeigte dem Sprecher einen Vogel.
»Ach, was für ein dummes Geschwätz. Hannover ist nun mal eine Stadt, die Kriminalität anzieht. Hier sammelt sich viel lichtscheues Gesindel. Sobald die Polizei zu nahe ran rückt, tauchen die Halunken ab und sind eben verschwunden.«
»Gestern war ein Vater bei mir, der seinen Sohn sucht. Er war bei der Polizei, hat eine Vermisstenmeldung gemacht, aber er hat nicht den Eindruck, jemand kümmere sich ernsthaft darum.« Gustav sprach plötzlich leise. »Ist schon schlimm genug, wenn dir der Sohn abhandenkommt. Aber wenn du dann auch noch denken musst, dass das so gar niemanden interessiert, nicht einmal die, die man von Staats wegen fürs Suchen bezahlt, ist es besonders schlimm. Der Mann war so verzweifelt. Sein Junge hat vielleicht als Puppenjunge ›gearbeitet‹, das hat man ihm jedenfalls hinter dem ›Kröpke‹ erzählt. Nun ist er ratlos.«
»Ist doch kein Wunder, dass sich so viele junge Männer von ihren Familien absetzen. In den Kriegsjahren waren alle anderweitig beschäftigt, erzieherisch wurde viel versäumt, und viele Eltern hatten auch einfach nicht mehr die Kraft, sich gegen jugendliches Ungestüm durchzusetzen. Die Knaben haben Oberwasser, trauen sich alles, sind leichtsinnig, viele auch arbeitsscheu, sie suchen Freiheit.«
»Gestern habe ich einen getroffen, der erzählte mir, er wolle zur See fahren. Von Hannover aus?, habe ich den gefragt. Die jungen Leute lernen in der Schule nicht richtig, und vom eigenen Land haben sie schon gar keine Vorstellung! Aber nein, der wollte weiter nach Hamburg. Sind nicht alle arbeitsscheu. Enttäuscht scheinen sie mir. Ich habe manchmal den Eindruck, dass hier eine durch und durch deprimierte Generation heranwächst.«
»Meine Schwester nennt das anders: faul! Arbeitsscheu und faul! Das scheint zumindest in Bezug auf meinen Neffen und seine Freunde zuzutreffen.«
»Ist doch schwierig in diesen Zeiten. Wann immer du etwas möchtest, ist es entweder nicht zu bekommen oder zu teuer. Da könnte der eine oder andere schon den Eindruck gewinnen, Verbrechen lohne sich durchaus und bringt schneller was ein als harte Arbeit.«
»Was, wenn wirklich ein Mörder in der Stadt sein Unwesen treibt? Wir warnen in der morgigen Ausgabe. Eltern sollen ihre Kinder besser beaufsichtigen, die Bewohner der Stadt verdächtige Vorkommnisse oder Beobachtungen sofort melden, die Polizei soll den Vermisstenanzeigen nachgehen!«
»Das sind aber verflixt viele soll und sollen. Wenn du da mal nicht aus dem Blick verlierst, dass so manche Eltern durchaus froh sind, wenn das eine oder andere Familienmitglied nicht mehr am Tisch Platz nimmt. Die werden das bei der Polizei gar nicht anzeigen.«
»Schon möglich. Selbst für die, denen es nicht an Geld fehlt, ist es schwierig genug, überhaupt einzukaufen, um alle Mäuler zu stopfen. Man läuft ja über Stunden herum, nur um eine Mahlzeit zu sichern!«
»Nun ja …«, druckste Ahab rum und murmelte dann leise, »es gibt schon einige Quellen.«
»Illegal!«
»Was ist daran illegal, wenn es doch in den normalen Läden gar keine Ware gibt! Sollen wir nun alle Hungers krepieren? Manchmal kommt es mir vor, als interessiere es niemanden mehr, ob der normale Bürger überhaupt noch überleben kann!«, echauffierte sich Richard, von dem man einen solchen Kommentar nicht erwartet hätte. »Da muss man eben dort kaufen, wo es was gibt!«
»Gemüse vielleicht, Altkleider – aber Fleisch? Im Moment kommt es mir so vor, als würde so ziemlich alles vertilgt, was essbar aussieht. Ratten sicher auch. Oder am Ende hat jemand Nachbars Katze verwurstet. Miezi, die ich immer so gern gestreichelt habe. Nein! Das ist hohes Risiko!«
»Oder Menschenfleisch. Dann verputzt du zum Abendessen einen der verschwundenen Jünglinge und trägst so dazu bei, dass man ihn nie finden wird.« Der Pirat lachte scharf auf, als er in lauter entsetzte Gesichter sah.
»Du denkst ja wirklich völlig pervers!«, beschwerte sich Hans Meister.
»Na, nun mal ehrlich: Wenn bei mir mal Fleisch auf dem Teller oder in der Suppe ist, dann quatscht das nicht mehr! Woher soll ich dann wissen, wes Fleisch da zwischen den Möhrenstückchen schwimmt?«, gab Gustav grinsend zurück.
»Gut. Es reicht jetzt!«, beendete Richard das unappetitliche und durchaus beängstigende Gespräch.
»Habt ihr das auch gehört?«, schaltete sich Ahab ein. »Hannover ist inzwischen zu der Stadt für Diebe, Hehler, Einbrecher und anderes zwielichtiges oder lichtscheues Gesindel avanciert. Am Ende zieht dir hier einer mit dem Totschläger über den Scheitel, nur weil er neue Schuhe braucht, und deine so schön sauber sind.« Richard warf Ahab einen dankbaren Blick zu und stieg bereitwillig in das neue Thema ein.
»Du übertreibst mal wieder maßlos!«
»Wir kommen jedenfalls morgen auf Seite 1 damit raus, dass die Menschen sich sorgen. Spielende Kinder finden bei uns normalerweise keine blanken Schädel beim Toben an der Leine«, stellte Richard klar.
Der Pirat schmunzelte. »Nun, so ganz blank sollen sie auch gar nicht gewesen sein …«
7. Kapitel
1924 im Juni
Ludwig stapelte auf dem Bett, was er brauchen würde.
Packte nur ein, was er für notwendig hielt.
Viel war es nicht.
Sie planten eine Zweiwochentour – und sicher gäbe es unterwegs die eine oder andere Gelegenheit, Wäsche zu waschen.
Plötzlich stand seine Mutter in der Tür.
Sie lächelte verlegen, hielt die Hände hinter dem Rücken verborgen.
»Nun, Mutter? Was kann ich für Sie tun?«, fragte der Sohn und huschte einen zarten Kuss auf ihre Wange.
»Ach Ludwig – wie wird mir die Zeit lang werden ohne dich. Niemand hier, der sich am Abend zu mir setzt und sich mit mir unterhält – oder wohlig mit mir schweigt.«
»Ach! Wir sind nach so kurzer Zeit wieder zurück, da fällt Ihnen gar nicht auf, dass ich weg bin.« Tröstend strich Ludwig, der die Mutter um anderthalb Köpfe überragte, über ihre faltige Wange.
»Sieh mal«, freute sich die Mutter und zog hervor, was sie bisher versteckt gehalten hatte. »Ich dachte, falls du irgendwo ausgehen möchtest. Da brauchst du doch was Anständiges!« Mit erwartungsvoller Miene sah sie ihn an.
Ludwig war im ersten Moment sprachlos. Als er sich gefangen hatte, keuchte er: »Aber das sollten Sie nicht!«, und schlüpfte schon voller Begeisterung in Weste und Jacke, strich mit den Fingern über den angenehm weichen Stoff. »Ist das schön! Das muss Sie ja ein Vermögen gekostet haben! Und so schnell fertig! Vielen Dank!« Stürmisch umarmte er die Mutter.
»So gefällt dir der Anzug! Da bin ich sehr froh. Eigentlich solltest du ihn zum Studienbeginn bekommen, aber ich denke, du könntest schon früher Bedarf haben.« Lächelnd reichte sie ihm auch die Hose und verließ das Zimmer.
Rasch schlüpfte Ludwig hinein.
Präsentierte sich dann in der Küche.
»Prachtbursche!«, kommentierte der Vater zufrieden. Und steckte für beide Männer eine Zigarre an. »Die Weibsleute werden dir nur so nachstellen. Komm mit!«
Das Gespräch unter Männern fand draußen im Garten auf einer Bank statt.
Ludwig unterdrückte ein Grinsen, als er dem alten Arzt zuhörte, der ihn über gute Umgangsformen aufzuklären versuchte.
»Die jungen Damen, weißt du. Wenn sie zu nett sind, ist Vorsicht geboten. Früher gab es Dirnen ja nur in der Stadt, aber heutzutage können sie überall arglosen Männern auflauern. Und diese Frauen, die tragen Krankheiten in sich, die man am Ende gar nicht mehr ablegen kann und die selbst die nachfolgenden Generationen noch treffen.«
Ludwig versprach, vorsichtig zu sein.
Er sah zur Sonne auf, nahm einen kräftigen Zug an der Zigarre und freute sich auf die unbeobachtete Zeit mit Theo.
Theo selbst ordnete ebenfalls sein Gepäck.
Mit Ludwig war bereits abgesprochen, wie viel unbedingt gebraucht würde. Zufrieden betrachtete er die schmale Auslage auf dem Tisch. Das würde problemlos Platz in Tornister und Fahrradkorb finden.
Als es klopfte, sah er überrascht auf.
»Vater! Sie sollten doch nicht die enge Stiege heraufkommen. Das tut Ihrem Rücken nicht gut.«
»Das lass mal meine Sorge sein. Der Rücken wird sich fügen müssen. Er wird mir helfen, in den kommenden Tagen für zwei zu arbeiten!«, knurrte der Schreiner.
»Ja«, antwortete Theo kleinlaut. »Ich weiß, es wird Ihnen nicht leichtfallen. Aber wenn wir zurück sind, können Sie sich schonen. So viele Aufträge stehen nicht im Buch, vielleicht kann der eine oder andere Kunde ja auch noch warten.«
»Es war ja kein Vorwurf! Ich gönne dir den Ausflug mit dem Freund. Mit Ludwig hast du einen guten Jungen zur Seite, der keine Dummheiten planen wird. Hoffe ich jedenfalls«, setzte er dann hinzu und keckerte wie ein wütendes Eichhörnchen.
»Ludwig ist kein Wirrkopf – war er nie. Er will studieren!«
»Theodor, ich möchte, dass du dies hier annimmst!« Damit zog der Vater ein kleines Paket hervor, das er vor der Tür abgestellt hatte. »Ich dachte, vielleicht kannst du es brauchen!«
Mit bebenden Fingern zog der Sohn die Verschnürung auf. Starrte auf den Anzug, den er ausgepackt hatte.
»Vater! Der muss Sie viel Geld gekostet haben! Er … ist wunderbar!«
»So probiere ihn an. Im Leben eines jungen Mannes kann es unverhofft zu Situationen kommen, in denen er einen guten Anzug brauchen kann.«
Flugs zog Theo sich um.
»Perfekt! Der Werner hat ihn mit Liebe für dich geschneidert. Und das sieht man ihm auch an. Hier!« Er warf dem überraschten jungen Mann einen Wollschal zu. »Den hat deine Mutter gestrickt, Stulpen auch. Passt alles genau zum Anzug. Eigentlich solltest du das bekommen, wenn du als Nachfolger den Betrieb übernimmst. Aber deine Mutter … naja. Anfang Juni kann es manchmal noch sehr frisch sein.«
Theos Augen brannten.
Jetzt bloß nicht heulen!, ermahnte er sich, bloß nicht!
Nachts, als alles ganz still geworden war, lag Theo noch lange wach. Sah durch das kleine Fenster in die Dunkelheit hinaus. Träumte sich an die Leine. Es wird toll, wusste er.
Wir beide, Ludwig und ich, werden eine richtig gute Zeit haben, dachte er glücklich.
Sie trafen sich am nächsten Morgen, lachten fröhlich als sie entdeckten, dass beide Eltern sie ausgehfein gemacht hatten. Für den Fall der Fälle. Weil man ja nie wusste, in welche Situation ein Mann in ihrem Alter kommen konnte, und ein Anzug war schließlich immer die richtige Kleidung zu jedwedem Anlass.
»Nun müssen wir den auch noch einpacken!«
»Und gut einpacken. Der darf ja keinen Schaden nehmen! Stell dir das Gezeter vor, wenn wir zurückkommen, den Anzug nicht getragen haben und er dennoch Löcher zeigt!«
»Oder Stockflecken! Unvorstellbar!«
Ludwig nahm eine Karte aus der Tasche und skizzierte den Weg, den sie ab morgen fahren würden.
»Es bleibt bei morgen Früh? Gleich nach dem Frühstück?«, fragte er, und Theo nickte eifrig.
»Ich habe schon so gut wie alles beisammen. Proviant kriegen wir auch. Meine Mutter war um Mehl gegangen und hat uns Brot gebacken. Mhmmmm. Das hat geduftet!«
»Mehl?«
»Na ja, vom Schleichmarkt. Das Land bietet immer Möglichkeiten.«
Ludwig nickte verstehend. »Ist schon schlimm, dass unbescholtene Leute so einkaufen gehen müssen! Menschen, die sich ihr ganzes bisheriges Leben nie gegen das Gesetz verhalten haben, sind nun dazu gezwungen, nur um überleben zu können. Eine Verrohung der Gesellschaft, schimpft mein Vater.«
»Hat er ja nicht ganz unrecht, dein Vater! Man muss ja nur in die Zeitung schauen. Da gewinnt man den Eindruck, es sei nachgerade lebensgefährlich, auch nur durch eine Stadt zu gehen. Hier auf dem Land erscheint es noch erträglich. Aber in Hannover zum Beispiel, da schlagen sie dich nieder und rauben alles, was sie wegtragen können. Banden beherrschen ganze Viertel. Ungemütlich!« Theo unterstrich gestenreich seinen Bericht, und Ludwig konnte ein Grinsen nicht verkneifen. »Na, stimmt doch!«, setzte Theo hinzu. »Und man kann froh sein, wenn sie einen nicht zum Krüppel prügeln.« Der Sohn des Schreiners hatte von jeher ein eher ängstliches Naturell.
Ludwig nickte. »Hast ja recht. Die Krise bringt das Schlechte im Menschen an den Tag. Gier heißt die Triebfeder – und damit das nicht so auffällt, nennen die Leute es Not. Rechtfertigen damit ihr schlechtes Handeln.«
»Meinst du?«
»Ja! Sie nehmen mehr, als sie brauchen. Die Preise auf dem Schleichmarkt steigen. Mein Vater meint, es wird noch zu Mord und Totschlag kommen um eine Scheibe Brot. Und ganz ehrlich, selbst wenn sie dich ›nur‹ zum Krüppel schlagen, dann nehmen sie dir jede Zukunft. Und die kann dir nie jemand ersetzen.«
»Naja. Über die Zukunft haben wir ja schon gesprochen«, seufzte der Freund. Er zog einen Zettel aus der Tasche seiner Hose, strich ihn notdürftig glatt. »Hier habe ich mir aufgeschrieben, was ich auf gar keinen Fall vergessen darf.«
»Ach, Salami?«, las Ludwig vor und kicherte albern wie ein Pennäler. »Isst du die so gern?«
»Salami? Quatsch. Das heißt Socken! Die habe ich noch nicht eingepackt, die hingen noch zum Trocknen auf der Leine.«
»Oh, die Leine. Du weißt ja auch von den Schädeln, oder? Hannover ist, schon der Lage wegen, ein Zentrum für Kriminelle aller Couleur. Ein Freund meines Vaters arbeitet beim Sittendezernat. Und der schreibt von ganzen Vierteln voller Dirnen, Zuhältern und Homosexuellen. Eines heißt wohl ›Insel‹ oder ›Klein Venedig‹. Was für eine Bezeichnung! Klingt doch völlig harmlos, oder? Die Polizei hat in einigen Bereichen der Stadt die Lage offensichtlich nicht mehr unter Kontrolle.«
»Meine Mutter hat auch schon gejammert, wir sollten doch lieber nicht bis Hannover fahren. Die Stadt auf jeden Fall meiden. Ein gefährliches Pflaster, sagt sie.«
»Ich weiß. Ich musste ihr vorhin versprechen, dass wir uns fernhalten. So weit wie möglich. Denn wenn wir mit dem Zug von dort aus zurückfahren wollen, müssen wir ja zumindest bis zum Bahnhof«, grinste Ludwig breit. »Das werden wir ja noch überleben! Immerhin sind wir zu zweit, können einander im Auge behalten.«
»Bloß nicht in Gefahr begeben … Wahlspruch meines Vaters. Hat ihn nicht vor dem Sturz bewahrt.«
»Nun, alles hat man eben nicht im Griff. Eisglätte. Das war richtig Pech.« Er warf dem Freund einen schnellen Seitenblick zu, beobachtete, wie sich dessen Miene verhärtete. »Für ihn wie für dich!«
Sie schwiegen.
Gute Laune und Vorfreude schienen sich vollständig aufgelöst zu haben.
»Gut. Lassen wir das. So: Hier sind wir. Wir können unsere Pausenplätze nach Laune und Wetter festlegen. Bis Hannover ist es sooo weit nicht. Vielleicht starten wir flott, genießen dann ein bisschen und beeilen uns am Ende auf dem letzten Stück noch einmal richtig. Nehmen dann den Zug ab Hannover. Oder wir bummeln nur ganz gemütlich bis kurz nach Göttingen, machen kehrt und fahren mit dem Rad zurück.«
Schnell kehrte das Reisefieber wieder ein, und schon bald brüteten sie mit geröteten Wangen über dem Plan, überlegten, wie sie das Gepäck, das sich nun deutlich erweitert hatte, unterbringen würden.
»Wir nehmen den Hund vom alten Jochen mit. Der kriegt Satteltaschen und trägt den Proviant!«, lautete ein kichernd gemachter Vorschlag.
»Klar, und der türmt dann mit den ganzen leckeren Sachen!«
»Vielleicht habe ich da noch eine andere Idee. Es gab da mal einen Anhänger mit langer Deichsel, extra, um die an einem Rad zu befestigen. Wenn der noch hinten im Schuppen steht …«
Es wird ein kleines, aber sicher wunderbares, unvergessliches Abenteuer, versicherte sich Theo in Gedanken. Eine Reise, an die wir noch in Jahren zurückdenken werden.