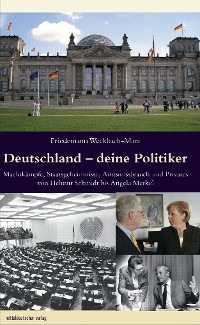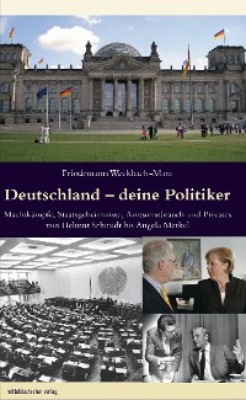Kitabı oku: «Deutschland – deine Politiker», sayfa 5
Krause und die Minister-Putzfrau
Weniger gut kam Bundesverkehrsminister Günther Krause, damals 34, davon. Der einstige Hoffnungsträger der DDR-CDU stolperte er über die Vermittlung von Raststätten-Konzessionen und seine eigene Putzfrau. Anfangs behauptete er, sich an Bemühungen der holländischen Firma Van der Valk um Konzessionen für Raststätten nicht erinnern zu können. Dann erfuhr ich von Briefen, die belegten, wie sehr sich Krause für die Raststätten-Firma eingesetzt hatte. Er schlug etwa vor, dass „neben den sechs Standorten auch an der Autobahn nach Rostock und noch zusätzlich an der Verbindung der jetzigen Fernverkehrsstraße von Lübeck nach Stralsund“ – Hinweis: dort lag Krauses Wahlkreis – „ein solches Vorhaben realisiert werden kann.“ Die Kritik an diesem Krause-Engagement zog sich länger hin, bis 1993 der nächste Schlag kam. Mitte März wurde die sogenannte Putzfrauen-Affäre bekannt. Wieder stritt er zunächst alles ab. Dann wurde belegt, dass er 660 D-Mark vom Arbeitsamt als Zuschuss zum Lohn seiner Putzfrau Edith Boelter kassiert hatte. Mehr noch. Krause und seine Frau Heidrun (damals 36) hatten massiv um den Zuschuss gefeilscht, denn das Arbeitsamt wollte zunächst nur 257 D-Mark (30 Prozent) zum Monatslohn von Frau Boelter (858 DM) zuschießen. Erst mit ihrem zweiten Antrag setzte das Ehepaar Krause den Zuschuss von 70 Prozent durch, der dann rückwirkend gezahlt wurde.
Auch Unionspolitiker, die Krause lange im Amt halten wollten, befürchteten nun, dass sein Negativ-Image zur Belastung für die Regierung würde. Ein Abgeordneter: „Krause wird Kohls Möllemann.“ Am 6. Mai 1993 musste Krause zurücktreten. Später folgten Offenbarungseid, Prozesse wegen Untreue, Betrug und Steuerhinterziehung.
Möllemann und der Einkaufschip
Tragisch im Sinne des Wortes endete Jürgen Möllemann, der vier Monate vor Krause zurücktreten musste, obwohl er so gern FDP-Bundesvorsitzender geworden wäre: 1993 stolperte er mit 47 Jahren über einen kleinen Einkaufchip.
In vielen vertrauensvollen Gesprächen mit ihm entstand über Jahre fast so etwas wie Freundschaft. Deshalb rief ich ihn warnend an: „Jetzt wird es eng. Das ist wie mit einer Lawine, die schon so lange bedrohlich am Berg hängt, dass nur noch jemand in die Hände klatschen muss, und schon geht alles krachend zu Tal.“ Seine Antwort war ehrlich wie immer: „Ich bin schon längst jenseits der Schmerzgrenze.“ Doch der Schmerz kam, obwohl es gemessen an seinen früheren Eskapaden eher einen kleineren Anlass gab. Also doch vergleichbar mit der Lawine. Ursache war diesmal ein Werbebrief auf offiziellem Ministerbogen zu Gunsten seines angeheirateten Vetters. Dieser produzierte kleine Plastikchips, die man statt der Geldmünze in das Schloss von Einkaufswagen schieben kann, was im Ministerbrief als „pfiffige Geschäftsidee“ gepriesen wurde und später im Volksmund „Möllemännchen“ hieß.
Massive Kritik kam aus der eigenen Partei mit Sätzen wie: „Ich habe große Zweifel, dass ein solcher Minister noch der deutschen Wirtschaft und seiner Partei erfolgreich dienen kann.“ Selbst der damalige FDP-Chef Otto Graf Lambsdorff machte „ein Fragezeichen hinter dem Namen von Bundeswirtschaftsminister Möllemann“.
Diese Kritik galt einem Mann, der selbst nie einen Zweifel daran gelassen hatte, wohin er will: ganz nach oben. 1969 trat Möllemann aus der CDU aus und in die FDP ein, weil bei den Liberalen schneller Karriere zu machen war: vom Grundschullehrer (Deutsch, Geschichte, Sport) 1972 in den Bundestag, 1982 Staatssekretär, 1987 Bildungsminister, 1991 Wirtschaftsminister, dann sogar Vizekanzler. Den Kollegen in Bonn war der Senkrechtstarter unheimlich. Es hagelte Spitznamen: „Magic Molli“, „Speedi“, „Mümmelmann“, „Minenhund“. Als PR-Fachmann (Mitinhaber einer Werbeagentur) störte ihn das wenig. Sein Motto: „Besser, die Leute reden schlecht über mich als gar nicht.“ Dabei war er im Amt auch stets fleißig, schuftete – bis ihn die Lust auf Schlagzeilen neu packte. Er versprach sogar, zehn Milliarden Mark Subventionen einzusparen und zurückzutreten, wenn ihm dies nicht gelänge. Es gelang nicht. Am 21. Januar wurde Günter Rexrodt (FDP) Möllemanns Nachfolger im Ministerium. Möllemann verstrickte sich danach bekanntlich in Spendenaffären und zunehmende Eigenentscheidungen, die nicht mit der FDP-Spitze abgestimmt waren. Das alles aufzuzeigen, ergibt Stoff genug für ganze Bücher.
Amigo-Affäre mit Stoiber
Im skandalträchtigen Jahr 1993 musste Bayerns Ministerpräsident Max Streibl (1932–1998, Ministerpräsident seit 1988) am 27. Mai seinen Hut nehmen. Zu viele Reisen mit Amigos in Flugzeugen des Rüstungskonzerns MBB waren ans Tageslicht gekommen. Auch sein damaliger Innenminister und CSU-Parteifreund Edmund Stoiber geriet in den Strudel der Amigo-Affäre, trat aber rechtzeitig die Flucht nach vorn an. Sein Berater und Sprecher Friedrich Wilhelm Rothenpieler erwies sich als wahrer Freund mit seinem Rat: Schnell intern alles überprüfen und dann in einer Pressekonferenz alles auf den Tisch. Stoiber gab selbst zu, jahrelang zu privaten und dienstlichen Zwecken mit Flugzeugen des Rüstungskonzerns MBB gejettet zu sein, außerdem für etliche Urlaubsreisen kostenlose Leihwagen von Mercedes, BMW und Audi benutzt zu haben. Strauß habe Wert auf gemeinsame Urlaube gelegt, rechtfertigte Stoiber Privat-Flüge beider Familien in MBB-Jets nach Frankreich und Italien: „Wer Franz Josef Strauß kannte, kann sich gut vorstellen, dass das keine reinen Vergnügungsreisen waren.“ Dazu gestand der frühere CSU-Generalsekretär und Chef der Münchner Staatskanzlei: „Mir ist bewusst, dass heute in der Öffentlichkeit solche Firmen-Leistungen kritisch betrachtet werden. Ich beurteile das heute anders als früher.“ Er beauftragte einen Steuerberater mit der Prüfung der Reisen. Das Geständnis brachte ihm ein paar Tage Schlagzeilen ein, dann war die Story alt und überholt. So kam er davon.
Sozialwohnungen für Abgeordnete
Danach sorgten Ende Oktober Bonner Politiker gleich reihenweise für Schlagzeilen, weil sie in staatlich subventionierten Wohnungen zu Mini-Mieten lebten. Auslöser war mein Artikel, in dem ich aufzählte:
Genau 10.366 D-Mark bekommt ein Bundestagsabgeordneter im Monat an Diäten. Dazu gibt’s 5.978 D-Mark als steuerfreie Kostenpauschale – unter anderem, um eine Zweitwohnung in Bonn zu bezahlen. 134 Abgeordnete machen damit ein Riesengeschäft. Sie kassieren wie Großverdiener und wohnen billig wie Sozialmieter – und zwar auf Kosten der Staatskasse. Die Apartments in bester Stadtlage sind in den Fraktionen heißbegehrt, man muss schon einige Bonner Jahre auf dem Buckel haben, um einziehen zu dürfen. Zu den Billig-Mietern gehören Bundespostminister Wolfgang Bötsch (CSU), die SPD-Spitzenpolitiker Rudolf Dreßler und Herta Däubler-Gmelin sowie Ex-Unionsfraktionschef Alfred Dregger. Auch die Ex-Minister Heinz Riesenhuber (CDU), Jürgen Möllemann (FDP) und Hans Engelhard (FDP) haben schon als Regierungsmitglieder von dem Mietskandal profitiert und wohnen noch heute in ihrem Appartement. Nur 280 D-Mark bezahlen die Politiker für ihre 41-Quadratmeter-Unterkünfte mit Kochecke und Balkon ganz in der Nähe des Bundestages Das ist eine Kaltmiete von knapp 6,83 Mark pro Quadratmeter. Vermieter ist die bundeseigene Immobilienfirma Baugrund. Die Appartements wurden Anfang der sechziger Jahre mit Bundeszuschüssen gebaut.
Wegen dieser Zuschüsse, so fordert die Kölner Oberfinanzdirektion, müssen die Bundestags-Appartements juristisch behandelt werden wie normale Sozialwohnungen. Das heißt: Wer zu viel verdient und zu wenig zahlt, muss eine „Fehlbelegungsabgabe“ entrichten. 247 D-Mark pro Monat verlangt die Behörde von jedem Abgeordneten.
Doch der SPD-Abgeordnete Peter Conradi, Wohnungsbau-Experte seiner Partei, zerstörte selbst diesen Versuch, ein wenig Mietgerechtigkeit herzustellen. Conradi wälzte die einschlägigen Gesetze und stellte fest: Nach der Rechtslage in Nordrhein-Westfalen dürften für die Abgeordneten-Appartements in Bonn insgesamt lediglich 8,20 Mark pro Quadratmeter verlangt werden. Die Oberfinanzdirektion kuschte vor dem Widerspruch des Abgeordneten und reduzierte die Fehlbelegungsabgabe auf 56 D-Mark.
Conradi, der sofort seine Nachbarn – wie Minister Bötsch – über seinen Erfolg informierte, blieb uneinsichtig. Er sagte mir: „Wenn das Land die Gesetze ändert, zahle ich auch mehr, vorher nicht.“ Die 134 Abgeordneten zahlten künftig also – Miete plus Abgabe – nur 336 D-Mark für ihr Appartement statt der sonst üblichen 800 D-Mark im Monat.
Die damalige Bundeswohnungsbauministern Irmgard Schwaetzer (FDP) beendete dann doch die Vorzugsbehandlung mit dem Hinweis: „Die Fehlbelegungsabgabe ist auf Sozialwohnungen zugeschnitten und daher für diese Abgeordneten-Wohnungen nicht geeignet. Daher bleibt uns nur ein Ausweg, um diese offensichtliche Ungerechtigkeit zu beseitigen: Wir verpflichten die zuständige bundeseigene Wohnungsgesellschaft, die öffentlichen Kredite vorzeitig zurückzuzahlen. Damit fallen diese Wohnungen aus der Mietpreisbindung heraus und werden mietrechtlich praktisch wie frei finanzierte Mietwohnungen behandelt. Abgeordnete brauchen eine Bleibe in Bonn, aber keine Begünstigungen wie bedürftige Sozialmieter.“
◆
Anfang 1994 hätte Carola von Braun (FDP) beinahe ihr politisches Köfferchen packen und ihren Job als Parteichefin und Fraktionsvorsitzende der Liberalen im Berliner Abgeordnetenhaus an den Nagel hängen müssen. Sie hatte immerhin acht Friseur-Rechnungen (1.238 DM) über die Fraktionskasse abgerechnet. Fraktionsgelder sind zum großen Teil Zuschüsse aus dem Landeshaushalt – also Steuergelder. Die Politikerin (Jahresgehalt 165.000 DM) rechnete auch für 8.000 D-Mark Flüge ab, um bei den Bundesvorstandssitzungen ihrer Partei in Bonn dabei zu sein. Rechtsanwalt Ekkehard Plöger (auch FDP-Mitglied) bekam von der haarigen Angelegenheit Wind, stellte Strafantrag wegen Veruntreuung von Steuermitteln.
Kritik auch aus Bonn. FDP-Haushaltsexperte und Fraktionsvize Wolfgang Weng: „Das ist völlig unmöglich und spottet jeder Beschreibung.“ Felix-Erik Laue, Landesvorsitzender vom Berliner Bund der Steuerzahler, ging noch weiter: „Ein eklatantes Beispiel für Selbstbedienung, Frau von Braun sollte sich aus der Politik zurückziehen.“
Die FDP-Fraktion sah das nicht so eng und beließ nach einer Abstimmung Carola von Braun (Nichte des verstorbenen Raketenforschers Wernher von Braun) in ihrem Amt. Noch einmal gutgegangen.
Ex-Juso-Chef verlangt das große Geld
Mitte Juni 1994 traf ich wie so oft Wolfgang Roth (*1941, Juso-Vorsitzender 1972–1974, Bundestagsabgeordneter 1976 bis September 1993) mittags bei „Ossi“ an der Bar. Es war der Bonner Polit-Treffpunkt im Bundeshaus unter der gastronomischen Leitung von Ossi Cempellin. Roth mit Bier in der Hand spottete wie üblich, weil ich zum Essen ein Glas Milch trank. Aber sonst verstanden wir uns über die Jahre recht gut. Bis ich auf seine neuen Geldforderungen zu sprechen kam.
Zur Erinnerung: Mehr als 10.000 D-Mark solle niemand in Deutschland monatlich verdienen dürfen, hatte er 1974 als Vorsitzender der Jungsozialisten gefordert. Im weiteren Verlauf seiner Karriere hat der Mann aus Schwaben den Wert des Geldes durchaus schätzen gelernt. Inzwischen schien er sogar zu jenen Politikern zu gehören, die nicht genug davon bekommen können. Jedenfalls verklagte Roth (damals 53) den Deutschen Bundestag, dem er 17 Jahre lang angehörte. Es ging dabei um Pensionszahlungen in sechsstelliger Höhe. Roth, zuletzt Wirtschaftssprecher seiner Fraktion, wechselte 1993 von Bonn nach Luxemburg und wurde dort Vizepräsident der EU-eigenen Europäischen Investitionsbank. Monatsgehalt: gut 26.000 D-Mark. Seine Amtszeit endete 1999. Roth stand danach als 58-jährigem sofort eine Pension für seine Bundestagszeit in Höhe von knapp 8.000 D-Mark zu.
Doch dem SPD-Mann war das zu wenig. Er wollte zusätzlich 3.000 D-Mark monatlich für sechs Jahre als Bankdirektor kassieren. Als die Bundestags-Verwaltung ihm ankündigte, die Luxemburger Pension werde mit den Bonner Zahlungen verrechnet, reicht Roth die Klage ein. Er hält die Bonner Rechtsposition für „eine blanke Unverschämtheit“. Bei seinem zweiten Bier sagte Roth: „Ich muss doch wohl für die sechs Jahre, die ich in Luxemburg tätig bin, eine zusätzliche Pension bekommen. Hier geht es schließlich um etwa 3.000 Mark, bei durchschnittlicher Lebenserwartung also um ein Gesamtruhegeld von zusätzlich gut 200.000 Mark. Es kann doch wohl nicht sein, dass ich am Ende mit dem Viertel meines letzten Einkommens in Rente gehen soll, nur weil die Pension aus Luxemburg mit der des Abgeordneten verrechnet wird.“ Hinter verschlossenen Türen schüttelten selbst Parteifreunde den Kopf über ihren langjährigen Fraktionsvize. Aber Roth setzte sich durch. Danach habe ich ihn nicht mehr bei Ossi gesehen.
Reisespesen mit Kohl als Kronzeuge
Mit Reisespesen der besonderen Art machte 1996 ein Bonner Staatsmanager von sich reden und berief sich dabei auch noch auf Bundeskanzler Helmut Kohl, der das gar nicht lustig fand.
Wie mir ein Freund erzählte und mit Dokumenten belegte, reiste der Chef der staatlichen Deutschen Entwicklungshilfe-Gesellschaft (DEG), Rainer von Othegraven (damals 59), mit Frau Marie-Luise regelmäßig dreimal im Jahr hochoffiziell zu den festlichen Empfängen der Weltbank. Mal stiegen die beiden im Washingtoner Nobelhotel „Madisson“, mal im Madrider „Palace“-Hotel ab – und immer ging alles, vom First-Class-Flug bis zum Luxushotel, auf Kosten der deutschen Staatsfirma. Für die Dame gab es sogar Tagegeld. Auf Wunsch stand ihr selbstverständlich ein eigener Dolmetscher zur Verfügung.
Der Bundesrechnungshof fand heraus, dass die aufwendigen Reisen des Geschäftsführers des deutschen Staatsunternehmens in der Zeit von 1990 bis 1994 insgesamt rund 820.000 D-Mark gekostet haben. Zwischen 66 und 86 Tage pro Jahr war Rainer von Othegraven (Jahresgehalt: 470.000 DM) unterwegs. Dazu steht in dem vertraulichen Gutachten des Bundesrechnungshofs auf Seite 11: „Auf die Ehefrau entfielen dabei an Fahrtkosten und Tagegeld mindestens 170.000 D-Mark.“
Ausgaben, die nach Auffassung der Rechnungsprüfer nicht korrekt sind: „Der Bundesrechnungshof ist der Ansicht, dass die DEG die Kosten für die Mitreise der Ehefrau des Geschäftsführers nicht hätte übernehmen sollen.“
Das sah Rainer von Othegraven völlig anders. Der DEG-Chef sagte mir am Telefon: „Das Reisen mit der Ehefrau hat absolut einen Sinn. Es ist Teil meines Erfolgs. Die Herren Kohl und Kinkel machen das ja auch so.“
Dagegen heißt es auf Seite 18 des Rechnungshofberichts: „Der Bundesrechnungshof sieht in Übereinstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen in den geleisteten Erstattungen über einen Zeitraum von fünf Jahren einen Verstoß gegen die eindeutige Regelung des Anstellungsvertrages.“
Kaum hatte ich darüber berichtet, reagierte das Kanzleramt empört auf die Othegraven-Behauptung, der Bundeskanzler handle schließlich genauso wie er. Dieser Vergleich mit Kanzler und Vizekanzler ging der Regierung entschieden zu weit. Sofort schwenkte der reisefreudige Othegraven um und wollte das so nicht mehr gesagt haben. Am Rosenmontag, den 19. Februar, zog der „Spiegel“ nach mit dem Hinweis, dass Othegraven nach Angaben des Bundesrechnungshofes eindeutig gegen seinen Anstellungsvertrag verstieß.
Das rief das Kanzleramt erneut auf den Plan. Kohl und seine Mitarbeiter zogen gegen mich als Urheber der Story alle juristischen Register, verlangten von mir Gegendarstellung, Unterlassungserklärung und was sonst noch möglich schien, denn Kohl wollte nicht in einem Atemzug mit der Reiseaffäre genannt werden.
Zu dem Zeitpunkt war ich gerade auf die Insel Juist dem Karneval entflohen. Eigentlich wollte ich sofort wieder zurück nach Bonn, aber es herrschten Eis und Schnee wie selten. Fähre und Flugzeuge standen still. Also gingen die meterlangen Faxe zwischen meinem Anwalt, meinem Büro und meinem Hotel hin und her. Da der Kohl-Anwalt gleich alles wollte, entschied der zuständige Richter, dass es notwendig sei, in der Sache zu ermitteln, statt sofort einer Gegendarstellung zu entsprechen. Gut für uns, denn Gegendarstellungen sind sonst bei Einhaltung der einfachen Rechtsnorm sehr leicht auch ohne sachliche Richtigkeit durchzusetzen. Am Ende hatten wir das Recht auf unserer Seite. Kohls Anwalt bekam nichts, nicht einmal die Gegendarstellung. Nur Othegraven bekam einen Rüffel.
Lustreisen im Verkehrsministerium
Ebenfalls um vermeidbare Kosten ging es 2002 im Bereich von Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig (SPD). Seine Mitarbeiter hatten beim Kauf wichtiger Geräte einen Aufpreis verlangt, um attraktive Fernreisen zu finanzieren. Das erfuhr ich aus streng vertraulichen Protokollen der Innenrevision des Ministers. Diese sechsköpfige Sondereinheit zur Bekämpfung von Korruption ist zuständig für die Beobachtung von über 13 Milliarden Euro staatlicher Investitionen des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen.
Nach dem Vermerk gestand am 29. Januar 2002 Dr. Volker W. dem Personal-Referatsleiter Volker Sch.: „Während meiner Zeit als Mitarbeiter im Sachgebiet M 35, unter Leitung von Herrn Dr. T. war ich schon von Beginn an öfter verwundert, dass er selbst, aber auch seine Mitarbeiter bei einer Neubeschaffung eines Großgerätes in das Ausland fuhren, um dort die Geräteeinweisungen, meist einwöchiger Einführungskurs, teilweise aber auch mehrmals, zu bekommen.“ In dem anschließend angefertigten Vermerk zum Disziplinarverfahren beschreibt Volker W., wie das von ihm gewünschte Messgerät, ein Massenspektrometer, für sein Arbeitsgebiet genehmigt wurde: Der dafür angesetzte Beschaffungsbetrag von 500.000 D-Mark wurde nicht ausgeschöpft, es blieben 75.000 D-Mark „übrig, die schnell ausgegeben werden mussten“. Dafür wurde ein „Ion-Trap-Detektor“ genehmigt mit der Aufforderung, den Anschaffungspreis soweit zu erhöhen, dass ein einwöchiger Auslandskurs für einen Mitarbeiter in Kalifornien ermöglicht würde. So habe ein Mitarbeiter für eine Woche nach Kalifornien fliegen können. Das sei „kein einmaliger Vorgang, sondern mehrfach so geschehen, selbst in jüngster Zeit“. So sind die Korruptionsbekämpfer des Verkehrsministeriums im nachgeordneten Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) auf weitere besonders schöne Traumreisen gestoßen, die dessen Mitarbeiter auf Staatskosten unternommen haben. Scarlett B. durfte im Oktober 2001 aus dem kühlen Hamburg für zwei Wochen in die tropische Inselwelt von Indonesien fliegen. Zwei Tage später folgte ihre Kollegin Elke H. nach Surabaya. Zur Begründung heißt es in ihren Reiseanträgen übereinstimmend: „Probeentnahme von Wasser- und Sedimentproben im Surabaya River und der Madura Bight.“

Der Bundesrechnungshof urteilt über das Bundesverkehrsministerium

Laut Bundesrechnungshofbericht von 2012 eine unzulässig abgerechnete Veranstaltung im Bereich des Bundesverkehrsministers
Nach dem Bericht an das Forschungszentrum Karlsruhe (Aktenzeichen 4391/01-M3) hat die Ermittlung der Schadstoffe im indonesischen Fluss Brantas in einem Jahr den Steuerzahler insgesamt 134.000 D-Mark gekostet, darunter Reisekosten für zwei Personen mit 12.000 D-Mark. Dafür haben die zwei Mitarbeiterinnen des BSH in Indonesien Wasser geschöpft, eine der beiden brachte das Schmutzwasser nach Deutschland zur Analyse, Elke H. blieb vor Ort, um noch zwei private Urlaubswochen anzuhängen.
Die offizielle Begründung dieses über Jahre beliebten Reise-Projekts für BSH-Mitarbeiter lautet, es sei ihre Aufgabe, Analysen von Wasserproben als Ergänzung zu automatischen Messungen zu nehmen. Das führte dann zu der Erkenntnis: „Der Brantas ist ein extrem hochbelasteter Fluss durch Einleitungen aus Industrie, Agrarwirtschaft und Kommunen. Es scheint daher angezeigt, ein umfangreiches Umwelt-Screening auf organische Schadstoffe und Schwermetalle durchzuführen. Dies soll in einer ausführlichen Beprobung von Wasser und Sediment erfolgen.“ So waren weiterhin Reisegründe gesichert. Aber nach meiner Veröffentlichung nahmen diese Reisefreuden ein jähes Ende. Allerdings wurden weiterhin Veranstaltungen auf Kosten der Allgemeinheit im Bereich des Bundesverkehrsministeriums beanstandet, wie der nebenstehende Bericht des Bundesrechnungshofes belegt.