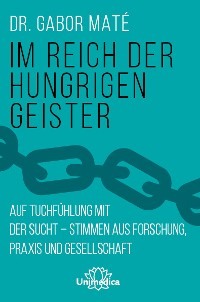Kitabı oku: «Im Reich der hungrigen Geister», sayfa 3
TEIL I
Der Höllenzug
Was war es eigentlich, was mich zum Opiumesser machte?
Elend, völlige Verlassenheit, bleibende, beständige Dunkelheit.
THOMAS DE QUINCEY
Bekenntnisse eines englischen Opiumessers

KAPITEL 1
Das einzige Zuhause, das er je hatte
Als ich durch die vergitterte Metalltür in den Sonnenschein trete, offenbart sich mir eine Kulisse wie aus einem Fellini-Film. Es ist eine Szene, die zugleich vertraut und fremd, fantastisch und authentisch ist.
Auf dem Gehweg in der Hastings Street sehe ich Eva – in ihren Dreißigern, aber immer noch wie ein verwahrlostes Kind wirkend, mit dunklem Haar und olivfarbenem Teint –, wie sie einen bizarren Kokain-Flamenco hinlegt. Sie schiebt ihre Hüften nach außen, bewegt ihren Oberkörper und ihr Becken hin und her, beugt sich in der Taille, wirft einen oder beide Arme in die Luft und bewegt ihre Füße in einer unbeholfenen, aber abgestimmten Pirouette. Die ganze Zeit verfolgt sie mich mit ihren großen, schwarzen Augen.
In Downtown Eastside ist dieses crackgesteuerte Improvisationsballett als „The Hastings Shuffle“ bekannt, und es ist ein vertrauter Anblick. Eines Tages, als ich auf meiner ärztlichen Visite in der Nachbarschaft unterwegs war, sah ich eine junge Frau, die diesen Tanz hoch über dem Verkehr in Hastings aufführte. Sie balancierte auf dem schmalen Rand eines Neonschildes zwei Stockwerke weiter oben. Eine Menschenmenge hatte sich zum Zuschauen versammelt, die Drogenkonsumenten unter ihnen mehr amüsiert als entsetzt. Die Ballerina drehte sich um sich selbst, die Arme waagerecht wie die einer Seiltänzerin, oder machte tiefe Kniebeugen – eine Kosakentänzerin der Lüfte, ein Bein nach vorne tretend. Bevor die Spitze der Feuerwehrleiter ihre Flughöhe erreichen konnte, hatte sich die bekiffte Akrobatin wieder in ihr Fenster zurückgezogen.
Eva bahnt sich ihren Weg zwischen ihren Gefährten durch, die sich um mich drängen. Manchmal verschwindet sie hinter Randall – einem an den Rollstuhl gefesselten, schwerfälligen, ernst dreinblickenden Burschen, dessen unorthodoxe Gedankenmuster nicht unbedingt auf eine ausgeprägte Intelligenz schließen lassen. Er rezitiert eine Ode autistischen Lobes an seinen unentbehrlichen motorisierten Streitwagen. „Ist es nicht erstaunlich, Doc, nicht wahr, dass Napoleons Kanone von Pferden und Ochsen durch russischen Schlamm und Schnee gezogen wurde? Und jetzt habe ich das hier!“ Mit einem unschuldigen Lächeln und ernster Miene schüttet Randall einen sich wiederholenden Schwall von Fakten, historischen Daten, Erinnerungen, Interpretationen, losen Assoziationen, Vorstellungen und Paranoia aus, der fast vernünftig klingt – beinahe. „Das ist der Code Napoleon, Doc, der die Transportmittel der unteren Ränge und Reihen veränderte, wissen Sie, in jenen Tagen, als diese angenehme Langeweile des Nichtstuns noch verstanden wurde.“ Eva schiebt ihren Kopf über Randalls linke Schulter und spielt Kuckuck.
Neben Randall steht Arlene, die Hände an den Hüften, mit vorwurfsvollem Blick und gekleidet mit knappen Jeans-Shorts und Bluse – was an diesem Ort ein Zeichen dafür ist, dass man auf diese Art sein Geld für Drogen verdient und nicht selten schon in jungen Jahren von männlichen Triebtätern sexuell ausgebeutet wurde.
Über das ständige Murmeln von Randalls Gerede hinweg höre ich ihre Beschwerde: „Sie hätten meine Pillen nicht reduzieren sollen.“ Arlenes Arme tragen Dutzende von horizontalen Narben, die parallel verlaufen, wie Eisenbahnschwellen. Die älteren sind weiß, die jüngeren rot, jede markiert ein Andenken an einen Schnitt mit der Rasierklinge, den sie sich selbst zugefügt hat. Der Schmerz der Selbstverletzung löscht, wenn auch nur vorübergehend, bei ihr den Schmerz eines größeren Schmerzes tief in ihrer Seele. Eines von Arlenes Medikamenten kontrolliert diese zwanghafte Selbstverletzung, und sie hat immer Angst, dass ich ihre Dosis reduziere. Das tue ich nie.
Ganz in unserer Nähe, im Schatten des Portland Hotels, haben zwei Polizisten Jenkins in Handschellen gelegt. Jenkins, ein schlaksiger Ureinwohner mit schwarzem, krausem Haar, das bis über die Schultern fällt, ist ruhig und fügsam, als einer der Beamten seine Taschen leert. Er beugt sich mit dem Rücken gegen die Wand, nicht die geringste Spur von Protest im Gesicht. „Sie sollten ihn in Ruhe lassen“, meint Arlene lautstark. „Der Typ dealt nicht. Sie schnappen ihn immer wieder und finden nie etwas.“ Zumindest am helllichten Tag kontrollieren die Polizisten in der Hastings Street mit vorbildlicher Höflichkeit – und nicht, wie meine Patienten sagen, mit der typischen Haltung von Ordnungshütern. Nach ein oder zwei Minuten wird Jenkins freigelassen und verschwindet, ohne etwas zu sagen, mit langen Schritten im Hotel.
In der Zwischenzeit hat der Dichterfürst der Absurdität innerhalb weniger Minuten die europäische Geschichte vom Hundertjährigen Krieg bis Bosnien aufgearbeitet und sich zur Religion von Moses bis Mohammed geäußert. „Doc“, so Randall weiter, „der Erste Weltkrieg sollte eigentlich alle Kriege beenden. Wenn das stimmt, warum gibt es dann die Kriege gegen Krebs oder Drogen? Die Deutschen hatten diese Kanone Dicke Bertha, die sie auf die Alliierten richteten, aber in einer Sprache, die den Franzosen oder Briten nicht gefiel. Gewehre produzieren ein übles Palaver, sie haben einen schlechten Ruf, Doc – aber sie haben die Geschichte vorangebracht, wenn man überhaupt davon reden kann, dass sich die Geschichte vorwärtsbewegt oder sich überhaupt bewegt. Glauben Sie, die Geschichte bewegt sich, Doc?“
Da unterbricht Matthew Randalls Debatte – er ist auf seine Krücken gelehnt, dickbäuchig, einbeinig, lächelnd, kahlköpfig und ungemein jovial. „Der arme Dr. Maté versucht nach Hause zu kommen“, sagt er in seinem charakteristischen Tonfall: sarkastisch und zugleich liebenswert aufrichtig. Matthew grinst uns an, als beträfe der Witz alle, nur nicht ihn selbst. Die verschiedenen Ringe, die sein linkes Ohr durchbohren, schimmern im goldenen Licht der späten Nachmittagssonne.
Eva tänzelt hinter Randalls Rücken hervor. Ich wende mich ab. Ich habe genug vom Straßentheater und will dem jetzt entfliehen. Der gute Arzt will nicht mehr gut sein.
Wir gehören zusammen, diese Fellini-Figuren und ich – oder sollte ich sagen, wir, diese Fellini-Crew –, vor dem Portland Hotel, wo sie leben und ich arbeite. Meine Klinik befindet sich im ersten Stock dieses vom kanadischen Architekten Arthur Erickson entworfenen Gebäudes aus Beton und Glas, eines geräumigen, modernen und zweckmäßigen Gebäudes. Es ist eine beeindruckende Einrichtung, die ihren Bewohnern gute Dienste leistet und das ehemals luxuriöse Haus aus der Jahrhundertwende um die Ecke ersetzt, das das erste Portland Hotel war. Der alte Ort mit seinen hölzernen Balustraden, breiten und geschwungenen Treppenaufgängen, muffigen Treppenabsätzen und Erkern hatte Charakter und Geschichte, die dem neuen Bollwerk fehlt. Obwohl ich die Aura der Alten Welt vermisse, die Atmosphäre von verblasstem Reichtum und Verfall, die dunklen und abblätternden Fensterbänke, die mit Erinnerungen von Eleganz behaftet sind, bezweifle ich, dass die Bewohner Sehnsucht nach den engen Zimmern, den korrodierten Rohrleitungen oder den Armeen von Kakerlaken haben. 1994 gab es einen Brand auf dem Dach des alten Hotels. Eine Lokalzeitung brachte eine Geschichte und ein Foto, auf dem eine Bewohnerin und ihre Katze abgebildet waren. Die Schlagzeile lautete: „Heldenhafter Polizist rettet Fluffy“. Jemand rief im Portland an, um sich zu beschweren, dass Tiere nicht unter solchen Bedingungen leben sollten.
Die gemeinnützige Portland Hotel Society (PHS), für die ich als Arzt tätig bin, verwandelte das Gebäude in eine Unterkunft für Obdachlose. Meine Patienten sind zum größten Teil Süchtige, obwohl bei einigen, wie Randall, die chemischen Gehirnprozesse so weit gestört sind, dass sie auch ohne Drogen den Kontakt zur Realität verloren haben. Viele, wie Arlene, leiden sowohl an psychischen als auch an Suchterkrankungen. Das PHS verwaltet mehrere ähnliche Einrichtungen in einem Umkreis von wenigen Häuserblocks: die Hotels Stanley, Washington, Regal und Sunrise. Ich bin als Arzt für alle Häuser zuständig.
Das neue Portland liegt gegenüber dem Kaufhaus für Armee- und Marinebedarf, wo meine Eltern als Neueinwanderer in den späten 1950er-Jahren den Großteil unserer Kleidung kauften. Damals war dieses Kaufhaus ein beliebtes Einkaufsziel für Berufstätige – und für Kinder aus der Mittelschicht, die auf der Suche nach ausgefallenen Militärmänteln oder Matrosenjacken waren. Draußen auf den Bürgersteigen gab es eine Mischung aus Studenten, die auf der Suche nach etwas Unterhaltung mit dem gemeinen Volk waren, sowie Alkoholikern, Taschendieben, Kauflustigen und Freitagabend-Bibelpredigern.
Jetzt ist es anders. Die Menschenmengen kommen schon seit vielen Jahren nicht mehr. Jetzt sind diese Straßen und ihre Hinterhöfe zum Zentrum von Kanadas Drogenhauptstadt geworden. Einen Block entfernt stand das verlassene Kaufhaus Woodward mit seinem riesigen, beleuchteten „W“-Schild auf dem Dach, das lange ein Wahrzeichen Vancouvers war. Eine Zeit lang belagerten Hausbesetzer und Anti-Armuts-Aktivisten das Gebäude, doch vor Kurzem wurde es abgerissen. Auf dem Gelände soll ein Mix aus schicken Wohnungen und Sozialwohnungen entstehen. Die Olympischen Winterspiele kommen 2010 nach Vancouver und mit ihnen droht die Wahrscheinlichkeit einer Gentrifizierung dieses Viertels. Der Prozess hat bereits begonnen. Es besteht die Befürchtung, dass die Politiker, die die Welt beeindrucken wollen, versuchen werden, die Suchtkranken zu verdrängen.
Eva verschränkt ihre Arme, dehnt sie hinter ihrem Rücken und beugt sich vor, um ihren Schatten auf dem Bürgersteig zu betrachten. Matthew kichert über die Yoga-Übungen der Cracksüchtigen. Randall schwafelt weiter. Ich blicke gespannt auf den vorbeiziehenden Berufsverkehr. Schließlich kommt die Rettung. Mein Sohn Daniel fährt vor und öffnet die Autotür. „Manchmal kann ich nicht glauben, dass das hier mein Leben ist“, sage ich und setze mich auf den Beifahrersitz. „Manchmal glaube ich es auch nicht“, nickt er. „Es kann hier ziemlich heftig zugehen.“ Wir fahren los. Im Rückspiegel sehe ich die sich entfernende Gestalt von Eva, gestikulierend, die Beine verrenkt, den Kopf zur Seite geneigt.
———
Das Portland und die anderen Gebäude der Portland Hotel Society stellen ein wegweisendes Sozialprojekt dar. Der Zweck der PHS ist es, ein System der Sicherheit und Fürsorge für marginalisierte und stigmatisierte Menschen zu schaffen – für diejenigen, die „die Erniedrigten und Beleidigten“ sind, um Dostojewski zu zitieren. Die PHS versucht, diese Menschen vor dem zu retten, was ein lokaler Dichter als „Straßen der Vertreibung und Gebäude der Ausgrenzung“ bezeichnet hat.
„Die Menschen brauchen einfach einen Raum, wo sie sich aufhalten können“, sagt Liz Evans, eine ehemalige Gemeindeschwester, deren soziale Herkunft aus der oberen Schicht mit ihrer gegenwärtigen Rolle als Gründerin und Direktorin der PHS unvereinbar zu sein scheint. „Sie brauchen einen Platz, wo sie leben können, ohne verurteilt, gejagt und belästigt zu werden. Es handelt sich um Menschen, die häufig als Belastung angesehen werden, für Verbrechen und soziale Missstände verantwortlich gemacht und … als Zeit- und Energieverschwendung betrachtet werden. Sie werden selbst von Menschen, die Mitgefühl zu ihrem Beruf gemacht haben, barsch behandelt.“
Seit den sehr bescheidenen Anfängen im Jahr 1991 ist die Portland Hotel Society gewachsen und inzwischen sehr aktiv. Sie ist an vielen Projekten beteiligt: an einer Nachbarschaftsbank, einer Kunstgalerie für Künstler des Downtown Eastside, dem ersten betreuten Drogenkonsumraum Nordamerikas, einer kommunalen Krankenstation, wo tiefe Gewebeinfektionen mit intravenösen Antibiotika behandelt werden, einer kostenlosen Zahnklinik und an der Portland Klinik, wo ich seit acht Jahren arbeite. Die zentrale Aufgabe des PHS besteht darin, Menschen, die sonst obdachlos wären, einen Aufenthaltsort zur Verfügung zu stellen.
Die Statistiken sind krass. Eine Überprüfung, die kurz nach der Gründung der PHS durchgeführt wurde, ergab, dass drei Viertel der Bewohner im Jahr vor ihrer Unterbringung mehr als fünf Mal ihre Adresse gewechselt hatten. 90 Prozent waren wegen Verbrechen angeklagt oder verurteilt worden, meist wegen Bagatelldelikten. Gegenwärtig sind 36 Prozent HIV-positiv oder haben Aids, die meisten der Bewohner sind süchtig nach Alkohol oder anderen Substanzen – nach allem von Reiswein oder Mundwasser bis hin zu Kokain oder Heroin. Bei über der Hälfte von ihnen wurde eine psychische Erkrankung diagnostiziert. Der Anteil der kanadischen Ureinwohner unter den Bewohnern vom Portland ist im Verhältnis fünfmal so hoch wie ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung.
Für Liz und die anderen, die die PHS mit aufgebaut haben, war es unendlich frustrierend zu beobachten, wie Menschen von einer Krise in die nächste gerieten, ohne dass sie eine konsequente Unterstützung bekamen. „Das System hatte sie im Stich gelassen“, sagt sie, „also haben wir versucht, die Hotels als Stützpunkt für andere Dienstleistungen und Programme einzurichten. Es dauerte acht Jahre, bis die Mittel zusammen waren, sowie vier Provinzregierungen und vier private Stiftungen, bis das neue Portland Wirklichkeit wurde. Jetzt haben die Menschen endlich ihre eigenen Badezimmer, Waschmaschinen und einen vernünftigen Ort zum Essen.“
Was das Modell von Portland so einzigartig unter den Angeboten für Süchtige macht und zugleich so umstritten, ist die zentrale Intention, die Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind – ganz gleich, wie dysfunktional, gestört und störend sie auch sein mögen. Unsere Klienten sind nicht die „Armen, die es verdient haben“; sie sind einfach nur arm – unverdient in ihren eigenen Augen und in denen der PHS. Im Portland Hotel gibt es weder das Hirngespinst der Erlösung noch die Erwartung sozial respektabler Ergebnisse, sondern nur eine unsentimentale Feststellung der realen Bedürfnisse von realen Menschen in einer schäbigen Gegenwart, die bei allen gleichermaßen auf einer tragischen Vergangenheit beruht. Wir können hoffen (und tun es auch), dass Menschen von den Dämonen, die sie heimsuchen, befreit werden können, und arbeiten daran, sie in diese Richtung zu ermutigen, aber wir haben nicht die Vorstellung, dass ihnen irgendein psychologischer Exorzismus aufgezwungen werden kann. Die unbequeme Wahrheit ist, dass die meisten unserer Klienten süchtig bleiben werden und, so wie es jetzt aussieht, auf der falschen Seite des Gesetzes. Kerstin Stuerzbecher, eine ehemalige Krankenschwester mit zwei Abschlüssen in Geisteswissenschaften, ist ebenfalls Direktorin der Portland Society. „Wir haben nicht auf alles eine Antwort“, sagt sie, „und wir können den Menschen nicht unbedingt die Fürsorge bieten, die sie brauchen, um ihr Leben entscheidend zu verändern. Am Ende des Tages liegt es nie an uns – entweder haben sie’s in sich oder nicht.“
Den Bewohnern wird so viel Hilfe angeboten, wie es die finanziell angespannten Ressourcen erlauben. Das Pflegepersonal der Einrichtung reinigt die Räume und hilft den Hilflosesten bei ihrer persönlichen Hygiene. Essen wird zubereitet und verteilt. Wenn möglich, werden die Patienten zu Terminen bei Fachärzten oder für Röntgenaufnahmen oder andere medizinischen Untersuchungen begleitet. Methadon, Psychopharmaka und HIV-Medikamente werden vom Personal ausgegeben. Alle paar Monate kommt ein mobiles Labor nach Portland, um auf HIV und Hepatitis zu testen und um weitere Bluttests durchzuführen. Es gibt eine Schreib- und Lyrikgruppe sowie eine Kunstgruppe, wo auch der Wandbehang entstand, der nach Zeichnungen von Portland-Bewohnern gestaltet wurde und jetzt an der Wand meiner Praxis hängt. Ein Akupunkteur und ein Frisör kommen ins Haus, Filmabende werden organisiert, und es gab – solange wir noch die Mittel hatten – einen jährlichen Campingausflug, um die Bewohner aus dem schmutzigen Umfeld von Downtown Eastside herauszuholen. Mein Sohn Daniel, der zeitweilig in Portland angestellt war, leitete eine monatlich stattfindende Musikgruppe.
„Vor ein paar Jahren hatten wir im Portland so einen Talentabend“, erzählt Kerstin, „zusammen mit der Kunst- und der Schreibgruppe, und es gab auch eine Kabarett-Vorstellung. Die Kunstwerke hingen an der Wand und die Leute lasen ihre Gedichte vor. Ein langjähriger Bewohner trat ans Mikrofon. Er sagte, er habe kein Gedicht, das er rezitieren wolle, oder sonst etwas Kreatives. Was er uns mitteilte war, dass das Portland sein erstes Zuhause sei. Dass es die einzige Heimat sei, die er je hatte, und wie dankbar er für die Gemeinschaft sei, der er angehörte. Und wie stolz er war, ein Teil davon zu sein, und wie sehr er sich wünschte, dass seine Mutter und sein Vater ihn jetzt sehen könnten.“
„Das einzige Zuhause, das er je hatte“ – ein Satz, der das Schicksal vieler Menschen in Downtown Eastside, einem Stadtteil in „einer der lebenswertesten Städte der Welt“* zusammenfasst.
———
Die Arbeit kann außerordentlich erfüllend, aber auch zutiefst frustrierend sein, je nach meinem eigenen Gemütszustand. Oft sehe ich mich mit der störrischen Natur von Menschen konfrontiert, die ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden weniger schätzen als die unmittelbaren, drogenbedingten Bedürfnisse des Augenblicks. Ich muss mich auch mit meinem eigenen Widerstand gegen sie als Menschen auseinandersetzen. So sehr ich sie, zumindest im Prinzip, akzeptieren möchte, erlebe ich mich an manchen Tagen voller Missbilligung und Bewertung, lehne sie ab und möchte, dass sie anders sind, als sie es nun mal sind. Dieser Widerspruch hat seinen Ursprung in mir, nicht in meinen Patienten. Es ist mein Problem – nur dass es mir angesichts des offensichtlichen Ungleichgewichts der Kräfte zwischen uns allzu leicht fällt, sie als Problem auszumachen.
Die Süchte meiner Patienten machen jede ärztliche Behandlung zu einer Herausforderung. Wo sonst finden Sie Menschen, die sich in einem so schlechten Gesundheitszustand befinden und die dennoch so abgeneigt sind, sich um sich selbst zu kümmern oder gar anderen zu erlauben, sich um sie zu kümmern? Manchmal muss man sie buchstäblich zu einer Behandlung im Krankenhaus überreden. Nehmen Sie Kai, der eine immobilisierende Infektion in seiner Hüfte hat, die ihn zum Krüppel machen könnte, oder Hobo, dessen Brustbeinentzündung sich auf seine Lungen ausbreiten könnte. Beide Männer sind so sehr auf ihren nächsten Kokain-, Heroin- oder Cristal Meth-Trip fixiert, dass die Selbsterhaltung keine Bedeutung mehr für sie hat. Viele haben auch eine tief verwurzelte Furcht vor Autoritätspersonen und misstrauen Institutionen aus Gründen, die ihnen niemand verübeln kann.
„Der Grund, warum ich Drogen nehme, ist, dass ich dann nicht die verdammten Gefühle habe, die da sind, wenn ich keine Drogen nehme“, sagte mir Nick, ein vierzigjähriger Heroin- und Crystal-Meth-Süchtiger, einmal weinend. „Wenn ich keine Drogen nehme, werde ich depressiv.“ Sein Vater hämmerte seinen Zwillingssöhnen die Vorstellung ein, dass sie nichts als ein „Stück Scheiße“ seien. Nicks Bruder beging als Teenager Selbstmord, Nick wurde drogenabhängig.
Das Höllenreich der schmerzlichen Emotionen macht den meisten von uns Angst. Drogensüchtige fürchten, dass sie dort für immer gefangen bleiben, wenn sie keine Drogen nehmen. Dieser Drang zur Flucht fordert einen schrecklichen Preis.
Die Flure und der Aufzug im Portland Hotel werden häufig, manchmal mehrmals täglich, gereinigt. Einige Bewohner haben von den Injektionsnadeln chronisch wässernde Wunden. Blut tropft auch von Platzwunden und Schnitten, die ihnen von ihren Mitsüchtigen zugefügt wurden, oder aus Verletzungen, die Patienten sich während kokaininduzierter Paranoia in ihre Haut gekratzt haben. Es gibt einen Mann, der unaufhörlich auf sich einschlägt, um imaginäre Insekten loszuwerden.
Nicht, dass es uns an echtem Befall in Downtown Eastside mangelt. Nager gedeihen hinter den Wänden der Gebäude und in den mit Müll übersäten Hinterhöfen. Ungeziefer bevölkert die Betten, Kleider und Körper vieler meiner Patienten: Bettwanzen, Läuse, Krätze. In meiner Praxis fallen gelegentlich Kakerlaken aus ausgeschüttelten Röcken und Hosenbeinen heraus und huschen unter meinem Schreibtisch in Deckung. „Ich habe gerne ein oder zwei Mäuse um mich herum“, erzählte mir ein junger Mann. „Sie fressen die Kakerlaken und Bettwanzen. Aber ich ertrage kein ganzes Mäusenest in meiner Matratze.“
Ungeziefer, Geschwüre, Blut und Tod: die Plagen Ägyptens.
In Downtown Eastside tötet der Todesengel mit schockierendem Eifer. Marcia, eine fünfunddreißigjährige Heroinsüchtige, war aus ihrer PHS-Wohnung ausgezogen und wohnte in einem Mietshaus einen halben Block entfernt. Eines Morgens erhielt ich einen verzweifelten Anruf wegen einer vermuteten Überdosis. Ich fand Marcia im Bett, die Augen weit aufgerissen, auf dem Rücken liegend und bereits in Totenstarre. Ihre Arme waren ausgestreckt, die Handflächen nach außen gerichtet, eine Geste des angstvollen Protestes, als wollte sie sagen: „Nein, du bist zu früh gekommen, um mich zu holen, viel zu früh!“ Plastikspritzen zerbrachen unter meinen Schuhen, als ich mich ihrem Körper näherte. Marcias geweitete Pupillen und einige andere körperliche Anzeichen erzählten ihre Geschichte – sie starb nicht an einer Überdosis, sondern an Heroinentzug. Ich stand für einige Augenblicke an ihrem Bett und versuchte, in ihrem Körper den charmanten, wenn auch immer geistesabwesenden Menschen zu sehen, den ich gekannt hatte. Als ich mich abwandte, um zu gehen, kündigten heulende Sirenen die Ankunft der Rettungsfahrzeuge vor dem Haus an.
Marcia war erst eine Woche zuvor gut gelaunt in meiner Praxis gewesen und hatte mich um Hilfe bei einigen medizinischen Formularen gebeten, die sie ausfüllen musste, um wieder Sozialhilfe zu erhalten. Es war das erste Mal seit sechs Monaten, dass sie zu mir gekommen war. In dieser Zeit, so erzählte sie mir in lässiger Resignation, hatte sie ihrem Freund Kyle dabei geholfen, eine Hundertdreißigtausend-Dollar-Erbschaft durchzubringen – eine Aktion, bei der ihnen viele andere befreundete Drogensüchtige und Mitläufer selbstlos geholfen hatten. Trotz all dieser Popularität war sie allein, als der Tod sie erwischte.
Ein weiteres Opfer war Frank, ein zurückgezogener Heroinsüchtiger, der einen nur dann widerwillig in sein beengtes Quartier im Regal Hotel ließ, wenn er sehr krank war. „Ich werde auf keinen Fall im Krankenhaus sterben“, erklärte er, als klar wurde, dass der Sensenmann AIDS an seine Tür geklopft hatte. Darüber oder über etwas anderes konnte man nicht mit Frank diskutieren. 2002 starb er in seinem eigenen zerlumpten Bett, aber es war sein eigenes Bett.
Frank war eine gute Seele, was seine griesgrämige Schroffheit nicht verbergen konnte. Obwohl er nie mit mir über seine Lebenserfahrung sprach, drückte er das Wesentliche davon in dem Gedicht Der Höllenzug der Stadt aus, das er einige Monate vor seinem Tod schrieb. Es ist ein Requiem für ihn selbst und für Dutzende von Frauen – drogensüchtige Prostituierte –, die mutmaßlich auf der berüchtigten Pickton-Schweinefarm außerhalb von Vancouver ermordet worden sind.
Ich ging in die Stadt – nach Hastings und Main
Auf der Suche nach Linderung meiner Schmerzen
Alles, was ich gefunden habe, war
Eine Fahrkarte für eine einfache Fahrt in einem Höllenzug
Auf einem Bauernhof nicht weit entfernt
Wurden mehrere Freundinnen entführt
Mögen sich ihre Seelen von den Schmerzen erholen
Möge ihre Fahrt mit dem Höllenzug enden
Gib mir Frieden, bevor ich sterbe
Die Strecke ist so gut ausgebaut
Wir alle erleben unsere private Hölle
Nur noch mehr Fahrkarten für den Höllenzug
Höllenzug
Höllenzug
Einfache Fahrkarte für einen Höllenzug
Da ich in der Palliativmedizin, der Betreuung von unheilbar Kranken, gearbeitet habe, bin ich dem Tod oft begegnet. Streng genommen ist die Suchtmedizin bei dieser Bevölkerungsgruppe ebenfalls Palliativarbeit. Wir erwarten nicht, jemanden zu heilen, sondern nur, die Auswirkungen der Drogenabhängigkeit und der damit verbundenen Leiden zu lindern sowie die Auswirkungen der rechtlichen und sozialen Qualen abzumildern, mit denen unsere Gesellschaft den Drogensüchtigen bestraft. Abgesehen von den seltenen Glücklichen, die dem Drogen-Slum von Downtown Eastside entkommen, erleben nur sehr wenige meiner Patienten ein hohes Alter. Sie sterben an einer Komplikation ihrer HIV-Infektion oder Hepatitis C, an Meningitis oder einer massiven Sepsis, die sie sich durch mehrfache Selbstinjektionen während ihres anhaltenden Kokainkonsums zuziehen. Einige erliegen bereits in relativ jungen Jahren einer Krebserkrankung, da ihr gestresstes und geschwächtes Immunsystem nicht in der Lage ist, den bösartigen Tumor unter Kontrolle zu halten. So ist Stevie gestorben, an Leberkrebs, mit dem gutmütig-spöttischen Ausdruck, der immer auf ihrem Gesicht lag, das von tiefer Gelbsucht gezeichnet war. Oder sie erwischen eines Nachts schlechten Stoff und sterben an einer Überdosis, wie Angel im Sunrise Hotel oder wie Trevor, ein Stockwerk höher, der immer lächelte, als ob ihn nie etwas gestört hätte.
An einem Februarabend, es dämmerte bereits, erwachte Leona, eine Patientin, die in einem nahe gelegenen Hotel wohnte, auf der Liege in ihrem Zimmer und fand ihren achtzehnjährigen Sohn Joey leblos und starr in ihrem Bett liegen. Sie hatte ihn von der Straße geholt und Wache gehalten, um ihn vor Selbstverletzung zu schützen. Nach der durchwachten Nacht war sie am nächsten Vormittag eingeschlafen. Am Nachmittag hatte Joey eine Überdosis genommen. „Als ich aufwachte“, erinnert sie sich, „lag Joey regungslos da. Niemand musste mir etwas erklären. Der Krankenwagen und die Feuerwehr kamen, aber es gab nichts, was sie hätten tun können. Mein Baby war tot.“ Ihre Trauer ist riesig, ihr Schuldgefühl unermesslich.
Der Schmerz ist eine Konstante in der Portland-Klinik. Die medizinische Fakultät unterrichtet die drei Kennzeichen einer Entzündung mit den lateinischen Bezeichnungen: calor, rubror, dolor – Hitze, Rötung und Schmerz. Die Haut, Gliedmaßen oder Organe meiner Patienten sind oft entzündet und dagegen kann meine Behandlung zumindest vorübergehend wirksam sein. Aber wie kann man die Seelen trösten, die durch intensive Schmerzen gequält werden, die zuerst durch die Erfahrungen in der Kindheit – fast zu widerlich, um sie zu glauben – und dann, in mechanischer Wiederholung, durch den Leidenden selbst hervorgerufen werden? Und wie kann man sie trösten, wenn ihre Leiden durch die gesellschaftliche Ächtung täglich schlimmer werden – durch das, was der Gelehrte und Schriftsteller Elliot Leyton als „die seelenlosen, rassistischen, sexistischen und klassistischen Vorurteile beschrieben hat, die in der kanadischen Gesellschaft vergraben sind: eine institutionalisierte Verachtung der Armen, Prostituierten, Drogensüchtigen, Alkoholiker und Ureinwohner“.1 Der Schmerz hier in Downtown Eastside bringt Menschen dazu, um Geld für Drogen zu betteln. Er starrt aus kalten und harten Augen oder zeigt sich niedergeschlagen, im Gefühl der Unterlegenheit und Scham. Der Schmerz äußert sich in schmeichelnden Tönen oder aggressivem Geschrei. Hinter jedem Blick, hinter jedem Wort, hinter jeder gewaltsamen Tat oder desillusionierten Geste verbirgt sich eine Geschichte von Leid und Erniedrigung, eine selbst geschriebene Geschichte mit täglich neu hinzugefügten Kapiteln und selten einem glücklichen Ende.
———
Während Daniel mich nach Hause fährt, hören wir im Autoradio CBC und diesen seltsamen Nachmittagsmix aus fröhlichem Geplapper, Klassik und Jazz. Erschüttert von dem Kontrast zwischen der großstädtischen Radiowirklichkeit und der geplagten Welt, die ich gerade verlassen habe, denke ich zurück an meine erste Patientin an diesem Tag.
Madeleine sitzt gekrümmt vor mir, die Ellenbogen auf ihre Oberschenkel gestützt, ihr hagerer, sehniger Körper ist durch heftiges Schluchzen verkrampft. Sie umklammert ihren Kopf mit den Händen, ballt immer wieder die Fäuste und schlägt rhythmisch gegen ihre Schläfen. Ihr glattes, braunes, nach vorne gefallenes Haar verdeckt ihre Augen und Wangen. Ihre Unterlippe ist geschwollen und aufgeplatzt, aus einem kleinen Schnitt sickert Blut. Ihre raue, jungenhafte Stimme ist heiser vor Wut und Schmerz. „Ich bin schon wieder verarscht worden“, weint sie. „Immer bin ich es, die die Scheiße der anderen ausbaden muss. Woher wissen sie, dass sie mir das jedes Mal wieder antun können?“ Sie hustet, als ihr der Speichel in die Luftröhre rinnt. Sie ist wie ein Kind, das seine Geschichte erzählt und um Mitgefühl und Hilfe bittet.
Die Geschichte, die sie erzählt, ist die Variation eines Themas, das in Downtown Eastside bekannt ist: Drogensüchtige, die sich gegenseitig ausbeuten. Drei Frauen, die Madeleine gut kennt, geben ihr einen Hundert-Dollar-Schein. Der Deal ist, dass sie zwölf „Rocks“ Crack von einem Typen kaufen soll, den sie „Spic“ nennt. Einen kann sie behalten, die anderen Frauen werden einen Teil für sich nehmen und den Rest weiterverkaufen. „Die Bullen dürfen nicht sehen, dass wir so viel kaufen“, sagen sie ihr. Die Transaktion ist abgeschlossen, Geld und Crack haben den Besitzer gewechselt. Zehn Minuten später holt der ‚großartige Spic‘ Madeleine ein, „packt mich an den Haaren, wirft mich zu Boden und versetzt mir einen Schlag ins Gesicht“. Der Hundert-Dollar-Schein ist gefälscht. „Sie haben mich reingelegt. ‚Oh, Maddie, du bist mein Kumpel, du bist meine Freundin.‘ Ich hatte keine Ahnung, dass es ein gefälschter Hunderter ist.“