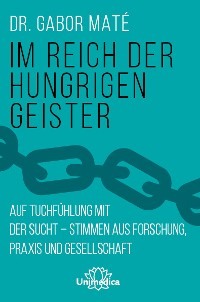Kitabı oku: «Im Reich der hungrigen Geister», sayfa 4
Meine Klienten erzählen oft von „dem Spic“, aber er scheint unsichtbar zu sein, eine mystische Figur, von der ich nur höre. An den Straßenecken in der Nähe des Portland Hotels treffen sich junge, dunkelhäutige Mittelamerikaner mit schwarzen, über die Augen geschobenen Baseballmützen. Wenn ich an ihnen vorbeilaufe, sprechen sie mich im leisen Flüsterton an, selbst wenn ich eindeutig ein Stethoskop um meinen Hals trage: „Upper und Downer“ oder „gute Rocks“. (Upper und Downer ist Junkie-Slang. Upper sind Stimulanzien wie Kokain, und Downer, wie zum Beispiel Heroin, haben eine beruhigende, entspannende Wirkung. Rock steht für Crack/Kokain.) „Hey, siehst du nicht, dass das der Arzt ist?“, zischt gelegentlich jemand. Der Spic könnte durchaus zu dieser Gruppe gehören, aber vielleicht ist der Beiname auch nur ein allgemeiner Begriff, der sich auf jeden von ihnen bezieht.
Ich weiß nicht, wer er ist oder auf welchem Weg er in die heruntergekommene Gegend von Vancouver gelangt ist, wo er die abgemagerten Frauen mit Kokain und Ohrfeigen versorgt, die stehlen, dealen, betrügen oder billigen Oralsex anbieten, um ihn zu bezahlen. Wo wurde er geboren? Durch welchen Krieg und welche Entbehrungen wurden seine Eltern gezwungen, ihren Slum oder ihr Bergdorf zu verlassen, um ein Auskommen so weit nördlich des Äquators zu suchen? Waren es die Armut in Honduras, Milizen in Guatemala oder die Todesschwadronen in El Salvador? Wie wurde er zu dem Latino, dem Bösewicht der Geschichte, die ich von der spindeldürren, verzweifelten Frau in meiner Praxis erzählt bekomme, die tränenerstickt ihre blauen Flecken erklärt und mich bittet, ihr nicht vorzuwerfen, dass sie letzte Woche beim Methadon-Termin nicht erschienen ist. „Ich habe seit sieben Tagen keinen Juice mehr getrunken“, sagt Madeleine. („Juice“ ist Slang für Methadon, denn das Methadonpulver wird in einem Getränk mit Orangengeschmack aufgelöst.) „Und ich werde niemanden auf der Straße um Hilfe bitten, denn wenn sie dir helfen, schuldest du ihnen dein gottverdammtes Leben. Selbst wenn du es ihnen zurückzahlst, denken sie immer noch, dass du ihnen etwas schuldest: ‚Da ist Maddie, die kriegen wir. Sie wird es uns geben.‘ Sie wissen, dass ich nicht kämpfe. Denn wenn ich mich jemals wehren sollte, würde ich eine von diesen Schlampen umbringen. Ich will nicht den Rest meines Lebens im Knast verbringen wegen einer gottverdammten Fotze, mit der ich mich von vornherein nicht hätte einlassen sollen. So wird’s laufen. Ich kann nur ein gewisses Maß ertragen.“
Ich gebe ihr das Methadon-Rezept und biete ihr an, wiederzukommen und zu reden, nachdem sie ihre Dosis in der Apotheke bekommen hat. Obwohl Madeleine einverstanden ist, werde ich sie heute nicht mehr sehen. Wie immer lockt der Drang nach dem nächsten Schuss.
Ein anderer Besucher an diesem Morgen war Stan, ein fünfundvierzigjähriger Ureinwohner, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden war und ebenfalls wegen seines Methadon-Rezeptes kam. In den achtzehn Monaten seiner Inhaftierung war er etwas pummelig geworden, was seine bisher bedrohliche Wirkung aufgrund seiner Größe, muskulösen Statur, glühenden dunklen Augen, seines Apachenhaars und seines Fu-Manchu-Schnurrbarts dämpfte. Vielleicht ist er auch milder geworden, da er die ganze Zeit ohne Kokain war. Er schaut aus dem Fenster zum Bürgersteig auf der anderen Straßenseite, wo einige seiner Mitsüchtigen in eine Szene vor dem Armee-Shop verwickelt sind. Es wird viel gestikuliert und scheinbar ziellos hin- und hergelaufen. „Schauen Sie sich das an“, sagt er. „Sie sitzen hier fest. Wissen Sie, Doc, ihr Leben erstreckt sich von hier bis vielleicht zum Victory Square auf der linken Seite und der Fraser Street auf der rechten. Die kommen hier nie raus. Ich will wegziehen, will mein Leben hier nicht mehr vergeuden.“
„Ach, was soll’s. Schauen Sie mich an, ich habe nicht einmal Strümpfe.“ Stan zeigt auf seine abgelaufenen Schuhe und seine abgewetzte rote Jogginghose mit Gummibündchen ein paar Zentimeter über seinen Knöcheln. „Wenn ich in diesem Outfit in den Bus steige, wissen die Leute sofort Bescheid. Sie wenden sich von mir ab. Einige starren mich an, die meisten schauen nicht einmal in meine Richtung. Wissen Sie, wie sich das anfühlt? Als wäre ich ein Alien. Ich fühle mich erst dann wieder wohl, wenn ich hier zurück bin; kein Wunder, dass niemand jemals geht.“
Als er zehn Tage später wegen eines Methadon-Rezepts zurückkehrt, lebt Stan immer noch auf der Straße. Es ist ein Märztag in Vancouver: grau, nass und ungewöhnlich kalt. „Sie wollen nicht wissen, wo ich letzte Nacht geschlafen habe, Doc“, sagt er.
Für viele der chronischen, hartgesottenen Süchtigen in Vancouver ist es so, als ob ein unsichtbarer Stacheldraht das Gebiet umgibt, das sich ein paar Blocks von Main und Hastings aus in alle Richtungen erstreckt. Es gibt eine Welt jenseits davon, aber für sie ist sie größtenteils unerreichbar. Diese Welt hat Angst vor ihnen und lehnt sie ab, und sie wiederum verstehen deren Regeln nicht und können dort nicht überleben.
Es erinnert mich an einen Gefangenen, der aus einem sowjetischen Gulag geflohen war, und sich, nachdem er draußen fast verhungert war, freiwillig wieder inhaftieren ließ. „Die Freiheit ist nichts für uns“, sagte er seinen Mitgefangenen. „Wir sind für den Rest unseres Lebens an diesen Ort gekettet, auch wenn wir keine Ketten tragen. Wir können fliehen, wir können umherziehen, aber am Ende werden wir zurückkommen.“
———
Menschen wie Stan gehören zu der kränksten, bedürftigsten und am meisten vernachlässigten Bevölkerungsgruppe überhaupt. Ihr ganzes Leben lang wurden sie ignoriert, im Stich gelassen und haben sich ihrerseits immer wieder selbst aufgegeben. Wie entsteht die Bereitschaft einer solchen Gruppe zu helfen? In meinem Fall weiß ich, dass die Wurzeln dazu in meinen Anfängen als jüdisches Kleinkind im 1944 von den Nazis besetzten Budapest liegen. Ich bin mit dem Bewusstsein aufgewachsen, wie schrecklich und schwierig das Leben für manche Menschen sein kann – ohne dass sie etwas dafür können.
Aber ebenso, wie sich das Einfühlungsvermögen, das ich für meine Patienten empfinde, auf meine Kindheit zurückführen lässt, so gilt dies auch für die intensiven Gefühle der Verachtung, Geringschätzung und Verurteilung, die manchmal aus mir herausbrechen und oft gegen dieselben schmerzgetriebenen Menschen gerichtet sind. Später werde ich darauf eingehen, wie meine eigenen Suchttendenzen auf meine frühkindlichen Erfahrungen zurückzuführen sind. Im Grunde genommen unterscheide ich mich gar nicht so sehr von meinen Patienten – und manchmal kann ich es kaum ertragen zu sehen, wie wenig psychologische Distanz, wie wenig vom Himmel geschenkte Gnade mich von ihnen trennt.
Meine erste Vollzeitstelle als Arzt hatte ich in einer Klinik in Downtown Eastside. Es war eine kurze, sechsmonatige Anstellung, aber sie hat ihre Spuren hinterlassen, und ich wusste, dass ich eines Tages zurückkommen würde. Als mir zwanzig Jahre später angeboten wurde, Klinikarzt im alten Portland zu werden, ergriff ich die Gelegenheit, weil es sich richtig anfühlte: genau die Kombination aus Herausforderung und Sinngebung, die ich zu dieser Zeit in meinem Leben suchte. Ohne groß nachzudenken, verließ ich meine Hausarztpraxis und wechselte in ein von Kakerlaken verseuchtes Hotel im Stadtzentrum.
Was zieht mich hierher? Alle, die wir zu dieser Arbeit berufen sind, reagieren auf eine innere Anziehungskraft, die mit denselben Frequenzen schwingt, die auch im Leben der geplagten, ausgelaugten, dysfunktionalen Menschen in unserer Obhut vibrieren. Aber natürlich kehren wir täglich nach Hause zurück, zu unseren anderen Interessen und Beziehungen, während unsere süchtigen Klienten in ihrem städtischen Gulag gefangen sind.
Manche Menschen fühlen sich zu schmerzvollen Orten hingezogen, weil sie hoffen, dort ihren eigenen Schmerz zu lindern. Andere melden sich freiwillig, weil ihr mitfühlendes Herz weiß, dass ihre Liebe hier am meisten gebraucht wird. Wieder andere kommen aus beruflichem Interesse: Diese Arbeit ist eine ständige Herausforderung. Menschen mit geringem Selbstwertgefühl fühlen sich vielleicht angezogen, weil es ihr Ego nährt, mit solch hilflosen Menschen zu arbeiten. Einige werden von der magnetischen Kraft der Süchte angezogen, weil sie ihre eigenen Suchttendenzen noch nicht gelöst oder gar erkannt haben. Ich vermute, dass die meisten von uns Ärzten, Krankenschwestern und anderen professionellen Helfern, die in Downtown Eastside arbeiten, von einer Mischung dieser Motive angetrieben werden.
Liz Evans begann im Alter von sechsundzwanzig Jahren in dieser Gegend zu arbeiten. „Ich war überwältigt“, erinnert sie sich. „Als Krankenschwester dachte ich, ich hätte etwas Fachwissen weiterzugeben. Das stimmte zwar, aber ich stellte bald fest, dass ich in Wirklichkeit sehr wenig zu geben hatte – ich konnte die Menschen nicht von ihrem Schmerz und ihrer Traurigkeit erlösen. Alles, was ich anbieten konnte, war, ihnen als Mitmensch, als verwandte Seele, zur Seite zu stehen.“
„Eine Frau, die ich Julie nenne, wurde ab ihrem siebten Lebensjahr von ihrer Pflegefamilie in ihrem Zimmer eingesperrt, mit einer Flüssignahrung zwangsernährt und geschlagen – sie hat eine Narbe am Hals, wo sie sich selbst aufgeschlitzt hat, als sie gerade mal sechzehn war. Seitdem konsumiert sie einen Cocktail aus Schmerzmitteln, Alkohol, Kokain und Heroin und arbeitet als Prostituierte. Eines Abends kam sie zurück, nachdem sie vergewaltigt worden war, und kroch schluchzend auf meinen Schoß. Sie sagte mir wiederholt, dass es ihre Schuld sei, dass sie ein schlechter Mensch sei und nichts Gutes verdient habe. Sie konnte kaum atmen. Ich sehnte mich danach, ihr etwas zu geben, was ihren Schmerz lindern würde, während ich dasaß und sie in meinen Armen hielt. Es war zu intensiv, um es ertragen zu können.“ Denn Liz stellte fest, dass etwas in Julies Schmerz ihren eigenen auslöste. „Diese Erfahrung machte mir deutlich, dass wir verhindern müssen, dass uns unsere eigenen Probleme im Wege stehen.“
„Was hält mich hier?“, sinniert Kerstin Stuerzbecher. „Anfangs wollte ich helfen. Und jetzt … Ich will immer noch helfen, aber es hat sich geändert. Nun kenne ich meine Grenzen. Ich weiß, was ich tun kann und was nicht. Was ich tun kann, ist, hier zu sein und mich für Menschen in verschiedenen Lebensphasen einzusetzen und ihnen zu erlauben, so zu sein, wie sie sind. Wir haben als Gesellschaft die Pflicht, … die Menschen so zu unterstützen, wie sie sind, und ihnen Respekt entgegenzubringen. Das ist es, was mich hier hält.“
Es gibt noch einen weiteren Faktor in der Gleichung. Viele Menschen, die in Downtown Eastside gearbeitet haben, haben es bemerkt: ein Gefühl der Authentizität, der Wegfall der üblichen sozialen Spiele, der Verzicht auf die Heuchelei – die Realität von Menschen, die nicht so tun können, als wären sie etwas anderes als das, was sie sind.
Natürlich lügen, betrügen und manipulieren sie – aber tun wir das nicht alle, auf unsere eigene Art und Weise? Im Gegensatz zum Rest von uns können sie nicht so tun, als seien sie keine Betrüger und Manipulatoren. Sie sind aufrichtig, wenn es um ihre Weigerung geht, Verantwortung zu übernehmen und den sozialen Erwartungen zu entsprechen, sowie um ihre Akzeptanz, alles um ihrer Sucht willen verloren zu haben. Das ist gemessen an den strengen gesellschaftlichen Maßstäben nicht viel, aber man findet paradoxerweise in jedem Betrug, der mit der Sucht zwangsweise einhergeht, einen ehrlichen Kern. „Was erwarten Sie, Doc? Schließlich bin ich ein Süchtiger“, sagte mir einmal ein kleiner, dünner siebenundvierzigjähriger Mann mit einem schiefen und entwaffnenden Lächeln, nachdem es ihm nicht gelungen war, mich zu einem Morphium-Rezept zu überreden. Vielleicht liegt in dieser Art von unverschämter, unentschuldbarer Pseudo-Authentizität eine gewisse Faszination. Wer von uns würde in seinen geheimen Fantasien nicht gerne ebenso leichtfertig und dreist mit seinen Schwächen umgehen?
„Bei uns hier geht man ehrlich mit den Menschen um“, sagt Kim Markel. Sie ist Krankenschwester an der Portland-Klinik. „Ich kann hierherkommen und kann wirklich so sein, wie ich bin. Ich finde das lohnend. Bei der Arbeit in den Krankenhäusern oder den verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde gibt es immer den Druck, sich an die Regeln zu halten. Weil unsere Arbeit hier so vielfältig ist und mit Menschen zu tun hat, deren Bedürfnisse so grundlegend sind und die nichts mehr zu verbergen haben, hilft es mir, bei meiner Arbeit authentisch zu sein. Es gibt keinen so großen Unterschied zwischen dem, was ich bei der Arbeit, und dem, was ich außerhalb der Arbeit bin.“
Inmitten der Ruhelosigkeit reizbarer Drogensüchtiger, die für ihr nächstes Hochgefühl lügen und betrügen, gibt es auch häufig Momente der Menschlichkeit und der gegenseitigen Unterstützung. „Es gibt immer wieder erstaunliche Momente der Wärme“, sagt Kim. „Obwohl es eine Menge Gewalt gibt, sehe ich viele Menschen, die sich umeinander kümmern“, fügt Bethany Jeal hinzu, eine Krankenschwester von Insite, dem ersten betreuten Drogenkonsumraum Nordamerikas, der sich in Hastings, zwei Blocks vom Portland entfernt, befindet. „Sie teilen sich Essen, Kleidung und Make-up – alles, was sie haben.“ Die Menschen kümmern sich, wenn jemand krank ist, sie berichten mit Besorgnis und Mitgefühl über den Zustand eines Freundes und sind oft anderen gegenüber freundlicher als normalerweise sich selbst gegenüber.
„Da, wo ich wohne“, erzählt Kerstin, „kenne ich die Person, die zwei Häuser weiter wohnt, nicht. Ich weiß vielleicht vage, wie sie aussieht, aber ihren Namen kenne ich ganz sicher nicht. Hier ist es anders. Hier kennt man sich, und das hat seine Vor- und Nachteile. Es bedeutet, dass die Menschen aufeinander schimpfen und wütend sind, und es bedeutet auch, dass die Menschen ihre letzten fünf Pennys miteinander teilen.“
„Die Menschen hier sind sehr roh, was sich in Gewalt und Hässlichkeit ausdrückt und auch oft in den Medien hervorgehoben wird. Aber diese Rohheit bringt auch unverfälschte Gefühle der Freude und Freudentränen hervor – wenn jemand eine Blume sieht, die mir nicht aufgefallen ist, aber jemandem, der in einem Einzelzimmer im Washington Hotel lebt und jeden Tag hier unterwegs ist. Das ist seine Welt, und er achtet auf andere Details als ich …“
Auch der Humor kommt nicht zu kurz. Wenn ich meine Hastings-Runden von einem Hotel zum anderen mache, werde ich Zeuge von viel Schulterklopfen und lautstarkem Gelächter. „Doctor, doctor, gimme the news“, ertönt ein jazziger Singsang unter dem Torbogen des Washington. „Hey, you need a shot of rhythm an’ blues“, singe ich über die Schulter zurück. Kein Grund, mich umzudrehen. Mein Partner in diesem gut einstudierten musikalischen Ritual ist Wayne, ein sonnenverbrannter Mann mit langen, schmutzigen blonden Locken und Schwarzenegger-Armen, die vom Handgelenk bis zum Bizeps tätowiert sind.
Ich warte darauf, eine Kreuzung mit Laura zu überqueren, einer Ureinwohnerin in den Vierzigern, deren beängstigende Lebensgeschichte, Drogenabhängigkeit, Alkoholismus und HIV ihren schelmischen Witz nicht ausgelöscht haben. Als die rote Hand an der Fußgängerampel blinkt und der kleinen gehenden Figur weicht, ertönt Lauras leicht spöttische Stimme: „Weißer Mann sagt: Los.“ Wir haben noch ein paar Häuserblöcke entlang den gleichen Weg und die ganze Zeit kichert Laura laut über ihren Witz. Mir geht es ebenso.
Die Witze sind oft herzhaft selbstverspottend. „Früher schaffte ich beim Bankdrücken neunzig Kilo, Doc“, sagt Tony, abgemagert, geschrumpft und durch AIDS bereits vom Tod gezeichnet, bei einem seiner letzten Praxisbesuche. „Jetzt kriege ich nicht mal mehr meinen eigenen Schwanz hoch.“
Wenn mich meine süchtigen Patienten anschauen, suchen sie nach meinem wahren Ich. Wie Kinder sind sie unbeeindruckt von Titeln, Errungenschaften und weltlichen Referenzen. Ihre Sorgen sind zu unmittelbar, zu dringlich. Wenn sie anfangen, mich zu mögen oder meine Arbeit mit ihnen zu schätzen, zeigen sie spontan ihren Stolz darüber, einen Arzt zu haben, der gelegentlich im Fernsehen interviewt wird und Bücher schreibt. Aber nur dann. Was sie interessiert, ist meine Präsenz oder Abwesenheit als Mensch. Sie prüfen mit untrüglichem Auge, ob ich an jedem beliebigen Tag genug geerdet bin, um zu ihnen zu kommen und ihnen als Menschen zuzuhören, deren Gefühle, Hoffnungen und Bestrebungen ebenso berechtigt sind wie meine. Sie erkennen sofort, ob ich mich wirklich für ihr Wohlergehen einsetze oder nur versuche, sie mir vom Hals zu schaffen. Da sie durchgehend nicht in der Lage sind, sich selbst eine solche Fürsorge zu bieten, nehmen sie umso sensibler wahr, ob sie bei denjenigen vorhanden ist, die sich um sie kümmern sollen.
Es ist belebend, in einer Atmosphäre zu arbeiten, die so weit vom normalen Arbeitsalltag entfernt ist, in einer Atmosphäre, die auf Authentizität besteht. Ob es uns bewusst ist oder nicht, die meisten von uns sehnen sich nach Authentizität, nach einer Realität jenseits von Rollenbildern, Etiketten und sorgfältig gefeilten Persönlichkeiten. Mit all seinen schwärenden Problemen, Funktionsstörungen, Krankheiten und Verbrechen bietet das Downtown Eastside die frische Luft der Wahrheit, auch wenn es sich um die entblößte, ausgefranste Wahrheit der Verzweiflung handelt. Sie hält einen Spiegel hoch, in dem wir alle, als einzelne Menschen und insgesamt als Gesellschaft, uns selbst erkennen können. Die Angst, der Schmerz und die Sehnsucht, die wir sehen, sind unsere eigene Angst, unser eigener Schmerz und unsere eigene Sehnsucht. Auch uns gelten die Schönheit und das Mitgefühl, das wir hier erleben, ebenso wie der Mut und die große Entschlossenheit, das Leiden zu überwinden.
* Wie Vancouver international oft beschrieben wird, zuletzt in der New York Times vom 8. Juli 2007.
KAPITEL 2
Die tödliche Macht der Drogen
Nichts offenbart die Auswirkungen eines traurigen Lebens so anschaulich wie der menschliche Körper.
NAGIB MACHFUS
Palast der Sehnsucht
In einer Friedhofskapelle in East Hastings verkündet ein älterer Priester hinter seinem Rednerpult den Abschied der Welt von Sharon. „Wie ausgelassen und fröhlich sie war. ‚Hier bin ich, Sha-na-na!‘, rief sie immer, wenn sie in einen Raum platzte. Wer hat sich bei ihrem Anblick nicht gefreut, am Leben zu sein?“
Hinter der Familie verteilen sich die Trauernden in der spärlich gefüllten Kapelle. Eine Gruppe von Mitarbeitern aus dem Portland ist anwesend, zusammen mit fünf oder sechs Bewohnern und einigen wenigen Leuten, die ich nicht erkenne.
Die junge Sharon, so sagte man mir, war früher bildschön. Spuren dieser Schönheit waren noch vorhanden, als ich sie vor sechs Jahren kennenlernte, Spuren, die durch ihren zunehmend blasseren Teint, die eingefallenen Wangen und die verfaulenden Zähne allmählich verschwanden. In ihren letzten Jahren hatte Sharon oft Schmerzen. An ihrem linken Schienbein hatte sie durch injektionsbedingte bakterielle Infektionen zwei große offene Wunden. Wiederkehrende Infektionen führten dazu, dass sich mehrmalige Hauttransplantationen ablösten und das Fleisch ständig frei lag. Die entnervten plastischen Chirurgen im St. Paul’s Hospital hielten weitere Eingriffe für sinnlos. In ihrem chronisch geschwollenen linken Knie plagte sie ein Knochenabszess, der ab und zu aufflammte und dann wieder abklang. Diese Osteomyelitis wurde nie vollständig behandelt, weil Sharon nicht in der Lage war, die sechs bis acht Wochen Krankenhausaufenthalt durchzustehen, die erforderlich sind, um die intravenöse Antibiotika-Behandlung durchzuführen – auch dann nicht, als klar wurde, dass eine Amputation die einzige Alternative sein könnte. Da sie wegen ihres entzündeten Kniegelenks nicht belastbar war, wurde Sharon mit Anfang dreißig Gefangene eines Rollstuhls. Sie rollte ihn mit erstaunlicher Geschwindigkeit über den Gehweg von Hastings, wobei sie ihre starken Arme und ihr rechtes Bein einsetzte, um sich selbst vorwärts zu bringen.
Der Priester vermeidet es taktvoll, das Bild der schmerzgeplagten Sharon heraufzubeschwören, deren Drogensucht sie zurück nach Downtown Eastside trieb, ehrt aber ihr lebendiges Wesen.
„Vergib uns, Herr, denn wir wissen nicht, es wertzuschätzen … Das Leben ist ewig, die Liebe ist unsterblich … Für jede Freude, die vergeht, wird etwas Schönes geschaffen …“, intoniert der Priester. Zuerst höre ich nur eine Litanei von Begräbnisfloskeln und bin verärgert. Doch schon bald fühle ich mich getröstet. Angesichts des vorzeitigen Todes, so wird mir bewusst, gibt es keine Klischees. „Für immer Sharon, diese Stimme, dieses Wesen … ruhe in Frieden und in alle Ewigkeit …“
Das leise Schluchzen der Frauen tönt als Kontrapunkt zu den tröstenden Worten des Priesters. Als er das Buch am Rednerpult schließt, schaut er feierlich durch den Raum. Er verlässt das Podium und Musik ertönt: Andrea Bocelli singt eine gefühlvolle italienische Arie. Die Trauernden sind eingeladen, Sharon, die in einem offenen Sarg unterhalb des Rednerpultes liegt, die letzte Ehre zu erweisen. Einer nach dem anderen gehen sie hin, neigen den Kopf und kehren um, um der Familie ihr Beileid auszusprechen. Beverly nähert sich dem Sarg. Ihr Gesicht ist von den Kokain-Injektionen entstellt. Sie stützt Penny, die über ihre Gehhilfe gebeugt ist. Die beiden waren enge Freundinnen von Sharon. Tom, dessen heiseres, alkoholgeschwängertes abendliches Gebrüll normalerweise Hastings durchdröhnt, hat sich schick gemacht. Stocknüchtern und düster, mit weißem Hemd und Krawatte, verneigt er sich in stillem Gebet vor dem blumengeschmückten Sarg und bekreuzigt sich.
Sharons weiß geschminktes Gesicht trägt einen naiven, unsicheren Ausdruck, ihr rot geschminkter Mund ist geschlossen und leicht schief. Mir scheint, dass dieser leicht verwirrte, kindliche Ausdruck die Innenwelt der lebenden Sharon wahrscheinlich besser widerspiegelt als der raue Charakter, den sie oft in meiner Praxis zur Schau stellte.
An einem Morgen im April wurde Sharon tot in ihrem Bett gefunden. Sie lag auf der Seite, ruhig, als würde sie träumen, ihre Gesichtszüge frei von Schmerz oder Bedrängnis. Über die Todesursache konnten wir nur Vermutungen anstellen, aber eine Überdosis war am wahrscheinlichsten. Trotz ihrer langjährigen HIV-Infektion und ihrer geringen Immunität war sie nicht krank gewesen, aber wir wussten, dass sie, seit sie die Rehaklinik verlassen hatte, stark Heroin konsumierte. In ihrem Zimmer gab es keine Drogenutensilien. Anscheinend hatte sie sich das, was sie getötet hatte, in einer Nachbarwohnung gespritzt, bevor sie in ihre eigene zurückgekehrt war. Der gescheiterte Rehabilitationsversuch machte alle traurig, die sich um sie gekümmert hatten. Nach allem, was man hört, schien es ihr gut zu gehen. „Weitere vier Wochen ohne Injektion, Maté“, berichtete sie stolz bei einem ihrer monatlichen Telefonate. „Schicken Sie mir bitte mein Methadon-Rezept?! Ich will es nicht abholen, sonst werde ich wieder in den Drogenkonsum gezogen.“ Die Mitarbeiter, die sie in der Rehaklinik besuchten, berichteten, dass sie lebhaft war, eine gute Gesichtsfarbe hatte und fröhlich und optimistisch wirkte. Trotz ihres Heroin-Rückfalls war ihr Tod ein Schock, und selbst jetzt, wo ihr Körper in der Kapelle aufgebahrt ist, ist er schwer zu akzeptieren. Ihre Lebendigkeit, Heiterkeit und unbändige Energie waren so sehr Teil unseres Lebens gewesen. Nach den freundlichen und feierlichen Worten des Priesters hätte Sharon aufstehen und mit uns anderen hinausgehen sollen.
Nach dem Gottesdienst mischen sich die Trauernden noch eine Weile auf dem Parkplatz, bevor sie ihre getrennten Wege gehen. Es ist ein heller, strahlender Tag, zum ersten Mal in diesem Jahr zeigt die Frühlingssonne ihr Gesicht am Himmel von Vancouver. Ich begrüße Gail, eine Ureinwohnerin, die sich tapfer dem Ende ihres dritten Monats ohne Kokain nähert. „Siebenundachtzig Tage“, strahlt sie mich an. „Ich kann es nicht glauben.“ Es ist nicht nur eine Übung in Willenskraft. Gail wurde vor zwei Jahren wegen einer heftigen Unterleibsinfektion ins Krankenhaus eingeliefert und bekam einen künstlichen Darmausgang, damit sich ihre entzündeten Eingeweide erholen konnten. Die durchtrennten Darmabschnitte hätten schon längst wieder operativ zusammengefügt werden müssen, aber der Eingriff wurde immer wieder abgesagt, weil Gails intravenöser Kokainkonsum die Heilungschancen gefährdete. Der ursprüngliche Chirurg hatte es abgelehnt, noch einmal einen Termin mit ihr zu machen. „Ich habe den OP-Saal mindestens dreimal umsonst gebucht“, sagte er mir. „Ich werde es nicht noch einmal machen.“ Ich konnte seiner Logik nicht widersprechen. Ein anderer Spezialist erklärte sich widerwillig bereit, mit der Behandlung fortzufahren, aber nur unter der strengen Bedingung, dass Gail vom Kokain fernbleibt. Wenn sie diese letzte Gelegenheit verpasst, kann sie für den Rest ihres Lebens ihren Kot in den Plastikbehälter entleeren, der an ihren Bauch geklebt ist. Sie hasst es, den Beutel wechseln zu müssen, manchmal mehrmals am Tag.
„Alles klar, Doc?“, begrüßt mich der stets gut gelaunte Tom und knetet mir leicht die Schulter. „Schön Sie zu sehen. Sie sind ein guter Mann.“ „Danke“, sage ich. „Sie auch.“ Die magere Penny, die immer noch von ihrer kräftigen Freundin Beverly gestützt wird, schlurft davon. Sie stützt sich mit der rechten Hand auf ihre Gehhilfe und schattet mit der linken Hand ihre Augen gegen die Mittagssonne ab. Penny hat erst vor Kurzem eine sechsmonatige intravenöse Antibiotika-Kur gegen eine Wirbelsäuleninfektion abgeschlossen, die sie bucklig und wackelig auf den Beinen werden ließ. „Ich hätte nie erwartet, dass Sharon vor mir stirbt“, sagt sie. „Letzten Sommer im Krankenhaus dachte ich wirklich, ich wäre erledigt.“ „Du warst kurz davor, selbst mich zu erschrecken“, antworte ich. Wir lachen beide.
Ich blicke auf diese kleine Gruppe von Menschen, die sich zur Beerdigung einer Gefährtin, die mit Mitte dreißig den Tod fand, versammelt hatte. Wie stark ist die Sucht, denke ich, dass weder körperliche Erkrankungen und Schmerzen, noch psychische Qualen den tödlichen Einfluss auf die Seelen abschütteln können. „Wenn man 1944 in den Arbeitslagern der Nazis einen Mann beim Rauchen einer Zigarette erwischte, starb die ganze Baracke“, sagte mir ein Patient namens Ralph einmal. „Für eine Zigarette! Trotzdem gaben die Männer ihre Inspiration, ihren Lebenswillen und ihren Lebensgenuss nicht auf, den sie durch bestimmte Substanzen wie Schnaps oder Tabak oder was auch immer vom Leben bekamen.“ Ich weiß nicht, wie historisch genau seine Schilderung war, aber als Chronist seiner eigenen Drogenbedürfnisse und der seiner Mitsüchtigen aus der Hastings Street sprach Ralph die nackte Wahrheit: Menschen setzen ihr Leben aufs Spiel für einen lebenswerten Augenblick. Nichts bringt sie von der Gewohnheit ab – nicht Krankheit, nicht das Opfer von Liebe und Beziehungen, nicht der Verlust aller irdischen Güter, nicht der Zusammenbruch ihrer Würde, nicht die Angst vor dem Sterben. So unerbittlich ist die Sucht.
Wie kann man die tödliche Macht der Drogenabhängigkeit verstehen? Warum spritzt Penny sich weiterhin Drogen, nachdem die Wirbelsäuleninfektion sie fast querschnittsgelähmt hat werden lassen? Warum kann Beverly trotz ihrer HIV-Infektion, der wiederkehrenden Abszesse, die ich an ihrem Körper drainieren musste, und der Gelenkinfektionen, die sie immer wieder ins Krankenhaus brachten, nicht aufhören, Kokain zu spritzen? Was hat Sharon wohl nach ihrem sechsmonatigen Rückzug wieder nach Downtown Eastside und zu ihrer selbstmörderischen Sucht gezogen? Wie konnte sie die abschreckende Wirkung von HIV und Hepatitis, von der lähmenden Knocheninfektion und den chronisch brennenden, stechenden Schmerz freiliegender Nervenenden ignorieren?
Wie wunderbar wäre die Welt, wenn die vereinfachende Sichtweise zuträfe, dass negative Konsequenzen allein reichen, um Menschen eine harte Lektion zu erteilen. Dann wären alle Fast-Food-Franchise-Unternehmen Eintrittskarten für den Bankrott, die Fernsehzimmer wären verwaiste Räume in unseren Häusern und das Portland Hotel könnte sich als etwas Lukrativeres neu erfinden: vielleicht als Komplex mit Luxuswohnungen mit mediterranem Anspruch für Yuppies aus der Stadt, ähnlich wie die bereits verkauften Eigentumswohnungen „Firenze“ und „España“ um die Ecke, die noch im Bau sind.
———
Auf der physiologischen Ebene ist Drogenabhängigkeit eine Sache der neurochemischen Vorgänge, die unter dem Einfluss einer Substanz schieflaufen, und zwar, wie wir sehen werden, noch bevor der Konsum von bewusstseinsverändernden Substanzen beginnt. Aber wir können den Menschen nicht auf seine neurochemischen Vorgänge reduzieren; und selbst wenn wir es könnten, entwickelt sich die Gehirnphysiologie des Menschen nicht getrennt von seinen Lebensereignissen und seinen Emotionen. Das spüren die Süchtigen. So einfach es auch wäre, die Verantwortung für ihre selbstzerstörerischen Gewohnheiten einem chemischen Phänomen zuzuschreiben, es tun dies nur wenige. Nicht viele akzeptieren die eng gefasste medizinische Betrachtung der Sucht als Krankheit, trotz des tatsächlichen Wertes dieses Modells.
Was ist der in der Tat tödliche Reiz des Drogenkonsums? Das ist eine Frage, die ich vielen meiner Klienten an der Portland-Klinik gestellt habe. „Sie haben dieses elende, geschwollene Bein und diesen Fuß – rot, heiß und schmerzhaft“, sage ich zu Hal, einem freundlichen, lustigen Mann in den Vierzigern, einem meiner wenigen männlichen Patienten ohne Vorstrafen. „Sie müssen sich jeden Tag für die intravenös verabreichten Antibiotika in die Notaufnahme schleppen. Sie haben HIV. Und trotzdem hören Sie nicht auf, weiterhin Speed zu spritzen. Was, glauben Sie, steckt für Sie dahinter?“
„Ich weiß es nicht“, murmelt Hal. Sein zahnloses Zahnfleisch verwischt seine Worte. „Sie fragen jeden … auch mich, warum man seinem Körper etwas verabreicht, das einen fünf Minuten später sabbern und gefühlsduselig werden lässt, Sie wissen schon, etwas, das die Gehirnwellen-Muster so verzerrt, dass man nicht mehr vernünftig denken und sprechen kann – und man es dann grad wieder tun will.“ „Und Ihnen einen Abszess am Bein beschert“, füge ich hilfreich hinzu. „Ja, ein eiterndes Bein. Und warum? Ich weiß es wirklich nicht.“