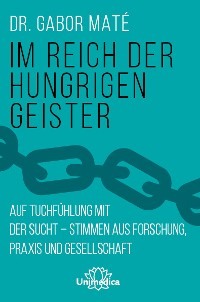Kitabı oku: «Im Reich der hungrigen Geister», sayfa 5
Im März 2005 hatte ich eine ähnliche Diskussion mit Allan, der ebenfalls in seinen Vierzigern war und HIV hatte. Wenige Tage zuvor war er mit heftigen Brustschmerzen ins Krankenhaus von Vancouver eingeliefert worden. Ihm wurde gesagt, dass er wahrscheinlich eine aufflammende Endokarditis, eine Infektion der Herzklappen, habe. Da Allan sich weigerte, stationär aufgenommen zu werden, stellte er sich stattdessen in der Notfallstation von St. Paul’s vor, um eine zweite Meinung einzuholen, wo man ihm versicherte, dass alles in Ordnung sei. Nun war er in meiner Praxis, um sich eine dritte Beurteilung zu holen.
Bei der Untersuchung stelle ich fest, dass er zwar nicht akut krank ist, sich aber dennoch in einem schrecklichen Zustand befindet. „Was soll ich tun, Doc?“, fragt er, hebt die Schultern und breitet die Arme in hilfloser Bestürzung aus. „Okay“, sage ich und sehe mir sein Krankenblatt an. „Ihr Vater starb an einer Herzkrankheit, ebenso Ihr Bruder. Sie sind starker Raucher. In Ihrer Vorgeschichte gab es bereits eine Endokarditis durch intravenösen Drogenkonsum. Ich behandle Sie zwar gegen Herzinsuffizienz, doch selbst jetzt sind Ihre Beine geschwollen, weil Ihr Herz nicht mehr effizient pumpt. Ihre HIV-Infektion wird durch starke Medikamente kontrolliert, und durch Ihre Hepatitis C ist Ihre Leber ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Aber Sie injizieren immer noch. Und nun fragen Sie mich, was Sie tun sollen. Was stimmt an dieser Konstellation nicht?“
„Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden“, antwortet Allan. „Ich brauche es, dass Sie mir sagen, dass ich ein verdammter Vollidiot bin. Nur so kann ich lernen.“
„Okay, das tue ich. Sie sind ein verdammter Vollidiot!“
„Danke, Doc.“
„Das Problem ist, Sie sind kein verdammter Vollidiot, Sie sind süchtig. Und wie sollen wir damit umgehen?“
Allan starb vier Monate später um Mitternacht, er lag kalt und blau auf dem Boden seines Zimmers in einem nahe gelegenen Hotel. Gerüchten zufolge hatte er sich verunreinigtes Methadon gespritzt, das er bei einem Einbruch in einer örtlichen Apotheke gestohlen und anschließend mit Crystal Meth oder wer weiß was gepanscht hatte. Nach Angaben der Gerichtsmedizin hat dieser kleine unabhängige Drogenhandel den Tod von mindestens acht Menschen verursacht.
„Ich habe keine Angst vor dem Sterben“, sagte mir ein Klient. „Manchmal habe ich mehr Angst vor dem Leben.“
Diese Angst vor einem Leben, wie sie es erlebt haben, liegt dem fortgesetzten Drogenkonsum meiner Patienten zugrunde. „Wenn ich high bin, kann mir nichts etwas anhaben. Es gibt keinen Stress in meinem Leben“, sagte mir jemand – eine Empfindung, die von vielen Abhängigen geteilt wird. „Es lässt mich einfach vergessen“, beschreibt Dora, eine eingefleischte Kokainkonsumentin, ihre Motivation. „Ich vergesse meine Probleme. Nichts scheint so schlimm zu sein, wie es tatsächlich ist, bis man am nächsten Morgen aufwacht und es dann noch schlimmer ist …“ Im Sommer 2006 verließ Dora das Portland und zog zurück auf die Straße, auf der Jagd nach Drogen. Im Januar starb sie auf der Intensivstation des St. Paul’s Hospital an mehreren Hirnabszessen.*
Alvin ist in seinen Fünfzigern, ein fülliger, ehemaliger Fernfahrer mit kräftigen Armen. Er nimmt Methadon, um seine Heroinabhängigkeit unter Kontrolle zu halten, und hat in letzter Zeit vermehrt Crystal Meth konsumiert. „Die erste Hälfte des Tages habe ich das Gefühl, ich müsste kotzen“, sagt er, „aber dann, nach acht oder neun Zügen … Ja, wie fühle ich mich dann? Zuallererst wie ein Narr, aber ich weiß nicht, es ist wohl ein Ritual.“
„Ich sage Ihnen, wie ich es sehe“, kontere ich. „Für das Privileg, sich elendig und wie ein Narr zu fühlen, geben Sie monatlich tausend Dollar aus. Ist es das, was Sie mir sagen wollen?“ Alvin lacht. „Aber ich kotze nur am Anfang. Dann habe ich eine Art Hochgefühl, das etwa drei bis fünf Minuten dauert, und danach frage ich mich: Warum habe ich das getan? Aber dann ist es zu spät. Irgendetwas treibt mich dazu, es wieder zu tun, und das ist die Sucht. Und ich weiß nicht, wie ich das in den Griff bekommen soll. Ich schwöre bei Gott, ich hasse den Scheiß, ehrlich, ich hasse den Scheiß.“ „Aber Sie haben trotzdem etwas davon.“ „Nun, ja, sonst würde ich es wahrscheinlich nicht tun – wie bei einem Orgasmus, schätze ich.“
Abgesehen von der unmittelbaren orgasmischen Befreiung des Süchtigen aus der Gegenwart haben Drogen die Macht, das Schmerzliche erträglich und das Alltägliche lebenswert zu machen. „Es gibt eine so klare und perfekte Erinnerung, dass mein Gehirn an bestimmten Tagen auf nichts anderes hört“, schreibt Stephen Reid – Autor, inhaftierter Bankräuber und selbsternannter Junkie – über seinen ersten Drogenkonsum im Alter von elf Jahren. „Ich fühlte tiefe Ehrfurcht vor dem Alltäglichen – dem blassen Himmel, der blauen Fichte, dem rostigen Stacheldrahtzaun, den verwelkten gelben Blättern. Ich bin high. Ich bin elf Jahre alt und verbunden mit dieser Welt. Völlig naiv trete ich in das ‚Herz der Unwissenheit‘1 ein. In ähnlicher Weise hat Leonard Cohen über,das Versprechen, die Schönheit und die Erlösung durch Zigaretten‘ geschrieben …“
Wie Muster in einem Wandteppich tauchen in meinen Interviews mit Süchtigen wiederkehrende Themen auf: die Droge als emotionales Betäubungsmittel, als Mittel gegen ein schreckliches Gefühl der Leere, als Tonikum gegen Müdigkeit, Langeweile, Entfremdung und ein Gefühl der persönlichen Unzulänglichkeit, als Stresslöser und sozialer Schmierstoff. Und die Droge kann, wie in Stephen Reids Beschreibung, – wenn auch nur für einen kurzen Augenblick – die Pforten zur spirituellen Transzendenz öffnen. Egal in welcher Gesellschaftsschicht, diese Themen zerstören überall das Leben der Hungergeister. Sie wirken mit tödlicher Gewalt auf die Kokain-, Heroin- und Chrystal-Meth-Süchtigen von Downtown Eastside. Wir werden im nächsten Kapitel darauf zurückkommen.
———
Im Portland gibt es ein Foto, das Sharon zeigt, die in einem schwarzen Badeanzug auf einem sonnengesprenkelten Deck die Beine in das schimmernde, klare Wasser eines blau gefliesten Pools taucht. Entspannt und gelassen lächelt sie direkt in die Linse des Fotografen. Dies ist die junge Frau, voller Freude und Möglichkeiten, der der Priester mit diesem Foto ein Denkmal setzte. Es entstand einige Monate vor ihrem Tod, als Sharon im Haus ihres Zwölf-Schritte-Paten die Wärme eines Nachmittages im Spätherbst genoss.
In den zwölf Jahren, die Sharon in Downtown Eastside verbrachte, konnte sie diese zwölf Schritte nicht vollenden. Sie war bis zu dem Tag, an dem sie als Bewohnerin im Portland aufgenommen wurde, so gestört und kokainaggressiv gewesen, dass sie nicht einmal zu Besuch ins Haus kommen durfte. „So läuft es“, sagte Kerstin Stuerzbecher, Direktorin der Portland Society, im Foyer der Kapelle nach Sharons Beerdigung. „Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder verursacht man zu viel Stress, um hier leben zu dürfen, oder man macht so viel Ärger, dass man nur hier leben kann.“
„Und auch nur hier sterben kann“, fügte Kerstin hinzu, als wir in das Sonnenlicht hinaustraten.
* Infektionen entstehen durch Bakterien, die während der Drogeninjektion in das Gewebe injiziert werden und durch den Blutkreislauf zu inneren Organen wie Lunge, Leber, Herz, Wirbelsäule und Gehirn transportiert werden.
KAPITEL 3
Die Schlüssel zum Paradies: Sucht als Flucht aus der Verzweiflung
Sucht als „schlechte Angewohnheit“ oder „selbstzerstörerisches Verhalten“ abzutun, verbirgt leicht ihre Funktionalität im Leben des Süchtigen.1
DR. VINCENT FELITTI, ARZT AND WISSENSCHAFTLER
Es ist unmöglich, die Sucht zu verstehen, ohne zu erkunden, welche Erleichterung der Süchtige durch die Droge oder das Suchtverhalten findet bzw. zu finden hofft.
Thomas De Quincey, ein Literat des frühen neunzehnten Jahrhunderts, war Opiumkonsument. „Die subtilen Kräfte, die in dieser mächtigen Droge stecken“, so schwärmte er, „beruhigen alle Irritationen des Nervensystems … halten die sonst schlaff werdenden animalischen Energien vierundzwanzig Stunden lang aufrecht. … Oh gerechtes, subtiles und alles eroberndes Opium … Du allein vermagst, dem Menschen diese Gaben zu geben und hast damit die Schlüssel zum Paradies.“ De Quinceys Worte fassen die Segnungen aller Drogen zusammen, wie sie der Süchtige erfährt – sie machen, wie wir später sehen werden, den Reiz aller süchtig machenden Obsessionen aus, unter Beteiligung von Drogen oder ohne.
Der chronische Drogenkonsum ist weit mehr als die Suche nach Vergnügen, er ist der Versuch des Süchtigen, der Not zu entkommen. Aus medizinischer Sicht reagieren Süchtige mit selbstmedikamentösen Maßnahmen auf Depressionen, Angstzustände, posttraumatischen Stress oder sogar ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung).
Ob offen oder verdeckt, Süchte haben ihren Ursprung immer im Schmerz, im Unbewussten. Sie sind emotionale Betäubungsmittel. Heroin und Kokain, beides starke physische Schmerzmittel, lindern auch psychische Beschwerden. Tierkinder, die von ihren Müttern getrennt wurden, können leicht durch niedrige Dosen von Narkotika* beruhigt werden, so als wären es eigentlich körperliche Schmerzen, die sie durchleiden.2
Die Schmerzbahnen beim Menschen funktionieren nicht anders. Dieselben Gehirnzentren, die körperliche Schmerzen realisieren und „fühlen“, werden auch bei der Erfahrung emotionaler Ablehnung aktiviert: Auf Gehirnscans „leuchten“ sie als Reaktion auf soziale Ächtung genauso auf wie auf körperlich schädliche Reize.3 Wenn Menschen davon sprechen, sich „verletzt“ zu fühlen oder emotionale „Schmerzen“ zu haben, sind das keine abstrakten oder poetischen Formulierungen, sondern wissenschaftlich recht präzise.
Das Leben des schwer Drogensüchtigen ist von einem Übermaß an Schmerzen geprägt. Kein Wunder, dass er sich verzweifelt nach Linderung sehnt. „In wenigen Augenblicken wechsele ich von der Erfahrung des totalen Elends und der Verletzlichkeit zum Gefühl völliger Unverwundbarkeit“, sagt Judy, eine sechsunddreißigjährige Heroin- und Kokainabhängige, die jetzt versucht, von ihrer zwei Jahrzehnte währenden Sucht loszukommen. „Ich habe eine Menge Probleme. Ein Großteil der Gründe, warum ich Drogen nehme, besteht darin, dass ich diese Gedanken und Emotionen loswerden und sie vertuschen will.“
Die Frage lautet nie „Warum die Sucht?“, sondern „Warum der Schmerz?“.
Die Forschungsliteratur ist eindeutig: Die meisten schwerst Substanzabhängigen kommen aus misshandelnden Familien.4 Die Mehrheit meiner Patienten aus den heruntergekommenen Vierteln erlitt schon früh im Leben schwere Vernachlässigung und Misshandlung. Fast alle süchtigen Frauen, die in Downtown Eastside leben, wurden in ihrer Kindheit sexuell missbraucht, ebenso wie viele der Männer. Die autobiografischen Berichte und Fall-Akten der Bewohner von Portland erzählen Geschichten von Schmerz ohne Ende: Vergewaltigung, Schläge, Erniedrigung, Ablehnung, Verlassenwerden, unerbittliche Verleumdung. Als Kinder waren sie gezwungen, Zeuge von gewalttätigen Beziehungen, selbstschädigenden Lebensmustern oder selbstmörderischen Abhängigkeiten ihrer Eltern zu werden – und mussten sich oft um sie kümmern. Oder sie waren für ihre jüngeren Geschwister verantwortlich und versuchten sie vor Missbrauch zu schützen, während sie selbst die tägliche Verletzung ihres eigenen Körpers und ihrer Seele ertrugen. Ein Mann wuchs in einem Hotelzimmer auf, in dem seine Mutter als Prostituierte in der Nacht eine Reihe von Männern befriedigte, während er als Kind auf seiner Schlafstelle auf dem Boden schlief oder es zumindest versuchte.
Carl, ein sechsunddreißigjähriger Ureinwohner, wurde von einer Pflegefamilie zur anderen weitergereicht, bekam im Alter von fünf Jahren Spülmittel in die Kehle geschüttet, weil er unflätige Ausdrücke gebraucht hatte, und wurde in einem dunklen Raum an einen Stuhl gefesselt, um seine Hyperaktivität zu bändigen. Wenn er wütend auf sich war – so wie eines Tages, weil er Kokain genommen hatte – ritzte er sich zur Strafe den Fuß mit einem Messer auf. Er gestand mir seine „Sünde“ mit dem Blick eines verängstigten Bengels, der gerade ein Familienerbstück zerschlagen hat und die härteste Vergeltung fürchtet.
Ein anderer Mann beschrieb, wie seine Mutter einen mechanischen Babysitter einsetzte, als er drei Jahre alt war. „Sie ging in die Bar, um zu trinken und Männer aufzureißen. Ihre Idee, um mich zu beschützen und nicht in Schwierigkeiten zu geraten, war, mich in den Trockner zu stecken. Obendrauf stellte sie eine schwere Kiste, damit ich nicht rauskonnte.“ Das Lüftungsloch sorgte dafür, dass der kleine Junge nicht erstickte.
Meine Prosa ist der Aufgabe nicht gewachsen, ein solches, fast nicht vorstellbares Trauma wiederzugeben. „Unsere Schwierigkeit oder Unfähigkeit, die Erfahrungen anderer zu verstehen … ist umso ausgeprägter, je weiter diese Erfahrungen in Zeit, Raum oder Qualität von unseren entfernt sind“, schrieb der Auschwitz-Überlebende Primo Levi.5 Die Tragödie der Hungersnot auf einem fernen Kontinent kann uns berühren, schließlich haben wir alle mal körperlichen Hunger erlebt, wenn auch nur vorübergehend. Aber es erfordert eine größere Anstrengung der emotionalen Vorstellungskraft, sich in einen Süchtigen einzufühlen. Wir empfinden bereitwillig Mitgefühl für ein leidendes Kind, aber wir können nicht das Kind in dem Erwachsenen sehen, der mit gebrochener Seele und isoliert ein paar Häuserblocks von unserem Einkaufs- oder Arbeitsort entfernt ums Überleben kämpft.
Levi zitiert Jean Améry, einen jüdisch-österreichischen Philosophen und Widerstandskämpfer, der der Gestapo in die Hände fiel. „Jeder, der gefoltert wurde, bleibt gefoltert … Jeder, der einmal gefoltert wurde, wird nie wieder in der Lage sein, sich in der Welt entspannt zu fühlen … Der Glaube an die Menschlichkeit, der bereits durch den ersten Schlag ins Gesicht gebrochen und dann durch die Folter zerstört wurde, wird nie wiedererlangt.“6 Améry war erwachsen, als er traumatisiert wurde, ein gereifter Intellektueller, der im Laufe eines Befreiungskrieges vom Feind gefangen genommen wurde. Stellen Sie sich das Entsetzen, den Vertrauensverlust und die unfassbare Verzweiflung des Kindes vor, das nicht von verhassten Feinden, sondern von geliebten Menschen traumatisiert wird.
Nicht alle Süchte haben ihre Wurzeln in Misshandlungen oder Traumata, aber ich denke, dass sie alle auf schmerzliche Erfahrungen zurückzuführen sind. Schmerz steht im Zentrum jedes Suchtverhaltens. Er ist bei Spiel-, Internet-, Kauf- und Arbeitssüchtigen vorhanden. Die Wunde ist vielleicht nicht so tief und der Schmerz nicht so quälend, vielleicht ist er sogar völlig verborgen – aber der Schmerz ist da. Wie wir sehen werden, wirken in jungen Jahren erlebter Stress oder nachteilige Erfahrungen direkt auf die psychologische und auch auf die neurobiologische Suchtempfindlichkeit des Gehirns.
———
Ich fragte den siebenundfünfzigjährigen Richard, der seit seiner Jugend süchtig ist, warum er weiterhin Drogen nimmt. „Ich weiß nicht, ich versuche einfach, eine Lücke zu füllen“, antwortete er. „Die Leere in meinem Leben. Die Langeweile. Die Orientierungslosigkeit.“ Ich wusste nur zu gut, was er meinte. „Hier bin ich, Ende fünfzig“, sagte er. „Ich habe keine Frau, keine Kinder. Ich scheine ein Versager zu sein. Die Gesellschaft erwartet, dass man heiratet, Kinder kriegt, einen Job und so weiter. Durch das Kokain bin ich nur in der Lage, so Kleinigkeiten zu erledigen, wie den Toaster neu zu verkabeln, der nicht funktioniert hat, und so muss ich dann nicht das Gefühl haben, als würde ich nicht mehr leben.“ Einige Monate nach unserem Gespräch erlag er einer Kombination aus Lungenkrankheit, Nierenkrebs und Überdosis.
„Ich habe sechs Jahre lang nichts genommen“, sagt Cathy, eine zweiundvierzigjährige Heroin- und Kokainkonsumentin, die nach langer Abwesenheit wieder zurückgekehrt ist in ein schmuddeliges Downtown-Eastside-Hotel. Seit ihrer Rückkehr ist sie mit HIV infiziert. „Die ganzen sechs Jahre sehnte ich mich danach. Es war der Lebensstil. Ich dachte, ich würde etwas verpassen. Und jetzt schaue ich mich um und denke: ‚Was zum Teufel soll ich verpasst haben?‘„ Cathy gesteht, dass sie in der Zeit, als sie keine Drogen nahm, nicht nur die Wirkung der Drogen vermisste, sondern auch die Aufgeregtheit der Drogensuche und die Rituale, die die Drogensucht mit sich bringt. „Ich wusste einfach nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Es fühlte sich leer an.“
Das Gefühl der Leere durchzieht unsere gesamte Kultur. Der Drogensüchtige ist sich dieser Leere schmerzhafter bewusst als die meisten Menschen und er hat nur begrenzte Möglichkeiten, ihr zu entkommen. Der Rest von uns findet andere Wege, um die Angst vor der Leere zu unterdrücken oder sich von ihr abzulenken. Wenn wir nichts haben, mit dem wir uns gedanklich beschäftigen können, können negative Erinnerungen, beunruhigende Ängste, Unbehagen oder nagender geistiger Stumpfsinn, den wir Langeweile nennen, aufkommen. Drogensüchtige wollen um jeden Preis vermeiden, mit ihrem Verstand „Zeit allein“ zu verbringen. In geringerem Maße sind Verhaltenszwänge auch Reaktionen auf diesen Terror der Leere.
———
„Opium“, so schrieb Thomas De Quincey, sei ein mächtiges „Gegenmittel … gegen den gewaltigen Fluch des taedium vitae“ – der Langeweile des Lebens.
Der Mensch will nicht nur überleben, sondern auch leben. Wir sehnen uns danach, das Leben in all seiner Lebendigkeit zu erfahren, mit voller, ungebändigter Emotion. Erwachsene beneiden die offenherzigen und aufgeschlossenen Erkundungen der Kinder. Wenn wir ihre Freude und Neugierde sehen, sehnen wir uns nach unserer eigenen verlorenen Fähigkeit, die Welt mit großen Augen zu bestaunen. Langeweile, die in einem grundlegenden Unbehagen mit sich selbst wurzelt, ist einer der am wenigsten erträglichen psychischen Zustände.
Für den Süchtigen bietet die Droge einen Weg, sich wieder lebendig zu fühlen, wenn auch nur vorübergehend. „Ich fühlte tiefe Ehrfurcht vor dem Alltäglichen“, erinnert sich der Autor und Bankräuber Stephen Reid an seinen ersten Morphium-Trip. Thomas De Quincey preist die Macht des Opiums, „die Genussfähigkeit zu stimulieren“.
Carol ist dreiundzwanzig Jahre alt und wohnt im Stanley Hotel der Portland Hotel Society. Ihre Nase und Lippen sind mit Ringen gepierct. Um ihren Hals trägt sie eine Kette mit einem schwarzen Metallkreuz. Ihre Frisur ist ein rosa gefärbter Irokesenschnitt, der hinten in blonden Locken ausläuft, die bis zu den Schultern reichen. Carol ist eine aufgeweckte, geistig bewegliche junge Frau, die seit ihrer Flucht von zu Hause im Alter von fünfzehn Jahren Meth spritzt und heroinabhängig ist. Das Stanley ist ihr erstes stabiles Domizil nach fünf Jahren auf der Straße. Heute setzt sie sich aktiv für das Konzept der Schadensminderung und die Unterstützung von Mitsüchtigen ein. Sie hat an internationalen Konferenzen teilgenommen und ihre Schriften sind von Suchtexperten zitiert worden.
Bei einem Methadon-Termin erklärt sie, was sie an der Erfahrung mit Crystal Meth schätzt. Sie spricht nervös und schnell und zappelt unaufhörlich, was auf ihren langjährigen Drogenkonsum und wahrscheinlich auf die in frühen Jahren begonnene Hyperaktivitätsstörung zurückzuführen ist, die sie schon hatte, bevor sie überhaupt mit Drogen begann. Wie es sich für ein auf der Straße aufgewachsenes Kind ihrer Generation gehört, scheint jedes zweite Wort von Carol „so was wie“ oder „was auch immer“ zu lauten.
„Wenn man einen guten Schuss oder was auch immer hat, so was wie Hustensaft oder was auch immer, so ein warmes Gefühl, dann fühlt man echt die Wirkung des Schusses, beginnt schwer zu atmen oder was auch immer“, sagt sie. „So ähnlich wie bei einem guten Orgasmus, wenn man ein eher sexueller Mensch ist – so habe ich das nie wirklich gesehen, aber mein Körper erlebt immer noch die gleichen körperlichen Empfindungen. Ich bringe es nur nicht mit Sex in Verbindung.“
„Ich werde total erregt, egal, was es ist … Ich experimentiere gern mit Kleidern, oder ich gehe gern nachts im West End aus, wenn da nicht so viele Leute unterwegs sind, streune gern durch Hinterhöfe und singe mir selbst etwas vor. Die Leute lassen Sachen liegen, ich suche, was ich finden kann, wühle herum, und es ist alles mordsspannend.“
Dass sich der Süchtige auf die Droge verlässt, um seine abgestumpften Gefühle wiederzuerwecken, ist kein jugendlicher Einfall. Die Dumpfheit ist selbst Folge einer emotionalen Störung, welche die Droge nicht verursacht hat: des inneren Abspaltens von der Verletzlichkeit.
Vom lateinischen Wort vulnerare, „verwunden“, abgeleitet bedeutet Vulnerabilität unsere Anfälligkeit, verwundet zu werden. Diese „Schwäche“ liegt in unserer Natur und wir können ihr nicht entkommen. Das Beste, was das Gehirn tun kann, ist, das Bewusstsein für den Schmerz abzuschalten, wenn er so groß oder unerträglich ist, dass er unsere Funktionsfähigkeit zu überfordern droht. Die automatische Unterdrückung schmerzhafter Emotionen ist der wichtigste Abwehrmechanismus eines hilflosen Kindes und kann ihm helfen, ein Trauma zu ertragen, das sonst katastrophal wäre. Die bedauerliche Konsequenz ist eine völlige Abstumpfung des emotionalen Bewusstseins. „Jeder weiß, dass man etwas nicht gezielt oder exakt unterdrücken kann“, schrieb der amerikanische Schriftsteller Saul Bellow in Die Abenteuer des Augie March, „wenn man eine Sache unterdrückt, wirkt sich das auch auf alles aus, was damit verbunden ist.“7
Intuitiv wissen wir alle, dass es besser ist zu fühlen, als nicht zu fühlen. Abgesehen von ihrer anregenden subjektiven Bedeutung sind Emotionen entscheidend für unser Überleben. Sie geben uns Orientierung, interpretieren die Welt für uns und bieten uns lebenswichtige Informationen. Sie sagen uns, was gefährlich und was gutartig ist, was unsere Existenz bedroht und was unser Wachstum fördert. Stellen Sie sich vor, wie behindert wir wären, wenn wir nicht sehen, hören oder schmecken könnten, oder wenn wir weder Hitze noch Kälte oder körperlichen Schmerz spüren würden. Ähnlich ist es mit dem emotionalen Abschalten. Unsere Emotionen sind ein unverzichtbarer Teil unseres Sinnesapparats und ein wesentlicher Teil dessen, was wir sind. Sie machen das Leben lebenswert, aufregend, herausfordernd, schön und bedeutungsvoll.
Wenn wir vor unserer Vulnerabilität fliehen, verlieren wir unser ganzes Empfindungsvermögen. Vielleicht werden wir sogar zu emotionalen Amnesiekranken, die sich nicht mehr daran erinnern können, dass sie sich jemals wirklich gefreut haben oder wirklich traurig waren. Eine nagende Lücke macht sich breit, die wir als Entfremdung und intensive Langeweile erleben, als das oben beschriebene Gefühl mangelbehafteter Leere.
Die wundersame Kraft einer Droge besteht darin, dem Süchtigen Schutz vor Schmerzen zu bieten und ihn gleichzeitig in die Lage zu versetzen, die Welt mit Spannung und Sinn zu erfüllen. „Es ist nicht so, dass meine Sinne abgestumpft sind – nein, sie sind geöffnet, sie weiten sich“, erklärte eine junge Frau, deren bevorzugte Substanzen Kokain und Marihuana sind. „Aber die Angst ist weg und die nagende Schuld, ja, so ist es!“ Die Droge gibt dem Süchtigen die Lebendigkeit seiner Kindheit zurück, die er vor langer Zeit unterdrückt hat.
———
Emotional ausgelaugten Menschen fehlt es oft an körperlicher Energie, wie jeder weiß, der eine Depression erlebt hat, und dies ist eine Hauptursache für die körperliche Ermüdung, die viele Süchtige plagt. Es gibt noch viele andere: schlechte Ernährung, ein schwächender Lebensstil, Krankheiten wie HIV, Hepatitis C und die damit verbundenen Komplikationen, Schlafstörungen, die in vielen Fällen bis in die Kindheit zurückreichen – eine weitere Folge von Misshandlung oder Vernachlässigung. „Ich konnte einfach nicht einschlafen, nie“, sagt Maureen, eine Sexarbeiterin und Heroinabhängige. Wie Thomas De Quincey, der Opium benutzte, um „die sonst schwindenden animalischen Energien vierundzwanzig Stunden lang aufrechtzuerhalten“, wenden sich heutige Süchtige den Drogen zu, um einen zuverlässigen Energieschub zu erhalten.
„Ich kann nicht auf Kokain verzichten“, sagte mir einmal eine schwangere Patientin namens Celia. „Durch mein HIV habe ich keine Energie. Rock gibt mir Kraft.“ Ihre Worte klangen wie eine morbide Umdeutung der Psalmworte: „Er allein ist mein Fels [engl. rock] und meine Rettung, meine Burg, ich werde niemals wanken.“
„Ich genieße den Rausch, den Geruch und den Geschmack“, sagt Charlotte, langjährige Kokain- und Heroinkonsumentin, Haschischraucherin und bekennender Speed-Freak. „Ich schätze, ich habe schon so lange geraucht oder irgendeine Form von Drogen genommen, ich weiß nicht … Ich denke: Was, wenn ich aufhöre? Was dann? Denn von dort bekomme ich meine Energie.“
„Mann, ich kann den Tag nicht ohne Crack überstehen“, sagt Greg, ein Multi-Drogensüchtiger Anfang vierzig. „Ich sterb’ grad dafür.“
„Du stirbst nicht dafür“, wage ich zu behaupten. „Du stirbst deswegen.“ Greg fühlt sich herausgefordert. „Nee, ich nicht. Ich bin Ire und zur Hälfte Inder.“
„Stimmt. Es gibt hier keine toten Iren oder Inder.“
Greg erwidert noch ausgelassener: „Irgendwann muss jeder gehen. Wenn deine Nummer aufgerufen wird, war’s das.“
Diese vier wissen es nicht, aber jenseits von Krankheit oder der Trägheit emotionaler und physischer Erschöpfung haben sie es auch mit der Hirnphysiologie der Sucht zu tun.
Wie wir sehen werden, hat Kokain eine euphorisierende Wirkung, indem es die Verfügbarkeit der Belohnungschemikalie Dopamin in wichtigen Hirnkreisläufen erhöht, was für die Motivation und für die geistige und körperliche Energie notwendig ist. Wenn das Gehirn künstlich mit hohen Dopaminspiegeln, die durch externe Substanzen ausgelöst werden, geflutet wird, werden die hirneigenen Mechanismen der Dopaminproduktion träge. Sie hören bei nahezu voller Kapazität auf zu funktionieren und verlassen sich stattdessen auf die künstlichen Verstärker. Nur lange Monate der Abstinenz erlauben es der intrinsischen Maschinerie der Dopaminproduktion, sich zu regenerieren. In der Zwischenzeit erlebt der Süchtige eine extreme körperliche und emotionale Erschöpfung.
———
Aubrey, ein großer, schlaksiger, eigenbrötlerischer Mann, der sich dem mittleren Alter nähert, ist ebenfalls kokainabhängig. Sein Gesichtsausdruck wirkt permanent traurig und sein üblicher Ton ist von Resignation und Bedauern geprägt. Ohne Drogen fühlt er sich als Mensch unvollständig und inkompetent – ein Selbstbildnis, das nichts mit seinen wirklichen Fähigkeiten, aber alles mit seinen prägenden Erfahrungen als Kind zu tun hat. Nach seiner eigenen Einschätzung war das Gefühl der Unzulänglichkeit und des eigenen Gescheitertseins schon Teil seiner Persönlichkeit, bevor er jemals mit Drogen in Berührung kam.
„Nach der achten Klasse bin ich mit Drogen aufgewachsen“, sagt Aubrey. „Als ich mit den Drogen begann, merkte ich, dass ich zu den anderen Jugendlichen passte. Ja, es war sehr wichtig dazuzugehören. Wissen Sie, wenn die Mannschaft für ein Fußballspiel zusammengestellt wurde, war ich immer der Letzte, der gewählt wurde.“
„Schauen Sie“, fährt er fort, „Ich war viel in Einrichtungen, habe lange Zeit in einer vier mal acht Meter großen Zelle verbracht. Ich war also viel allein. Und auch davor. Ich hatte eine schwere Kindheit, in der ich von Pflegefamilie zu Pflegefamilie gereicht wurde. Ich wurde ziemlich oft weggeschickt, so war es.“
„In welchem Alter wurden Sie zu Pflegefamilien geschickt?“, frage ich.
„Mit etwa elf Jahren. Mein Vater wurde getötet, von einem Lastwagen überfahren. Meine Mutter konnte sich nicht um alle Kinder kümmern, und so sprang das Jugendamt ein. Da ich der Älteste war, holten sie mich raus. Ich habe noch zwei Brüder. Sie waren jünger. Sie sind zu Hause geblieben.“
Aubrey glaubt, dass er ausgewählt wurde, in einer Pflegefamilie zu leben, weil er „als Kind so überdreht war“, dass seine Mutter nicht mit ihm fertig wurde.
„Ich war fünf Jahre dort. Nun, nicht in einer Familie. Nein. Ich wurde herumgeschickt. Sie behielten mich vielleicht für ein Jahr, dann konnten sie nicht mehr … und ich musste zu einer anderen Familie.“
„Wie fühlte es sich an, so herumgeschoben zu werden?“
„Es tat weh. Ich hatte das Gefühl, nicht gewollt zu sein. Ich war noch ein Kind … Ja, so war’s, ich war ein Kind und niemand wollte mich. Sogar in der Schule. Die Nonnen unterrichteten mich, aber ich habe nie lesen oder schreiben gelernt oder sonst was. Sie schoben mich nur von einer Klasse in die nächste … ständig wurde ich für irgendetwas diszipliniert, und sie nahmen mich aus der Klasse heraus und steckten mich in eine Klasse mit vier- oder fünfjährigen Kindern … deshalb fühlte ich mich so unbehaglich. Es war schwer für mich. Ich fühlte mich dumm. Ich sitze da mit all diesen kleinen Kindern um mich herum, die mich anschauen. Der Lehrer unterrichtet Buchstabieren … Und sie können es, ich aber nicht … Ich habe das alles für mich behalten. Ich wollte lange nicht reden … Ich konnte nicht einmal mit Leuten sprechen. Ich stotterte; es fiel mir schwer, mich auszudrücken. Ich behielt alles so lange in mir. Wenn ich aufgedreht bin, kann ich nicht mehr richtig reden …“
„Komisch, das Kokain beruhigt mich.* Und das Gras. Ich rauche fünf oder sechs Joints am Tag. Das entspannt mich auch. Es nimmt die Schärfe. Am Ende des Tages lege ich mich einfach damit hin. So sieht es aus, das ist mein Leben. Ich rauche einen Joint und gehe schlafen.“
Shirley, eine Frau in den Vierzigern, süchtig nach Opiaten und Stimulanzien und mit der üblichen Liste von Krankheiten behaftet, gesteht auch ein Gefühl der Unzulänglichkeit, wenn sie keine Drogen nimmt, und sieht Kokain als eine Lebensnotwendigkeit an. „Ich war dreizehn, als ich zum ersten Mal Drogen nahm. Es nahm mir die meisten meiner Hemmungen, mein Unbehagen, meine Unzulänglichkeiten – eben so, wie wir uns selbst sehen, das trifft es wohl besser.“