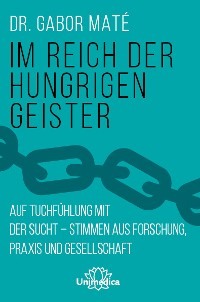Kitabı oku: «Im Reich der hungrigen Geister», sayfa 6
„Wenn Sie Hemmungen sagen, was meinen Sie damit?“, frage ich.
„Hemmungen … wie die Verlegenheit, die ein Mann und eine Frau empfinden, wenn man sich zum ersten Mal trifft, und man weiß nicht, ob man sich küssen soll, nur dass ich mich immer so gefühlt habe. Mit der Droge wird alles einfacher … deine Bewegungen sind entspannter, sodass du nicht mehr unbeholfen wirkst.“
Kein Geringerer als der junge Dr. Sigmund Freud war eine Zeit lang vom Kokain begeistert und verließ sich darauf, dass es „seine zeitweilig depressiven Stimmungen unter Kontrolle bringen, sein allgemeines Wohlbefinden verbessern, ihm helfen würde, sich in verkrampften sozialen Begegnungen zu entspannen und sich einfach mehr wie ein Mann zu fühlen“.** Freud war nur langsam bereit zu akzeptieren, dass Kokain ein Abhängigkeitsproblem schaffen kann.
Indem die Droge die Persönlichkeit stärkt, erleichtert sie auch die sozialen Interaktionen, wie Aubrey und Shirley beide bezeugen. „Normalerweise fühle ich mich niedergeschlagen“, sagt Aubrey. „Wenn ich kokse, bin ich ein ganz anderer Mensch. Ich könnte mich jetzt viel besser mit Ihnen unterhalten, wenn ich high vom Kokain wäre. Ich würde nicht so undeutlich reden. Es macht mich wach. Es macht es einfacher, Leute zu treffen. Ich möchte mit jemandem ein Gespräch beginnen. Es ist normalerweise nicht sehr interessant, mit mir zu reden … Deshalb möchte ich meistens auch nicht mit anderen Menschen zusammen sein. Mir fehlt dieser Antrieb. Ich bleibe allein in meinem Zimmer.“
Viele Süchtige berichten in ähnlicher Weise, dass sich ihre sozialen Beziehungen verbessern, wenn sie Drogen genommen haben, im Gegensatz zu der unerträglichen Einsamkeit, die sie erleben, wenn sie nüchtern sind. „Ich fange an zu reden, öffne mich; ich kann freundlich sein“, erzählt ein junger Mann, der Crystal Meth nimmt. „Normalerweise bin ich nie so.“ Wir sollten nicht unterschätzen, wie verzweifelt ein chronisch einsamer Mensch ist, der dem Gefängnis der Einsamkeit zu entkommen versucht. Es handelt sich hier nicht um normale Schüchternheit, sondern um ein tief empfundenes, psychisches Gefühl der Isolation, das von frühester Kindheit an von Menschen erfahren wurde, die sich von allen, angefangen bei ihren Betreuern, abgelehnt fühlen.
Nicole ist Anfang fünfzig. Nachdem sie bereits fünf Jahre meine Patientin war, enthüllte sie mir, dass sie als Teenager wiederholt von ihrem Vater vergewaltigt worden war. Auch sie ist HIV-positiv. Wegen der verheerenden Folgen einer alten Hüftinfektion humpelt sie jetzt mit einem Stock herum. „Ich bin mit der Droge sozialer“, sagt sie. „Ich werde gesprächig und selbstbewusst. Normalerweise bin ich schüchtern, lebe zurückgezogen und mache nicht viel her. Ich lasse mich von Leuten herumkommandieren.“
———
Eine andere starke Dynamik hält die Sucht trotz der katastrophalen Folgen weiter am Leben: Der Süchtige sieht keine andere Existenzmöglichkeit für sich. Seine Zukunftsperspektive wird durch sein tief verwurzeltes Selbstbild als Süchtiger eingeschränkt. Wie sehr er den Preis seiner Sucht auch erkennen mag, er fürchtet doch einen Selbstverlust, wenn diese in seinem Leben fehlen würde. In seiner eigenen Vorstellung würde er aufhören, so zu existieren, wie er sich selbst kennt.
Carol erzählt, dass sie sich unter dem Einfluss von Crystal Meth auf eine völlig neue und positive Art und Weise erleben konnte. „Ich empfand mich klüger, als ob sich eine Schleuse an Informationen oder was auch immer unmittelbar in meinem Kopf öffnen würde … Meine Kreativität wurde geweckt …“ Als ich sie frage, ob sie ihre achtjährige Amphetamin abhängigkeit in irgendeiner Weise bedauert, ist sie nicht um eine Antwort verlegen: „Nicht wirklich, denn es hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin.“ Das mag bizarr klingen, aber aus Carols Sicht hat ihr der Drogenkonsum geholfen, einem missbräuchlichen Elternhaus zu entkommen, Jahre des Lebens auf der Straße zu überstehen und sie mit einer Gemeinschaft von Menschen mit gleichen Erfahrungen zu verbinden. Wie viele Crystal Meth-Konsumenten es sehen, kann die Droge für junge Obdachlose von Vorteil sein. Seltsamerweise macht sie ihr Leben auf kurze Sicht lebenswerter. Es ist schwierig, auf der Straße einen guten und sicheren Schlafplatz zu haben: Crystal-Meth hält dich wach und aufmerksam. Kein Geld für Lebensmittel? Nun, man verspürt auch keinen Hunger, Crystal Meth ist ein Appetitzügler. Müde, ohne Energie? Crystal Meth gibt dem Konsumenten grenzenlose Energie.
Chris, ein sympathischer Mann mit einem schelmischen Sinn für Humor, dessen muskulöse Arme ein Kaleidoskop von Tätowierungen tragen, hat vor einigen Monaten eine einjährige Gefängnisstrafe hinter sich gebracht und ist jetzt wieder im Methadonprogramm. In Downtown Eastside kennt man ihn unter dem seltsamen Beinamen „Zehenschneider“, den er sich verdiente, so erzählt man, als er jemandem eine scharfe, schwere Industrieklinge auf den Fuß fallen ließ. Mit verbissener Entschlossenheit injiziert er weiterhin Crystal Meth. „Hilft mir, mich zu konzentrieren“, sagt er. Es besteht kein Zweifel, dass er sein Leben lang schon ADHS hat, und er akzeptiert die Diagnose, lehnt aber eine Behandlung ab. „Dieser kluge Arzt hat mir einmal gesagt, dass ich mich selbstmedikamentös behandele“, schmunzelt er und erinnert sich an ein Gespräch, das wir vor Jahren geführt haben.
Chris kam kürzlich mit einer Fraktur seiner Gesichtsknochen in die Klinik, die er sich bei einer Straßenschlägerei um eine „Tüte“ Heroin zugezogen hatte. Hätte ihn der Schlag einen Zentimeter höher getroffen, wäre sein linkes Auge zerstört worden. „Ich will weiterhin Süchtiger bleiben“, sagt er, als ich ihn frage, ob es das alles wert sei. „Ich weiß, das klingt ziemlich abgefuckt, aber ich mag, wer ich bin.“
„Sie sitzen hier mit einem von einem Metallrohr zertrümmerten Gesicht und sagen mir, dass es Ihnen gefällt, wer Sie sind?“
„Ja, mir gefällt, wer ich bin. Ich bin Zehenschneider, ich bin süchtig und ich bin ein netter Kerl.“
———
Jake, ein Methadon-behandelter Opiatabhängiger und starker Kokainkonsument, ist Mitte dreißig. Mit seinen feinen blonden Gesichtsstoppeln, seinen lebhaften Körperbewegungen und seiner schwarzen Baseballmütze, die er verwegen tief über die Augen gezogen hat, könnte er für zehn Jahre jünger durchgehen. „Sie haben in letzter Zeit eine Menge Kokain gespritzt“, bemerke ich eines Tages ihm gegenüber.
„Es ist schwer, davon loszukommen“, antwortet er mit seinem zahnlückenhaften Grinsen.
„Bei Ihnen klingt es, als wäre das Koks ein wildes Tier, das Ihnen nachstellt.
Und doch sind Sie derjenige, der es jagt. Was bringt es Ihnen?“
„Es nimmt dem Alltag die Härte, die Härte im Umgang mit allem.“
„Was ist alles?“
„Verpflichtungen. Ich schätze, man könnte es so nennen: Verpflichtungen. Solange ich Drogen nehme, sind mir Verpflichtungen egal … Wenn ich älter bin, kümmere ich mich um Rentenpläne und solche Sachen. Aber im Moment kümmere ich mich um nichts anderes als um meine alte Dame.“
„Ihre alte Dame …“
„Ja, ich betrachte Koks als meine alte Dame, meine Familie. Es ist meine Partnerin. Ich habe meine Familie seit einem Jahr nicht mehr gesehen, und es ist mir egal, weil ich meine Partnerin habe.“
„Also ist Koks Ihr Leben.“
„Ja, Koks ist mein Leben … Ich sorge mich mehr um den Stoff als um meine Lieben oder irgendetwas anderes. In den letzten fünfzehn Jahren … ist es jetzt ein Teil von mir geworden. Es ist ein Teil meines Alltags … Ich weiß nicht, wie ich ohne den Stoff leben könnte. Ich weiß nicht, wie ich den Alltag ohne Koks bewältigen soll. Wenn man es mir wegnimmt, weiß ich nicht, was ich tun soll … Wenn Sie mich ändern und mich zu einem geregelten Leben führen würden, wüsste ich nicht, wie ich es aufrechterhalten könnte. Ich war in meinem Leben einmal dort, aber es fühlt sich an, als wüsste ich nicht, wie ich zurückgehen könnte. Ich habe nicht die … Es liegt nicht am Willen; ich weiß nur nicht, wie.“
„Was ist mit Ihrem Wollen? Wollen Sie überhaupt dieses regelmäßige Leben?“
„Nein, eigentlich nicht“, sagt Jake leise und traurig.
Ich glaube nicht, dass das wahr ist. Ich denke, dass es tief in seinem Herzen den Wunsch nach einem Leben in Ganzheit und Integrität geben muss, der vielleicht zu schmerzhaft ist, um ihn anzuerkennen – schmerzhaft, weil er in seinen Augen unerreichbar ist. Jake hat sich so sehr mit seiner Sucht identifiziert, dass er es nicht wagt, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn er clean wäre. „Es fühlt sich für mich wie Alltag an“, sagt er. „Es scheint sich nicht vom Leben eines anderen zu unterscheiden. Für mich ist es normal.“
„Das erinnert mich an den Frosch“, sage ich zu Jake. „Man sagt, wenn man einen Frosch in heißes Wasser wirft, springt er heraus. Aber wenn man denselben Frosch nimmt, ihn in Wasser mit Zimmertemperatur setzt und dann das Wasser langsam erhitzt, wird er zu Tode kochen, weil er sich allmählich, Grad für Grad, daran gewöhnt. Er empfindet es als normal.“
„Wenn Sie ein normales Leben hätten und jemand zu Ihnen sagen würde: ‚Hey, Sie könnten in Downtown Eastside leben, ständig unterwegs sein und drei- oder vierhundert Dollar pro Tag für Crack ausgeben‘, dann würden Sie sagen: ‚Was? Sind Sie verrückt? Das ist nichts für mich!‘ Aber weil Sie schon so lange so leben, ist es für Sie normal geworden.“
Jake zeigt mir dann seine Hände und Arme, bedeckt mit silbrig-weißen Schuppen auf entzündlich geröteten Hautpartien. Zu allem Überfluss ist seine Psoriasis auch noch ausgebrochen. „Meinen Sie, Sie könnten mich zu einem Hautspezialisten schicken?“, fragt er.
„Das könnte ich“, antworte ich, „aber das letzte Mal, als ich das tat, sind Sie nicht zum Termin erschienen. Wenn Sie diesen versäumen, werde ich Sie nicht mehr überweisen.“
„Ich werde gehen, Doc. Keine Sorge, ich werde gehen.“
Ich stelle die Rezepte für Methadon und die dermatologischen Cremes aus, die Jake braucht. Wir plaudern noch ein wenig, und dann geht er. Er ist mein letzter Patient an diesem Tag.
Ein paar Minuten später, als ich meinen AB abhören will, klopft es an der Tür. Ich öffne die Tür einen Spalt. Es ist Jake, der schon am Eingangstor des Portlands gewesen war, aber umgekehrt ist, um mir etwas zu sagen. „Sie hatten recht, wissen Sie“, sagt er und grinst wieder.
„Recht womit?“
„Dieser Frosch, von dem Sie gesprochen haben. Das bin ich.“
* Im allgemeinen Sprachgebrauch kann sich „Narkotikum“ auf jede illegale Droge beziehen. In diesem Buch, wie auch im medizinischen Sprachgebrauch, wird „Narkotikum“ nur als Bezeichnung für opioide Drogen verwendet, die entweder wie Heroin und Morphium vom asiatischen Mohn abgeleitet, oder wie Oxycodon synthetisch sind.
* Der Bericht eines Patienten, dass eine stimulierende Droge wie Kokain oder Crystal Meth eine beruhigende Wirkung auf ihn hat, ist quasi eine Bestätigung dafür, dass er oder sie an ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) leidet. Siehe Appendix II.
** Sofern nicht anders vermerkt, ist die Kursivschrift durchgehend von mir.
KAPITEL 4
Sie glauben mir meine Lebensgeschichte wohl nicht!
„Maté, Sie nehmen mir meine Lebensgeschichte wahrscheinlich nicht ab. Aber alles, was ich Ihnen sage, ist wahr.“
„Denken Sie, ich würde sie Ihnen nicht glauben?“
Serena wirft mir einen Blick zu, der resigniert und herausfordernd zugleich ist. Sie ist eine groß gewachsene Ureinwohnerin mit langen, schwarzen Haaren und hat einen leicht überdrüssigen Ausdruck auf ihrem schmalen Gesicht. Obwohl sie auch spontan fröhlich sein kann, behalten ihre Augen selbst beim Lachen ihre Traurigkeit. Serena ist knapp über dreißig Jahre alt und hat fast ihr halbes Leben hier in Downtown Eastside verbracht, gefangen in ihrer Drogenabhängigkeit.
Was willst du mir erzählen, so denke ich mir, was ich hier noch nicht gehört habe? Später, nachdem ich ihre Geschichte gehört habe, fühle ich mich beschämt.
Serena teilt nicht bereitwillig etwas über ihr Innenleben mit. Sie kommt regelmäßig zu Methadon-Terminen und versucht ab und zu unter dem Vorwand, Kopf- oder Rückenschmerzen zu haben, mich wegen eines anderen Betäubungsmittels übers Ohr zu hauen. Wenn ich mich weigere, ist sie nie streitsüchtig. „Okay“, sagt sie dann leise, zuckt mit den Schultern. Eines Tages, vor zwei Jahren, erschien sie in meiner Praxis und bat um Methadon zur „Mitnahme“ – das heißt, anstatt die Dosis jeden Morgen vor dem Apotheker trinken zu müssen, wollte sie sieben Tagesdosen im Voraus. „Meine Großmutter ist in Kelowna gestorben“, sagte sie in einem flachen, monotonen Ton. „Ich muss für die Beerdigung nach Hause.“
Die Süchtigen in Downtown Eastside fragen oft nach Methadon zur Mitnahme für illegale Zwecke, zum Beispiel um die Substanz zu verkaufen oder sie zu injizieren und dadurch einen stärkeren Rausch zu haben. Andere gehen in die Apotheke, aber anstatt ihre ganze Dosis zu schlucken, halten sie etwas davon im Mund und spucken es später in einen Pappbecher. Das ausgespuckte Methadon wird dann zur Ware. Trotz des Risikos einer übertragbaren Krankheit zögern die Käufer nicht, eine Droge gemischt mit dem Speichel eines anderen zu trinken. Von den Apothekern wird erwartet, dass sie die vollständige Einnahme des von ihnen verabreichten Methadons überwachen, aber diese Regel wird oft nicht eingehalten, sodass der „Saft“ immer wieder auf der Straße zum Verkauf angeboten wird.
„Das muss ich erst überprüfen, bevor ich Ihnen Methadon zur Mitnahme geben kann“, antwortete ich Serena. „Wer ist der Arzt Ihrer Großmutter?“ Nonchalant gab sie mir den Namen. Während sie in meiner Praxis saß und ruhig wartete, wählte ich die Nummer des Arztes in Kelowna. „Frau B. …“, sagte mein Kollege über die Freisprechanlage, „Oh, nein, sie war durchaus sehr lebendig, als ich sie heute Morgen sah.“
„Sie haben es gehört“, sagte ich zu Serena. Kein Zucken, nicht das geringste Anzeichen von Peinlichkeit waren in ihrem Gesicht zu erkennen. „Nun“, sie hob die Schultern und stand auf, um zu gehen, „man sagte mir, sie sei tot.“ Oft schon ist mir die kindliche Unbekümmertheit meiner süchtigen Patienten aufgefallen, wenn sie mich belogen haben. Eine naive Manipulation wie die, die Serena versuchte, ist einfach Teil des Spiels, und erwischt zu werden, ist nicht schlimmer, als beim Versteckspiel gefunden zu werden.
Ihre HIV-Behandlung war schon lange eine Quelle der Auseinandersetzung zwischen uns, da sie sich gewöhnlich weigert, Blutbilder machen zu lassen. „Ich weiß nicht, welche Behandlung Sie brauchen“, erkläre ich, „wenn ich nicht den Zustand Ihres Immunsystems kenne.“ Einmal versuchte ich völlig frustriert, sie mit der Drohung, ihr das Methadon vorzuenthalten, zu den Bluttests zu zwingen. Eine Woche später nahm ich es zurück. „Ich habe kein Recht, Sie zu irgendetwas zu zwingen“, sagte ich als Entschuldigung. „Das Methadon hat nichts mit HIV zu tun. Ob Sie sich testen lassen oder nicht, hängt ganz von Ihnen ab. Ich kann Ihnen nur meinen guten Rat geben. Es tut mir leid.“ „Danke, Maté“, sagte Serena. „Ich will nur nicht, dass mich jemand kontrolliert.“ Bald darauf unterzog sie sich freiwillig den erforderlichen Tests. Und bis jetzt waren ihre Immunwerte gut genug, sodass keine antiviralen Medikamente nötig waren.
Die Frage der Kontrolle ist ein heikles Thema. Kein Teil der Bevölkerung fühlt sich so ohnmächtig wie die Drogensüchtigen in Downtown Eastside. Selbst dem Durchschnittsbürger fällt es aus einer Vielzahl kultureller und psychologischer Gründe schwer, die Autorität eines Arztes infrage zu stellen. Als Autoritätsperson löst der Arzt bei vielen von uns ein tief verwurzeltes Gefühl der kindlichen Machtlosigkeit aus – ich selbst habe diese Erfahrung sogar noch Jahre nach Abschluss meiner medizinischen Ausbildung gemacht, als ich in Behandlung war. Aber im Fall eines Drogensüchtigen ist die Entmachtung real, spürbar und sehr präsent. Bei seiner Verstrickung in illegale Aktivitäten zur Finanzierung seiner Lebensgewohnheit – eine Gewohnheit, die an sich schon illegal ist – wird der Süchtige von allen Seiten durch Gesetze, Regeln und Vorschriften eingeengt. Es kommt mir manchmal so vor, als ob aus der Sicht meiner süchtigen Patienten die Aufgaben der Kriminalbeamten, Staatsanwälte und Richter auf mich als Arzt übertragen werden. Für sie bin ich nicht nur als Heiler, sondern auch als Vollstrecker da.
Da der Downtown-Eastside-Süchtige meist aus einem sozial benachteiligten Umfeld stammt und wiederholt durch Gerichte und Gefängnisse gegangen ist, ist er nicht daran gewöhnt, Autoritäten direkt herauszufordern. Für seine lebenswichtigen Methadon-Rezepte ist er auf den Arzt angewiesen und daher nicht in der Lage, sich durchzusetzen. Wenn er mit seinem Arzt nicht zurechtkommt, hat er wenig Spielraum, um sich anderswo behandeln zu lassen: Die Kliniken von Downtown Eastside sind nicht darauf erpicht, die „Problem“-Patienten der anderen zu übernehmen. Viele Süchtige erzählen verbittert von medizinischem Personal, das, wie sie finden, mit Arroganz und Gefühllosigkeit seine „Entweder so oder gar nicht“-Autorität durchsetzt. Bei jeder Konfrontation mit einer Autoritätsperson, sei es eine Krankenschwester, ein Arzt, Polizist oder der Sicherheitsbeamte eines Krankenhauses, ist der Süchtige praktisch hilflos. Niemand akzeptiert seine Seite der Geschichte – oder handelt danach, selbst wenn er es täte.
Das Gefühl der Macht hängt vom Umfeld ab und korrumpiert. Im Portland habe ich mich bei Verhaltensweisen erwischt, die ich mir in einem anderen Kontext niemals erlauben würde. Vor nicht allzu langer Zeit war eine andere junge Ureinwohnerin in meiner Praxis, ebenfalls methadonabhängig und HIV-infiziert. Ich werde sie Cindy nennen. Am Ende des Besuchs öffnete ich die Tür und rief nach Kim, der Krankenschwester, deren Büro direkt neben meinem liegt: „Nehmen Sie bitte Blut für Cindys HIV-Werte ab, und wir brauchen auch eine Urinanalyse.“ Mehrere Klienten saßen im Wartebereich, und meine Worte waren für alle deutlich zu hören. Cindy, die verletzt wirkte, machte mir leise Vorwürfe. „Sie sollten das nicht so laut sagen.“ Ich war entsetzt. In der „respektablen“ Hausarztpraxis, die ich zwanzig Jahre lang geführt hatte, bevor ich die Arbeit in Downtown Eastside aufnahm, wäre es für mich undenkbar gewesen, eine so unsensible Verletzung der Schweigepflicht zu begehen und jemanden so schamlos in seiner Würde zu verletzen. Ich schloss die Tür und brachte mein Bedauern zum Ausdruck. „Ich war laut“, stimmte ich zu. „Sehr dumm von mir.“ „Ja, das war es“, schoss Cindy zurück, aber etwas besänftigt. Ich dankte ihr für ihre Aufrichtigkeit. „Ich bin es leid, von allen herumgeschubst zu werden“, sagte sie, als sie aufstand, um zu gehen.
Es gibt noch einen tiefer liegenden Grund für das übertriebene Machtungleichgewicht, das die Arzt-Patienten-Beziehung in Downtown Eastside belastet – nicht spezifisch für diese Gegend, aber hier ist es fast durchgängig vorhanden. In den sich entwickelnden neuronalen Netzen des Kindes, das Misshandlung oder Vernachlässigung erfährt, prägen sich Angst und Misstrauen gegenüber mächtigen Menschen ein, insbesondere gegenüber den Betreuern. Mit der Zeit wird dieses tief verwurzelte Misstrauen durch negative Erfahrungen mit Autoritätspersonen wie Lehrern, Pflegeeltern und Angehörigen des Rechtssystems oder der Ärzteschaft verstärkt. Wann immer ich gegenüber einem meiner Patienten einen scharfen Ton anschlage, Gleichgültigkeit zeige oder gut gemeinten Zwang zu ihren Gunsten ausübe, nehme ich unwissentlich die Züge der Mächtigen an, durch die sie vor Jahrzehnten zum ersten Mal verletzt und verängstigt wurden. Was auch immer meine Absichten sind, am Ende rufe ich Schmerz- und Angstgefühle hervor.
Aus all diesen und anderen Gründen schützt Serena instinktiv ihre innere Welt vor mir. Dass sie heute um Hilfe bittet, ist dem Vertrauen geschuldet, das wir zwischen uns aufgebaut haben, aber mehr noch ihrer gegenwärtigen Verzweiflung.
„Gibt es etwas, das Sie mir gegen Depressionen geben können?“, beginnt sie.
„Meine Großmutter in Kelowna starb vor drei Monaten. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, zu gehen, um bei ihr zu sein.“
„Sich umzubringen?“
„Ich bringe mich nicht um, ich nehme nur ein paar Pillen, um …“
„Das ist Selbstmord.“
„So nenne ich es nicht. Nur schlafen gehen … und nicht wieder aufwachen.“
Serena sieht niedergeschlagen und verzweifelt aus. Diesmal ist der Verlust ihrer Großmutter real.
„Bitte erzählen Sie mir von ihr“, sage ich.
„Sie war fünfundsechzig. Sie hat mich großgezogen, seit meine Mutter mich entbunden und das Krankenhaus auf der Stelle verlassen hatte. Der Sozialarbeiter musste meine Großmutter anrufen und sie informieren, dass, wenn sie nicht kommen und entsprechende Papiere unterschreiben würde, ich in ein Pflegeheim gesteckt würde.“ Während des gesamten folgenden Gesprächs klingt Serenas Stimme traurig, erstickt und weinerlich. Ihre Tränen hören nur kurzzeitig auf zu fließen.
„Dann zog sie meine Tochter auf, seit sie ein Jahr war.“ Serena hat ein Kind, das jetzt vierzehn Jahre alt ist und geboren wurde, als Serena selbst fünfzehn war. Serenas Mutter, nun in ihren Vierzigern und ebenfalls eine Patientin von mir, war sechzehn, als sie ihr Neugeborenes verließ. Sie hat jetzt mit ihrem Freund im selben Hastings-Hotel ein Zimmer, in dem Serena wohnt.
„Wo ist Ihre Tochter jetzt?“
„Bei meiner Tante Gladys. Ich denke, es geht ihr gut. Nachdem meine Großmutter gestorben war, fing sie an, Speed zu nehmen und das ganze Zeug …“
„Sie hat mich aufgezogen, auch meinen Bruder Caleb und meine Schwester Devona – eigentlich Cousin und Cousine ersten Grades, aber wir wuchsen wie Geschwister auf.“
„Was für ein Zuhause hat sie Ihnen gegeben?“
„Sie gab mir ein perfektes Zuhause – bis ich wegging, um meine Mutter zu finden. So kam ich hierher, um nach meiner Mutter zu suchen.“ Was diese arme Frau ein „perfektes Zuhause“ nennt, wird erschütternd deutlich, als sie ihre Erzählung fortsetzt.
„Hatten Sie Ihre Mutter vorher noch nicht getroffen?“
„Nie.“
„Hatten Sie vorher schon Drogen genommen?“
„Nicht, bis ich hierher kam, um meine Mutter zu finden.“
Abgesehen von der Bewegung ihrer rechten Hand, mit der sie sich die Augen tupft, sitzt Serena reglos da. Das Sonnenlicht, das durch das Fenster hinter ihr in die Praxis scheint, hält ihr Gesicht in barmherzigem Schatten.
„Ich war fünfzehn, als ich meine Tochter bekam. Er war der Freund meiner Tante, was auch immer. Er hat mich sexuell belästigt und wenn ich etwas gesagt habe, schwor er, meine Tante zu schlagen.“
„Ich verstehe.“
„Maté, Sie glauben mir meine Lebensgeschichte wohl nicht! Alles, was ich Ihnen erzähle, ist wahr.“
„Sie denken, dass ich Ihnen nicht glaube?“
In der kurzen Stille, die folgt, erinnere ich mich daran, wie ich Serena seit diesem erfundenen Bericht über den Tod ihrer Großmutter vor zwei Jahren als Manipulatorin, als Drogensüchtige, nicht mehr ernst genommen habe. Ich bin anfällig für diese menschliche – aber inhumane – Schwäche, Menschen nach der eigenen Bewertung ihres Verhaltens zu definieren und zu kategorisieren. Unsere Vorstellungen und Gefühle gegenüber einer Person verfestigen sich aufgrund unserer begrenzten Erfahrung mit ihnen und auf der Grundlage unserer Beurteilung. Serena wurde von mir auf eine Süchtige reduziert, die mir Unannehmlichkeiten bereitete, weil sie mehr Drogen haben wollte. Ich nahm sie nicht als Mensch war, der unvorstellbare Schmerzen hatte und diese auf die einzige Art und Weise, die er kannte, dämpfen und lindern wollte.
Ich bin nicht immer in diesem blinden Modus gefangen. Mal bin ich drin, mal nicht, je nachdem, wie es mir in meinem eigenen Leben geht. Wenn ich müde oder gestresst bin und vor allem, wenn ich mich in irgendeiner Weise nicht integer verhalte, neige ich am ehesten zu gefühllosen Urteilen und Festlegungen, die meine Sicht auf mein Gegenüber einschränken. In solchen Momenten erleben meine süchtigen Klienten das Machtgefälle zwischen uns am stärksten.
„Ich war fünfzehn, als ich hierher nach Hastings kam“, fährt Serena fort. „Ich hatte fünfhundert Dollar in der Tasche, die ich für Lebensmittel für die Zeit gespart hatte, bis ich meine Mutter finden würde. Ich brauchte eine Woche. Ich hatte noch etwa vierhundert Dollar übrig. Als sie das herausfand, steckte sie mir eine Nadel in den Arm. Die vierhundert Dollar waren in vier Stunden weg.“
„Und das war Ihre erste Erfahrung mit Heroin?“
„Ja.“ Es folgt ein langes Schweigen, nur durchbrochen von den kehligen, weinenden Geräuschen, die Serena zu unterdrücken versucht.
„Und dann verkaufte sie mich an einen verdammten, fetten, riesigen Wichser, während ich schlief.“ Diese Worte äußert sie mit der hilflosen, klagenden Wut eines Kindes. „Sie ist meine Mutter. Ich liebe sie, aber wir stehen uns nicht nahe. Die, die ich Mama nenne, ist meine Großmutter. Und jetzt ist sie fort. Sie war die Einzige, der es etwas bedeutete, ob ich lebe oder sterbe. Wenn ich heute sterben würde, würde sich niemand darum scheren …“
„Ich muss sie gehen lassen. Ich halte sie zurück.“
Serena sieht an meinem Blick, dass ich ihr nicht folgen kann. „Ich lasse sie nicht gehen“, erklärt sie. „In unserer Tradition müssen wir die Geister gehen lassen. Wenn nicht, sind sie immer noch bei uns, stecken fest.“
Ich deute an, dass es für sie wahrscheinlich nahezu unmöglich sein wird, Befreiung zu finden, da sie das Gefühl hat, ihre Großmutter sei die Einzige, die sie je geliebt, akzeptiert und unterstützt habe. „Aber was wäre, wenn Sie jemand anderen finden würden, der Sie wirklich liebt und sich um Sie kümmert?“
„Es gibt keinen anderen. Es gibt niemanden.“
„Sind Sie sich da sicher?“
„Wer denn? Ich selbst? Gott?“
„Ich weiß es nicht. Vielleicht beide.“
Serenas Stimme bricht vor Kummer. „Wissen Sie, wie ich über Gott denke? Wer ist dieser Gott, der die schlechten Menschen leben lässt und die guten Menschen nimmt?“
„Was ist mit Ihnen selbst? Wie steht es mit Ihnen?“
„Wenn ich stark genug wäre, würde ich sie gehen lassen. Ich habe ein Drogenproblem und es fällt mir schwer, mich um mich selbst zu kümmern. Ich habe es schon so oft versucht, Maté. Versucht und versucht. Ich habe schon mal vier, fünf, sechs Monate oder ein Jahr aufgehört, aber am Ende komme ich immer wieder zurück. Dies ist der einzige Ort, den ich kenne, wo ich mich sicher fühle.“ Hier in Kanada, „unserem Zuhause und dem Land unserer Ahnen“, ist die Realität so, dass Downtown Eastside, das von Sucht, Krankheit, Gewalt, Armut und sexueller Ausbeutung heimgesucht ist, der einzige Ort ist, an dem Serena ein Gefühl der Sicherheit hat.
Serena hat in ihrem Leben zwei Orte erlebt, an denen sie sich zu Hause fühlte: das Haus ihrer Großmutter in Kelowna und das eine oder andere baufällige Hotel in East Hastings. „Ich bin in Kelowna nicht sicher“, sagt sie. „Ich wurde von meinem Onkel und meinem Großvater missbraucht, und die Drogen halten mich davon ab, darüber nachzudenken, was passiert ist. Mein Großvater hat meiner Großmutter gesagt, sie solle mir sagen, ich solle zurückkommen und ihm vergeben und alles vergessen. ‚Wenn du nach Kelowna zurückkommst und vor der ganzen Familie darüber reden willst, dann kannst du das tun.‘ Worüber reden, verdammt? Über was? Es ist bereits alles vorbei und erledigt. Es gibt kein Zurück mehr. Er kann es nicht vergessen und ändern, was er mir angetan hat. Auch mein Onkel kann nichts an dem ändern, was er mir angetan hat.“
Der sexuelle Missbrauch begann, als Serena sieben Jahre alt war, und dauerte an, bis sie im Alter von fünfzehn Jahren ihr Kind zur Welt brachte. Während der ganzen Zeit kümmerte sie sich um ihre jüngeren Geschwister.
„Ich musste auch meinen Bruder und meine Schwester beschützen. Ich versteckte sie im Keller mit vier oder fünf Flaschen Babynahrung. Sie trugen noch Windeln. Als ich elf Jahre alt war, versuchte ich meinen Großvater abzuweisen, aber er sagte, wenn ich nicht genau das tun würde, was er will, würde er es auch mit Caleb tun. Caleb war damals erst acht Jahre alt.“
„Oh, Gott“, kommt es aus meinem Mund. Ich denke, es ist ein Segen, dass ich nach all den Jahren, die ich in Downtown Eastside arbeite, immer noch fähig bin, schockiert zu sein.
„Und Ihre Großmutter hat Sie nicht beschützt.“
„Das konnte sie nicht. Sie hat so viel getrunken … Jeden Morgen begann sie schon zu trinken. Sie hat getrunken, bis meine Tochter geboren wurde.“
Jahre später wurde Caleb getötet – von drei Cousins nach einem Saufgelage erschlagen und ertränkt. „Es fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass mein Bruder auch tot ist“, sagt Serena. „Wir standen uns so nahe, als wir Kinder waren.“
Dies war also das perfekte Zuhause, in dem Serena aufgewachsen war, unter der Obhut einer Großmutter, die ihre Enkelin zweifellos liebte, aber völlig unfähig war, sie vor den männlichen Missbrauchstätern in ihrem Haushalt oder vor ihrem eigenen Alkoholismus zu schützen. Und diese Großmutter, die jetzt gestorben ist, war Serenas einzige Verbindung, um tröstende Liebe in dieser Welt zu erhalten.
„Haben Sie jemals mit jemandem darüber gesprochen?“ In Downtown Eastside ist dies fast immer eine rhetorische Frage.
„Nein. Man kann niemandem trauen … Ich kann nicht mit meiner Mutter reden. Wir haben kein Mutter-Tochter-Verhältnis. Wir wohnen im selben Gebäude, wir treffen uns nicht mal. Sie geht direkt an mir vorbei. Das tut mir sehr weh.“
„Ich habe alles versucht. Es hat keinen Sinn. Ich habe so viele Jahre versucht herauszufinden, ob meine Mutter mir nahe sein kann. Und die einzige Zeit, in der sie mir nahe kommt, ist, wenn ich etwas Dope oder Geld in der Tasche habe. Das ist das einzige Mal, dass sie sagt: ‚Tochter, ich liebe dich.‘„
Ich zucke zusammen.
„Das einzige Mal, Maté. Das einzige Mal.“
Ich habe keinen Zweifel, dass, wenn Serenas Mutter über ihr eigenes Leben sprechen würde, eine ebenso schmerzhafte Erzählung herauskommen würde. Das Leiden ist hier generationenübergreifend. Die größte Qual, die fast alle meine Patienten, ob männlich oder weiblich, mir gestehen, ist nicht die Misshandlung, die sie erlitten haben, sondern das eigene Verlassen ihrer Kinder. Das können sie sich niemals verzeihen. Schon die bloße Erwähnung bringt bittere Tränen hervor, und ein Großteil ihres fortgesetzten Drogenkonsums soll die Wirkung solcher Erinnerungen dämpfen. Serena, die hier als das verletzte Kind spricht, schweigt ebenfalls über die eigenen Schuldgefühle gegenüber ihrer vernachlässigten Tochter, die jetzt Crystal Meth konsumiert. Schmerz erzeugt Schmerz. Wer auch immer über eine dieser Frauen urteilen möge, sollte zuerst auf sich selbst schauen.