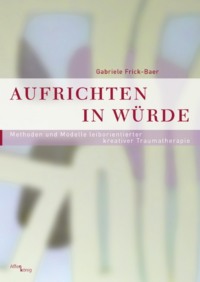Kitabı oku: «Aufrichten in Würde», sayfa 2
2
Das Traumaerleben und seine Folgen
2.1 Spuren und Phänomene
Die Traumatherapie und -begleitung soll und will Heilungsprozesse bei Menschen unterstützen, die an den Folgen traumatischer Erfahrungen leiden. An den Erscheinungsformen dieses Leidens, an dessen Phänomenen, gilt es anzuknüpfen, will man die betroffenen Menschen ernst nehmen. Dabei darf und soll es nicht bei einer Aufzählung der Phänomene bleiben. Die Aufmerksamkeit muss sich auf die Untersuchung der inneren Zusammenhänge zwischen den Phänomenen und dem Erleben der traumatischen Situationen richten. Ich werde die Untersuchung des Traumaerlebens und seiner Folgen damit beginnen, Phänomene darzustellen, mit denen Klient/innen v.a. in der Anfangsphase einer Therapie und dann, wenn sie nicht ausdrücklich wegen ihres Traumas Hilfe suchen, ihr Leiden beschreiben. Ich werde diesen Spuren folgen und von dort aus werde ich Verbindungen zum Erleben der traumatischen Situationen ziehen.
Jedes Phänomen des Erlebens eines Menschen kann in Verbindung mit Erfahrungen sexueller Gewalt stehen und als ein Symptom der Traumafolgen auftreten. Dies ist wichtig zu wissen, um sich immer wieder offen auf die Begegnung mit den Klient/innen einstellen zu können, deren Erleben ernst zu nehmen und deren Kompetenz zu achten. Die Symptomsammlungen des Posttraumatischen Stresssyndroms und anderer diagnostischer Klassifizierungen sind wichtige Hinweise und müssen als Anhaltspunkte herangezogen werden. Gegenüber solchen und ähnlichen Sammlungen ist dennoch Vorsicht angesagt. Selbstverständlich lässt nicht jedes einzelne Symptom auf Erfahrungen sexueller Gewalt oder anderer traumatischer Erfahrungen schließen, auch nicht jede Häufung mehrerer Symptome. Ebensowenig ist das Nicht-Vorhandensein bzw. Nicht-Offensichtliche „klassischer“ Symptome ein Hinweis darauf oder ein Beweis dafür, dass dem betroffenen Menschen keine sexuelle Gewalt widerfahren ist. Zu individuell ist die Verarbeitung biografischer Erfahrungen in jeder Persönlichkeit, zu subjektiv ist jedes Leiden. Symptome geben keine Gewissheiten, sie sind eher Spuren, die zu Fragen und Suchbewegungen Anlass geben.
Es sind gerade am Anfang der therapeutischen Begegnung häufig nicht Symptome des Posttraumatischen Stresssyndroms oder sonstige offenkundige „Traumathemen“ (wie gestörte Sexualität, Flashbacks, Schlaflosigkeit, Ängste …), die im Erzählen der Klient/innen im Vordergrund stehen, sondern oft „harmloser“ und alltäglicher daher kommende Phänomene, die allerdings nichtsdestoweniger im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Trauma stehen und die Qualitäten des Traumaerlebens beleuchten.
Das häufigste, worüber traumatisierte Klient/innen nach meinen Erfahrungen in einem Erstgespräch klagen, ist ihr mangelndes oder fehlendes Selbstwertgefühl. Dies äußert sich im Großen wie im Kleinen, bei besonderen Herausforderungen des Lebens wie im Alltag. Selbstverständlich ist der Umkehrschluss unzulässig, dass mangelndes Selbstwertgefühl immer oder meistens auf traumatische Erfahrungen schließen lässt. Doch auf der Skala der Phänomene, an denen Menschen mit Traumata leiden, scheint mir das geringe Selbstwertgefühl die „Nummer 1“ zu sein. Mögen es manche Klient/innen auch hinter scheinbar selbstsicherem Auftreten oder beruflichem Erfolg verbergen, so ist die Selbstverunsicherung und oft Selbstabwertung doch das, was sie innerlich erleben. Wenn der innere Kampf dagegen und die Anstrengung, diesen Spagat aufrechtzuerhalten, zu groß und zu auslaugend werden, führt dies oft zum Schritt in die Therapie.
Dass das Selbstwertgefühl bei Opfern traumatischer Erfahrungen und insbesondere sexueller Gewalt gemindert und gestört ist bzw. als zerstört erlebt wird, ist nachzuvollziehen. Sexuelle und andere Gewalt gehen über die persönlichen und intimen Schutzgrenzen hinweg und behandeln Menschen als Verfügungsmasse ohne Eigenwert. Etwas davon bleibt in Menschen zurück. Mit den solchen traumatischen Situationen innewohnenden Gefühlen der Hilflosigkeit und Ohnmacht verbunden bleibt das Erleben der Wertlosigkeit zurück.
Das Gefühl der Unverletzlichkeit und Geborgenheit, das behütete Kinder haben und sie im Idealfall auch als Erwachsene als Grunderfahrung durchs Leben begleitet, wird durch sexuelle Gewalt und andere traumatische Situationen brutal gebrochen. Dieser Schock verunsichert und diese Verunsicherung bleibt über die traumatische Situation hinaus. Der innere zentrale Ort, von dem aus Menschen Entscheidungen treffen und Bewertungen, auch Selbstbewertungen, vornehmen, wird zumindest gefährdet, meist geschädigt (s. Kap. 3.2.2).
Oft wirkt diese Schädigung und Verunsicherung so tief, dass Klient/innen mit traumatischen Erfahrungen häufig davon erzählen, dass sie „verrückt sind“ oder „Angst haben, verrückt zu werden“. Dies ist Ausdruck der existenziellen Verunsicherung durch die traumatische Situation, die ja zumeist das Leben und die Lebenssicht der Betroffenen „verrückt“ hat. Dies ist oft auch Ausdruck davon, dass die meisten Betroffenen von Triggern, also meist kleinen (im Sinne von: unauffällig daherkommenden) sinnlichen Eindrücken (ein Geruch, ein Geräusch, ein Blick …), an die traumatische Situation erinnert werden und mit Angst oder Starre, Zorn oder Fluchttendenzen, Zittern oder hoher Erregung, mit dem Erleben, „neben sich zu stehen“ usw. reagieren. Sehr oft vollziehen sich solche Reaktionen unbewusst und bleiben für die Menschen selbst unerklärlich. Die einzige Erklärung, die sie haben, lautet dann: „Ich werde (oder bin) verrückt.“
Ein weiteres häufig angeführtes Phänomen im Vorfeld des traumatherapeutischen Prozesses ist die Schwierigkeit m Umgang mit „Nähe und Distanz“. Gemeint sind zumeist die Schwierigkeiten in sozialen Kontakten und Beziehungen. Das reicht von den Problemen in (Ehe-)Partnerschaften, die sich oft als Lebensarrangements zweier Unerreichbarer darstellen, bis zu den Problemen, sich „überhaupt an andere heranzutrauen“. Manche Menschen sind vereinsamt, andere haben viele Kontakte, ohne dass ihnen die ersehnte Liebesbindung gelingt. „Im Nebel zu sein“, „eine Wand zwischen sich und anderen Menschen zu spüren“, „abgeschnitten zu sein“, eine „Glasglocke um sich herum zu haben“: So oder so ähnlich sind die Bilder, die diesem Erleben Ausdruck verleihen. Auch für dieses Phänomen liegt die Verbindung zum Traumaerleben nahe: Sexuelle Gewalt ist ein Beziehungsakt, eine Beziehungstat. Dieser kann bzw. muss Folgen für das künftige Beziehungserleben haben, unabhängig davon, wie sich die Folgen im Beziehungserleben der Einzelnen äußern. Da die meisten Taten sexueller Gewalt innerhalb der Familie oder von anderen sehr nahe stehenden Personen begangen werden, ist der Bruch des Vertrauens besonders groß – ebenso die Schwierigkeit, wieder Beziehungsvertrauen aufzubauen.
Sich dennoch darum zu bemühen und trotz der Angst, verrückt zu sein, und der oft existenziellen Verunsicherung des Selbstwertgefühls darum zu kämpfen, den Alltag mit Arbeit und manchmal Familie bewältigen zu können, ist anstrengend und macht Druck, großen Druck. Von diesem Druck berichten die Klient/innen häufig in der ersten therapeutischen Begegnung. Sie fühlen sich schwer und angespannt (s. Kap. 3.5) und haben oft jedes Maß für das, was sie leisten, verloren. Was sie leisten, ist nie genug. Sie können sich nie oder nur für kurze Zeit nach Geleistetem oder Erledigtem entspannen, es muss gleich weiter gehen. Sie erleben sich v.a. in Phasen der Tatenlosigkeit als Versager/innen, die zum einen wieder mal nicht alles geschafft haben, was sie hätten schaffen müssen, und zum anderen nicht einmal fähig sind, zu entspannen. Ein erlebter Teufelskreis. Er ist bei Klient/innen mit traumatischen Erfahrungen ein Hinweis darauf, welche Lasten sie oft seit Jahren mitschleppen.
Genauer können sie diese Lasten und ihren Ursprung zumeist nicht benennen. Falls sie den Zusammenhang mit ihrem Trauma überhaupt kennen, so hindert sie doch oft die Scham daran, davon zu erzählen. Auch das Schweigegebot bzw. Redeverbot, mit dem es vielen Täter/innen gelang, die sexuelle Gewalt im Verborgenen zu halten, und die damit verbundenen Drohungen wirken oft nach und lassen verstummen. Auch die Erfahrungen vieler Opfer sexueller Gewalt, dass sie mit dem, was sie erlebt und erlitten hatten, danach oft allein gelassen wurden, sind wirksam und nachhaltig und lassen verstummen. Also bedarf es bei vielen Klient/innen erst des Aufbaus einer vertrauensvollen Beziehung, bis sie von ihren traumatischen Erfahrungen erzählen können.
Das Verstummen führt in den ersten therapeutischen Begegnungen oft zu solchen Äußerungen wie: „Wie es mir geht? Das weiß ich nicht.“ Oder: „Ich weiß nicht genau, was ich hier will.“ Oder: „Ich weiß nicht, was heute Thema ist.“ Wenn ich dann z. B. bitte, das „Ich weiß nicht“ einmal musikalisch mit einem Instrument auszudrücken, und wenn die Klientin oder der Klient nach verwundertem Zögern dies versucht, dann werden oft Spuren dessen hörbar und deutlich, was in der traumatischen Situation dissoziiert wurde. Im traumatischen Erleben sind die Betroffenen oft Unaushaltbarem ausgesetzt. Sie wehren sich dagegen, halten aus, indem sie Teile des Erlebens dissoziieren, aus ihrem bewussten Erleben abspalten (s. Kap. 3.9). Das Unaushaltbare wurde gleichsam begraben – doch die Erde bebt. Sonst wären sie nicht in der Therapie.
Was dieses Beben besagt und was es hervorruft, dafür haben sie keine Worte. Das „Ich weiß nicht“ ist Ausdruck der Dissoziationen und des Zwiespalts zwischen dem Dissoziieren und dem Spüren, „dass da was ist“.
2.2 Traumatische Situationen und Phasen des Traumaerlebens
Das Wort Trauma stammt aus dem Alt-Griechischen und bedeutet „Wunde“. Die Bezeichnung „Trauma“ wird in der Medizin für bestimmte körperliche Wunden benutzt, in Psychologie und Psychotherapie für bestimmte seelische Verletzungen. „In einer ersten Arbeitsdefinition können wir psychisches Trauma als seelische Verletzung verstehen (von dem griechischen Wort Trauma = Verletzung). Wie die verschiedenen somatischen Systeme des Menschen in ihrer Widerstandskraft überfordert werden können, so kann auch das seelische System durch punktuelle oder dauerhafte Belastungen in seinen Bewältigungsmöglichkeiten überfordert und schließlich traumatisiert/verletzt werden.“ (Fischer, Riedesser 1999, S.19)
Neben sexueller Gewalt werden Erfahrungen wie Kriegsereignisse, Tod von Angehörigen, Naturkatastrophen, Unfälle, andere Gewalttaten usw. als traumatische Ereignisse bezeichnet. Jede traumatische Erfahrung wird individuell unterschiedlich erlebt, was allgemeingültige Definitionen nicht einfach macht. Die Forscher des Instituts für Psychotraumatologie definieren ein psychisches Trauma als ein „vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt.“ (Fischer, Riedesser 1999, S.79)
Begrifflich hat es sich für uns als sinnvoll herausgestellt, verschiedene Aspekte zu unterscheiden, die in der Sammelbezeichnung „Trauma“ enthalten sein können:
das Traumaereignis oder die Traumasituation, also in diesem Kontext die Handlungen sexueller Gewalt,
das Traumaerleben, also die Art und Weise, wie ein Mensch sich und seine Welt vor, während und unmittelbar nach dem Traumaereignis erlebt,
die Traumabewältigung, also die Art und Weise, wie der Mensch langfristig sein Traumaerleben bewältigt,
die Traumafolgen, also die Folgen des Traumaerlebens und der Traumabewältigung.
Trauma ist eine subjektive Kategorie und beinhaltet das subjektive Erleben einer Situation. Wesentliche Merkmale des traumatischen Erlebens sind:
Die Situation wird als existenziell bedrohlich erlebt. Was unter „existenziell“ verstanden wird, ist individuell unterschiedlich. „Existenziell bedrohlich“ sind nicht nur Situationen, in denen das Leben bedroht ist (die es allerdings auch sehr häufig gibt), grundlegend bedroht werden kann auch die seelische und soziale Existenz.
Fischer und Riedesser betonen in ihrer Definition die Diskrepanz zwischen der Bedrohung und der eigenen Hilflosigkeit. Das Ohnmachtserleben, das Grundgefühl, einer Gewalt ausgeliefert zu sein, die Erfahrung, in allem, was man tut, unwirksam zu sein, gehört folglich ebenso zum Traumaerleben.
Die Beschädigung des Selbstwertgefühls habe ich in der Beschreibung der Phänomene betont.
Ebenso haben wir dort aufgezeigt, dass die Schutzgrenzen, die die Intimität und Persönlichkeit bewahren, gewalttätig durchbrochen wurden. Jede sexuelle Gewalt ist ein Erleben existenzieller Beschämung.
Das Erfahren sexueller Gewalt ist immer auch eine Beziehungserfahrung. Nähe wird als gewalttätig und grenzverletzend erlebt, Vertrauen wird gebrochen.
Erleben sich Opfer sexueller Gewalt in der traumatischen Situation einsam und allein, so setzt sich das Gefühl, alleingelassen zu sein bzw. zu werden, für viele in der „Zeit danach“ noch fort.
Alle diese Merkmale traumatischen Erlebens müssen nicht für alle Opfer sexueller Gewalt zutreffend sein, für die meisten sind sie es – nach meinen Beobachtungen und Erfahrungen und nach wissenschaftlichen Studien. In letzteren ist der „Zeit danach“ bisher nicht die Bedeutung zugemessen worden, die dieser Phase meiner Meinung nach gebührt. Aufgerüttelt durch Erfahrungen von Klient/innen, deren Aussagen sich in dem Zitat „Das Schlimmste ist das Alleinsein danach“ stellvertretend wiederfinden, habe ich mir die Forschungsaufgabe gestellt, diese Phase genauer zu untersuchen. Über die Ergebnisse Rechenschaft abzugeben, wird einer späteren Veröffentlichung vorbehalten sein. (Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Damit verharmlose oder relativiere ich keinesfalls die Taten der Täter/innen. Ohne die Taten gäbe es keine „Zeit danach“.) Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass die „Zeit danach“ für viele Opfer darüber entscheidet, ob das Traumaerleben bewältigt werden kann oder zu einem nachhaltig bestimmenden Teil der Biografie wird, und dass sie oft über die Nachhaltigkeit des Schreckens und der anderen Folgen entscheidet.
Das Traumaerleben sollte deshalb in drei Phasen unterteilt werden: das Erleben der akuten traumatischen Situation/en der Erfahrung sexueller Gewalt, die „Zeit danach“, in der die Betroffenen getröstet und parteilich aufgefangen werden – oder auch nicht, und die Phase der Traumabewältigung, in der die Betroffenen auf unterschiedliche Weise mittel- und langfristig die Folgen des Traumaerlebens in ihre Lebensmuster integrieren.
2.3 Biologisch-neuronale Prozesse und Folgen für das Erleben und Erinnern traumatischer Erfahrungen
Eine traumatische Erfahrung ist ein Erleben existenzieller Bedrohung. Um solchen Bedrohungen zu begegnen, greifen besondere Mechanismen im Körper, insbesondere im Gehirn. Diese zu verstehen, ist wesentlich, um zu begreifen, auf welche besondere Art das Erleben sexueller Gewalt und anderer Traumata im Gehirn bearbeitet und gespeichert wird. Aus diesen Prozessen ergeben sich wichtige Schlussfolgerungen für das Wiedererinnern und die therapeutische Arbeit. Hier sollen v.a. zwei wesentliche Besonderheiten des Traumagedächtnisses vorgestellt werden (Damasio 2001, Hüther 2001, Roth 2003, 2007, Singer 2002, Spitzer 2002, 2006 u.a):
Die erste Besonderheit besteht darin, dass alle sinnlichen Eindrücke des Menschen auf ihre existenzielle Gefährlichkeit geprüft werden. Dieses jahrtausende alte Prüfprogramm ist entwicklungsgeschichtlich sinnvoll für das Überleben der einzelnen Menschen wie der Gattung Mensch.
Wenn ein Mensch etwas Ungefährliches wie eine Blume sieht, reagiert er anders, als wenn er einem Säbelzahntiger begegnet und es um sein Überleben geht. Alles, was an einen Säbelzahntiger erinnert, mobilisiert die höchste Alarmstufe. Was früher die Geräusche, Gerüche und Spuren der Säbelzahntiger waren, sind heute die Trauma-Trigger.
Neurobiologisch beginnt der Prozess beim Thalamus. Diese Region des Gehirns ist zuständig für die Roherfassung der sinnlichen Eindrücke. Zur genaueren Bewertung und Einordnung leitet der Thalamus sie immer auch an die Amygdala weiter. Die Amygdala ist die existenzielle Wächterin des Gehirns. Sie prüft, ob ein Notfall, eine existenzielle Bedrohung vorliegt. Trifft dies zu, aktiviert sie ein Notfallprogramm.
Das traumatische Erleben ist ein Notfall. Wenn sinnliche Eindrücke über den Thalamus an die Amygdala gelangen, setzt diese Sofortreaktionen in Gang. Wer über die Straße geht und plötzlich ein herannahendes Auto hört, versucht wahrscheinlich, zur Seite zu springen. Dies geschieht, bevor er das Signal eingeordnet hat. „Flight“ oder „Fight“ werden die spontanen, durch die Amygdala hervorgerufenen Reaktionen genannt.
Wie kann die Amygdala solch ultraschnelle Reaktionen bewirken? Sie umgeht den Hippocampus, worin die zweite Besonderheit besteht. Der Hippocampus integriert üblicherweise die vom Thalamus neu eintreffenden Erfahrungen zeitlich, räumlich und emotional mit den Erinnerungen der Neocortex (dem neuronalen Speichersystem, der „Festplatte“) und schafft ein inneres Bild, aufgrund dessen ein Mensch handeln kann und das er abspeichern kann. Normalerweise hilft steigende emotionale Erregung, den Hippocampus zu stimulieren. An den ersten Kuss werden sich noch viele Menschen erinnern. Doch wird in der extremen Notfallsituation die Erregung außergewöhnlich hoch, wird der Hippocampus ausgeschaltet und umgangen. Wenn ein Mensch vom Säbelzahntiger bedroht wird, werden viele organische Funktionen, die nicht unmittelbar zum Überleben notwendig sind, abgeschaltet oder reduziert. Die genauen Umstände des Angriffs des Säbelzahntigers sind ebenso unwichtig wie sein Alter oder die Zahl seiner Barthaare.
Diese Kurzschlussreaktion führt dazu, dass die Amygdala autonom das vegetative System aktiviert und damit das gesamte Stressprogramm mobilisert, von der Adrenalinausschüttung bis zum Herzrasen. Gleichzeitig stellt die Amygdala unmittelbar Verbindungen zur Neocortex her. Die Folge ist, dass in solchen Situationen oft gar kein zusammenhängendes Bild hergestellt wird, an das sich der betroffene Mensch später erinnern kann. Um eine solche Erinnerung zu schaffen, hätte der Hippocampus aktiv sein müssen. Es bleiben in der Erinnerung der Amygdala und teilweise des Neocortex nur Fetzen, Fragmente, Bruchteile der Erinnerung, ein Geruch, die Erregung, Aktionen des vegetativen Nervensystems usw. Die fehlenden bzw. nur in Bruchstücken vorhandenen Erinnerungen, über die traumatisierte Menschen oft klagen, sind Ergebnis dieses Prozesses.
Nun kann nach einer Notfallsituation oft der Hippocampus reaktiviert werden und aus den Bruchstücken ein erinnerungsfähiges Bild zusammensetzen. Doch ist die Situation der meisten Opfer sexueller Gewalt oder anderer traumatischer Ereignisse von besonderer Hilflosigkeit und Überforderung gekennzeichnet (s. auch Kap. 3.9). Sie können weder kämpfen noch fliehen – also geraten sie in die Falle traumatischer Überforderung. Die Reaktion darauf ist „Freeze“ und „Fragment“. Das Traumaerleben wird „eingefroren“ in der Dauererregung und den anderen Symptomen des Posttraumischen Stresssyndroms (PTSD), das Erleben und die Erinnerung daran bleiben fragmentiert. Die Nacharbeit des Hippocampus gelingt jedoch bei einigen Opfern nicht, bei denen, die unter den Folgen des PTSD leiden. Vor allem nicht bei Menschen, die Multitraumata erlebt haben.
Die Opfer sexueller Gewalt und anderer Traumata, die kein erinnerungsfähiges Bild konstruieren können, können jedoch über körperlich-sinnliche Erinnerungen angesprochen werden: „Ist die Erinnerung an die traumatische Situation verloren oder fragmentiert, so repräsentieren traumatische Reaktionen bzw. Prozesse diese Erfahrung als implizite Erinnerung, auf der Ebene des Körpergedächtnisses.“ (Fischer/Riedesser 2003, S.119) In bildgebenden Verfahren wird bei experimentell herbeigeführten Flashbacks deutlich, dass das Broca-Areal als motorisches Sprachzentrum in seiner Aktivität unterdrückt wird, während der Bereich, dessen Schwerpunkt im bildhaften Speichern von Emotionen und Sinneseindrücken liegt, „besonders aktiv (ist). Dieser Befund erklärt, warum viele Traumatisierte das Geschehen oft nur bildhaft wiedererleben, nicht in Worte fassen können und von einem Zustand wortlosen Entsetzens (speechless terror) berichten.“ (a.a.O., S.123) Diese spezifische Art neurobiologischer Traumaverarbeitung macht die erste große Schlussfolgerung aus diesen Erkenntnissen zwingend: Traumatherapie muss Körper- und Sinnesgedächtnis ernst nehmen und ansprechen und auf der Ebene der Bilder, der Klänge und der Körpererfahrungen arbeiten.
Die verschiedenen Fragmente des Traumaerlebens, die gespeichert sind, können als Trigger das traumatische Erleben reaktivieren. Sie müssen neu integriert und umgewandelt werden, um diese Kraft zu verlieren bzw. zu verringern. Um dem Traumaerleben heilend zu begegnen, in welcher Phase der Therapie auch immer, wird es oft notwendig sein, sich den Erinnerungen mit all dem damit verbundenen Schrecken zu stellen. Solche Erinnerungen sind nicht gegeben, sondern werden in dem Prozess des Erinnerns neu geschaffen (Schauer, Nenner, Elbert 2003). Erinnern ist immer auch Neu-Erinnern. Die neuronalen Vernetzungen des erinnerten Geschehens werden neu aktiviert. Das ist der Schrecken, der Schmerz der traumatischen Erinnerung. In dieser Neuaktivierung werden sie jedoch nicht in dem Gehirn von damals geschaffen, sondern in dem Gehirn des heutigen Zeitpunkts, mit Boden und Beziehung, mit größerem Selbstbewusstsein und helfender Unterstützung. Diese neuen Bedingungen, diese veränderte Umgebung des Erinnerns kann die Erinnerung verändern, was wir in der Traumabewältigung aktiv angehen. Nicht die erlebte „alte“ Erinnerung wird anschließend wieder gespeichert, sondern die neue, die veränderte Erinnerung. Forscher sprechen deshalb von der „Transformation der traumatischen Erinnerung“ in der Traumatherapie (Peichl 2001, S. 151).
Auch dann, wenn Opfer zusammenhängende Geschichten des Traumaereignisses erzählen können, sind immer auch Dissoziationen und Fragmentierungen des Erlebens vorhanden, ist das Traumaerleben nicht vollständig integriert, was natürlich nur dann ein Problem ist, wenn Menschen darunter leiden. Bei der Bewältigung dieser Integration ist in der Therapie das nachzuholen, was dem Opfer unmittelbar nach dem Ereignis nicht möglich war. Der entscheidende Unterschied zu dieser Situation, die durch Hilflosigkeit, Einsamkeit und dem Dilemma, weder zu „Fight“ noch „Flight“ in der Lage zu sein, gekennzeichnet war, besteht in der therapeutischen Beziehung: Das Opfer ist nicht mehr allein, nicht mehr hilflos, nicht mehr überfordert, es bekommt Unterstützung, sich aus der Erniedrigung aufzurichten.
Die Psychotrauma-Forscher kennzeichnen zusammenfassend das Trauma als „unterbrochene Informationsverarbeitung und als unterbrochene Handlung“. Die zweite große Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen, besteht darin, den Prozess in Handlung und Informationsverarbeitung – im geschützten Setting der therapeutischen Beziehung – so auf der Erlebensebene fortzusetzen, dass die Unterbrechung aufgehoben und in einen Prozess der Aufrichtens und der Erfahrung von Unterstützung überführt wird.