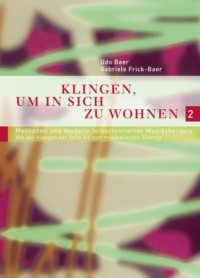Kitabı oku: «Klingen, um in sich zu wohnen 2», sayfa 3
13.2 Heilgesänge und -lieder
Eine besondere Form aktiven Symbolisierens in der Musiktherapie sind Heilgesänge. Gesänge, die auf eine heilende Wirkung abzielen, gibt es vermutlich schon so lange, wie Menschen singen. Es gibt eine jahrhunderte-, vielleicht jahrtausendelange reichhaltige Tradition indianischer, schamanischer und sakraler Heilgesänge, deren Überreste sich in den Liturgien des Christentums und anderer Religionen wiederfinden.
Der Kern des Heilgesangs besteht in dem Bemühen, manchmal auch Versprechen, über das Singen bestimmter Melodien und Texte konkrete heilende Wirkungen hervorzurufen. Die Form des Singens ist unterschiedlich. Sehr verbreitet sind gemeinsame Gesänge, daneben gibt es Sologesänge von Heilern, weniger verbreitet auch von Kranken. Es gibt ferner die Tradition des Besingens, in der gerichtet auf eine Person, die der Heilung bedarf, gesungen wird. Häufig wird die heilende Wirkung des Gesanges über die Anrufung höherer Mächte angestrebt.
Heilgesänge als Methode des aktiven Symbolisierens, so wie wir sie im Folgenden vorstellen wollen, sind nicht religiös. Religiöse Auffassungen der TherapeutInnen, die gebunden sind an eine bestimmte Glaubensgemeinschaft, dürfen unserer Meinung nach nicht Gegenstand und Inhalt musiktherapeutischen Handelns sein. Selbstverständlich aber können und sollen, manchmal sogar müssen religiöse und spirituelle Themen Gegenstand und Inhalt der therapeutischen Prozesse sein, wenn KlientInnen sie einbringen, sei es als Faktor des Leidens oder als Ressource, die Heilung unterstützen kann. Insofern sind die Heilgesänge, von denen wir hier sprechen, nicht religiös, können aber individuell religiös bzw. spirituell gefüllt werden. Heilgesänge in unserem Sinne haben auch nichts gemein mit einer therapeutischen Hausapotheke:
Man nehme diesen Gesang gegen Bulimie und jenen gegen Angststörungen … Heilgesänge sind ein Weg, auf dem KlientInnen klangliche Ausdrucksformen finden und entwickeln können, die sie über den therapeutischen Rahmen hinaus nutzen und die nachhaltige heilende Effekte bewirken können. Aus der Vielfalt der Möglichkeiten, Heilgesänge musiktherapeutisch einzusetzen, wollen wir fünf kurz vorstellen:
Eine Klientin leidet an chronischen Schmerzen vor allem in den Schultergelenken. Sie hat Wege der Atementspannung ausprobiert, die ihr gut tun und schmerzreduzierend wirken. Sie liegt auf dem Rücken und entspannt mit jedem Ausatemzug ihre Körpergelenke nacheinander ein wenig mehr. Zur Vertiefung lässt sie ab und zu einen Heilgesang entstehen. Dazu horcht sie während des Entspannungsprozesses nach innen und versucht, ihren besonderen Ort der Kraft, wie sie ihn bezeichnet, zu erkennen. (Manche nennen ihn auch den Ort der Heilung oder finden ähnliche für sie passende Begriffe. Manche nehmen ihn unmittelbar als Klangquelle wahr, andere eher als Bild.) Aus diesem Ort lässt sie nun einen Klang entstehen und wiederholt ihn immer wieder und wieder langsam im Rhythmus des Atmens. Nun entwickelt sich aus diesem Ton ein Wort oder ein Satz, den die Frau wiederholt singt.Hier entsteht ein Heilgesang aus der Körperentspannung und Körperwahrnehmung. KlientInnen, die diesen Weg wählen, finden nach zweimaligem oder dreimaligem Durchgang zumeist einige eigene Schlüsselworte oder Schlüsselsätze, auf die sie bei späteren Heilgesängen zurückgreifen können.
Fast jeder Mensch hat in seiner musikalischen Biografie Lieder gehört, die auf ihn heilend und zumindest lindernd gewirkt haben. Vielleicht hat die Mutter zur Linderung und zum Trost das Kinderlied „Heile, heile Gänschen“ vorgesungen oder das gemeinsam gesungene Kirchenlied „Eine feste Burg ist unser Gott“ gab Kraft und Zuversicht. In der musikbiografischen Arbeit können solche Ressourcen erschlossen werden und teilweise wiederentdeckt werden. Zahlreiche KlientInnen sind von den nachhaltigen Wirkungen überrascht, wenn solche Lieder durch den Therapeuten oder die Therapeutin gesungen werden oder wenn sie selbst solche verschütteten musikalische Erinnerungen wiederbeleben.
Der dritte Weg des Heilgesangs besteht darin, Helfer zu schaffen, die musizieren. Ein Beispiel aus einer Gruppenarbeit:„Stellt euch vor, ihr habt einen persönlichen Helfer oder eine Helferin.Ich z. B. denke an den kleinen Helfer von Daniel Düsentrieb. Vielleicht kennen einige von euch diese Micky-Mouse-Figuren? Daniel Düsentrieb war jedenfalls Ingenieur und sein kleiner Helfer versuchte, seine Pannen und Verrücktheiten im Zaum zu halten oder zu reparieren.Wie eure Helferfigur aussieht und wofür ihr sie braucht, könnt nur ihr wissen:Vielleicht ist sie groß oder klein …, vielleicht liegt sie, geht sie, kniet sie …, vielleicht ist sie ein Mensch, ein Tier oder eine Fantasiefigur … Stellt sie euch vor, malt sie euch innerlich aus …Dann horcht auf diese Helferfigur, wie sie Musik macht, wie sie für euch musiziert. Vielleicht singt sie, vielleicht spielt sie auf einem Instrument, vielleicht beides …Horcht so gut hin, dass ihr das, was sie singt oder musiziert, erfassen könnt und in euch aufnehmt …Sucht euch nun einen Ort, an dem ihr selbst die Klänge eurer Helferfigur erklingen lasst …“Anschließend kann man eine andere Person aus der Gruppe bitten – oder sich in der Einzeltherapie als Therapeut oder Therapeutin selbst anbieten – die Klänge der Helferfigur dann für die oder den anderen singend zu spiegeln und damit eine konkrete Helferfigur zu sein. Die Wirkung dieser Heilgesänge liegt dann in ihrem Hörbar- und Erhörtwerden, in der heilenden Resonanz zweier Menschen.
Ein Klient litt unter großen Ängsten, die ihn beunruhigten und in denen er sich über längere Zeiträume verfing. Er begann zu singen: „Ich brauche keine Angst zu haben.“ Später änderte er den Satz in: „Ich bin groß und kräftig.“ Diesen Satz sang er vor sich hin, so, wie Kinder im Wald pfeifen, um die Angst zu vertreiben. Er sang ihn nicht einmal, sondern mehrmals und er erzählte: „Wenn ich das mindestens zehn Minuten lang singe, dann helfe ich mir, dann geht meine Angst weg. Zumindest verzieht sie sich in den Hintergrund und ich kann mich wieder orientieren und ausatmen und schauen, was ich brauche und was mir gut tut.“Ein solches Vertrauen in die Wirkungskraft seines gesungenen Satzes erinnert an Mantras, also bestimmte tibetanische Liedzeilen, die wiederholt gesungen werden. Hier ist es nicht so sehr der Text (der nicht unwichtig ist, dem aber an dieser Stelle keine mystische Bedeutung zukommt), sondern die Wiederholung und der Trost, der im laut werdenden Wiederholen enthalten ist.
Die letzte wichtige und häufige Form sind Reinigungsgesänge. Sie sind in der Musiktherapie besonders dann notwendig, wenn Menschen sich z. B. durch Erfahrungen des Missbraucht-Werdens (nicht nur körperlich, sondern auch emotional oder geistig) und der sexuellen Gewalt, des Ausgeliefertseins und der Fremdbestimmung verunreinigt, beschmutzt oder vergiftet fühlen. „Singe für dich und vor dich hin und reinige und wasche dich mit deinem Gesang.“, oder: „Dusche dich mit deiner Stimme.“, sind Aufforderungen, die vielleicht zunächst etwas absurd oder verrückt klingen, aber die erstaunlichsten Klänge und Wirkungen der Selbsthilfe hervorrufen.Wenn die Not nicht so groß ist und eher die Lust am Sich-Reinigen im Vordergrund steht oder KlientInnen etwas Altes abstreifen, sich wie eine Schlange „häuten“ wollen, damit etwas Neues entstehen kann, dann birgt die folgende Variante des Reinigungsrituals und -gesangs gute Chancen:Man kann sich selbst oder die Körperperipherie abstreifen, abrubbeln, abkribbeln, abreiben oder andere TeilnehmerInnen einer Gruppe – so wenig oder so viel, wie man möchte – bitten, das zu tun. Entscheidend ist, dass die andere Person oder die anderen Personen währenddessen singen.
14
Wort und Klang
14.1 Der Klang der Sprache
Nehmen Sie, wenn Sie mögen, Ihr Lieblingsgedicht und lesen Sie es sich laut vor. Lauschen Sie dem Klang der Sprache. Ihnen wird vermutlich auffallen, dass diesem Text ein eigener Klang, vielleicht eine Melodie, ein Rhythmus innewohnt. Lyrik ist in unseren Ohren klingende Sprache. Lyrik spielt mit den Wortbedeutungen, mit grammatikalischen Sinnzusammenhängen, spielt aber auch mit den klanglichen Qualitäten der Wörter und Wortzusammenhänge – kurz: Lyrik komponiert Sprache.
Wer dies überprüfen möchte, kann für sich selbst oder mit TeilnehmerInnen einer Gruppe folgendes Experiment durchführen:
„Suchen Sie ein Gedicht oder eine Gedichtzeile aus, die Ihnen etwas Besonderes bedeutet. Vielleicht weist dieses Gedicht auf ein Gefühl hin, das für Sie gerade wichtig ist, oder auf eine Lebenserfahrung, die in Ihnen nachhallt.
Lesen Sie dieses Gedicht mehrmals laut vor und lauschen Sie dem Klang des Vorgelesenen …
Und begleiten Sie jetzt den Text mit einem Rhythmusinstrument …
Nun versuchen Sie, diesen Text zu singen, ihm eine Melodie zu geben …
Spielen Sie mit diesem Text musikalisch, versuchen Sie ihn musikalisch auszudrücken, ganz gleich, ob sie dabei die Worte begleiten oder mittlerweile den Text hinter sich lassen und nur das Klangbild, die klangliche Essenz des Gedichtes oder der Gedichtzeile vertonen.“
In der Therapie bilden weniger Gedichtzeilen oder andere lyrische Texte den Ausgangspunkt eines ähnlichen Experimentes, sondern eher ein eigener Text bzw. Bedeutungssätze einer Klientin oder eines Klienten. Unter Bedeutungssätzen verstehen wir, wie die Bezeichnung sagt, Sätze, die im Gespräch eines Klienten oder einer Klientin als bedeutungsvoll hervorstechen. Häufig sind das das Leben grundsätzlich bestimmende Sätze wie z. B.: „Immer komme ich zu kurz.“, „Ich habe ja nie eine Chance.“, oder „Immer ich. Ich bin immer schuld.“ Oder es handelt sich um Sätze der Selbstabwertung wie: „Immer mache ich alles falsch“, „Ich bin im Grunde ein Versager.“, oder „… eine Mogelpackung“ oder „… eine Zumutung“ oder „wäre besser gar nicht geboren“. Diese Sätze zu verklanglichen und damit hervorzuheben, herauszuheben aus ihrer selbstverständlichen und unüberprüften Existenz, ist oft ein Anfang, ihnen an Bedeutungskraft zu nehmen oder sie zumindest zu relativieren. Oft reicht es nicht, wenn KlientInnen bestimmte Aussagen für sich als falsch erkennen, es braucht das Gegenteil, die Gegenformulierung. Deshalb arbeiten wir häufig damit, dass wir die KlientInnen bitten, zu solchen Sätzen Gegen-Sätze zu bilden, individuelle Sätze, die auf diese negativen Bedeutungssätze antworten. Solche Gegenteilsätze können z. B. sein: „Ich habe das Recht geliebt zu werden.“, „Ich bin daran schuld, dass …, aber ich bin nicht daran schuld, dass …“ oder „Ich habe Mut.“ Einen solchen Gegenteilsatz zu formulieren, fällt vielen KlientInnen schwer. Noch schwerer fällt es ihnen, diesen Satz auch laut auszusprechen. Ist diese Hürde erst einmal genommen, hilft es häufig, diesen Satz auch durchzukauen, ihn zu singen, ihn zu rhythmisieren, ihn in verschiedenen Tonhöhen und Lautstärken auszusprechen etc. Dadurch wird der Satz angeeignet, erhält er eine eigene Färbung.
Der Klang der Sprache kann von großer Bedeutung für den therapeutischen Prozess sein, auch ohne dass Sätze oder Textbestandteile Ausgangspunkt sind. „Jede Stimme ist einzigartig in ihrer Zusammensetzung und Nutzung der musikalischen Bausteine:
Der Rhythmus, in dem eine Stimme spricht, das Pausieren oder Fließen der Stimme, ihre Abruptheit und ihre großen Bögen.
Die Dynamik, mit der eine Stimme spricht, die Zurückgenommenheit oder Vordergründigkeit der Stimme, ihr Poltern, Bellen, Lärmen oder ihr Wispern, ihre Verhaltenheit, ihre Zärtlichkeit.
Der Klang, die Fülle oder Enge, Dichte oder Dünnheit, mit der eine Stimme immer auch Nähe oder Distanziertheit ausdrückt, ihre Dumpfheit oder Helligkeit, ihre Belegtheit oder Klarheit.
Ihre Melodie, zwischen monotoner Rezitationsstimme oder in großen, dramatischen Melodiebögen sich entwickelnd, zwischen winzigen Ausschlägen nach oben und unten, in Höhen und Tiefen schwankend, zwischen Schlichtheit oder verzierender Überladenheit, dem ‚Pathos’ einer Stimme.“ (Decker-Voigt 1999, S.159)
Wenn wir KlientInnen zuhören, vernehmen wir nicht nur die Worte, sondern lauschen auch dem Klang ihrer Sprache und lassen ihn auf uns wirken. Die Unterschiede der Sprachklänge können frappierend sein. Auffallen kann z. B.:
Ein Klient erzählt monoton im immer gleich bleibenden Rhythmus, ganz gleich ob es sich um eher belanglose Ereignisse handelt oder aufregende Dinge – im Klangbild der Sprache wird keine Gewichtung vorgenommen.
Manche KlientInnen singen ihr gesprochenes Wort. Wenn man ihnen mit geschlossenen Augen lauscht, hört man Melodien unterschiedlichen Charakters, die differenzierte Reaktionen hervorrufen.
Ein Klient nutzte die Lautstärke seiner Stimme als Barometer seines inneren Erlebens. Je aufregender es wurde, je mehr seine Erregung in die Höhe stieg, je mehr sein Herz betroffen wurde, desto leiser wurde er.
Eine Klientin erzählte und erzählte, die Therapeutin vernahm vor allen Dingen die Kraftlosigkeit im Klang ihrer Sprache. Diese rief stärkere Resonanzen in ihr hervor als die Wortaussagen. Als sie ihre Resonanz mitteilte und fragte: „Kann es sein, dass Sie keine Kraft mehr haben?“, stimmte die Klientin zu. Ihre Hauptaussage bestand nicht in den Worten, sondern im Klang ihres Erzählens.
Häufig fallen Diskrepanzen zwischen einem dramatischen Inhalt und einem monotonen, sachlichen Klangbild auf oder umgekehrt zwischen relativ beiläufigen Geschehnissen, von denen erzählt wird, und einem Klangbild des Erzählens, das einer dramatischen Verdi-Oper entspricht.
Solche und viele andere Wahrnehmungen lassen nie konkrete Schlüsse in Bezug auf die KlientInnen zu, sie gehören aber zu den leiblichen Phänomenen, die seitens der MusiktherapeutInnen Beachtung finden sollten. Musiktherapie beginnt nicht erst, wenn Instrumente erklingen oder gesungen wird. Musiktherapie beginnt, wenn einer Sprache und ihren Klängen gelauscht wird und gleichzeitig den Resonanzen, die sich aus diesem Lauschen ergeben, Respekt erwiesen wird.
14.2 Vom Gespräch zum Musizieren
Bestandteil der Musiktherapie ist auch das Sprechen. Musiktherapie ist besonders geeignet, das Unsagbare hörbar werden zu lassen und das Unerhörte zu hören. Musiktherapie kann insbesondere Menschen erreichen, die sich sprachlich nicht oder nur beschränkt ausdrücken können. Und gleichzeitig ist es für die meisten KlientInnen wichtig, für das musizierend Erlebte auch Worte zu finden. Rosemarie Tüpker sagt deshalb zu Sprache und Musik: „Die musiktherapeutische Behandlung bedarf des Austausches von Musik und Sprache. (…) Musiktherapie ist daher kein ‚non-verbales Verfahren’.“ (Tüpker 1996, S.228f) Und sie fügt hinzu, dass dies natürlich nur für die Arbeit mit den Menschen gilt, die nicht auf sprachliche Artikulation verzichten müssen.
Vor einigen Jahren haben wir von frisch ausgebildeten MusiktherapeutInnen die Klage gehört: „Wir kennen uns ganz gut damit aus, wie wir mit Klientinnen und Klienten Musik machen. Wir können uns auch mit Klientinnen und Klienten unterhalten. Aber an den Übergängen hapert es. Wie kommt man aus dem Gespräch ins Musizieren? Und wie redet man anschließend über das Musizierte?“ Diese Klage hat uns deutlich gemacht, dass solche Übergänge nicht selbstverständlich sind, sondern der besonderen Beachtung und Übung bedürfen. Wir haben in diesem Buch an verschiedenen Stellen versucht, dem Rechnung zu tragen, und hoffen, sowohl in methodischer Hinsicht als auch in den Praxisbeispielen etliche Anregungen gegeben zu haben. Dennoch wollen wir hier einige zentrale Gesichtspunkte dieser Übergänge zusammenfassend darstellen. Ausdrücklich weisen wir hier noch einmal darauf hin, dass dem Gespräch, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, schon Aspekte des Musizierens innewohnen, dass man Gesprächen auch klanglich lauschen kann, der eigenen Stimme und denen der anderen, dass also die Kluft zwischen dem Sprechen und dem Musizieren oft gar nicht so groß ist, wie angenommen wird.
Grob zusammengefasst praktizieren wir vier Hauptwege, um aus dem Gespräch ins Musizieren zu gelangen:
Der erste Weg ist einfach: kein Gespräch, nur die Aufforderung oder Absprache zu musizieren. Mit manchen KlientInnen ist keine Möglichkeit der Verständigung gegeben, außer, dass man, wenn man sich begegnet, zu Musikinstrumenten greift und improvisiert. Mit anderen gibt es Vereinbarungen oder sind Rituale entstanden, etwa dass zu Beginn einer jeden therapeutischen Einheit gemeinsam musiziert wird und sich aus diesem gemeinsamen Musizieren Themen, Fragestellungen, Begegnungen etc. ergeben.Häufig gibt es für die Aufforderung zur Improvisation, allein oder gemeinsam, einen Anlass. Ein Anlass muss noch kein Thema sein, ein Thema kann sich daraus ergeben. Ein Anlass kann sein: „Ich möchte, dass wir uns kennen lernen. Vielleicht machen wir dies, indem wir gemeinsam musizieren.“ In vielen Gruppen- oder Einzeltherapien ist die Improvisation der KlientInnen oder das gemeinsame Musizieren der KlientInnen und TherapeutInnen der gegebene Einstieg.
Der zweite Weg ist der Weg über ein Thema (s. a. Kap. 15.3). Ein Thema kann im musikalischen Ausdruck lebendig, erlebbar und veränderbar werden. Manchmal bringen KlientInnen ein Thema mit: „Ich habe mich tierisch über meinen Freund geärgert …“ – „Haben Sie Lust, diesen Ärger zu musizieren?“ Oder ein Thema ergibt sich im Gespräch: ein Beziehungsproblem zur Therapeutin oder zum Therapeuten, ein altes Muster, ein verborgenes Gefühl, das hörbar werden möchte, usw. Fast alle methodischen Darlegungen in diesem Buch enthalten solche Beispiele. Ob dann eine freie Improvisation angeboten wird oder eine differenzierte Methode wie musikalisches Verraumen, ein musikalischer Dialog, ein Ständchen, hängt vom Thema und dem konkreten Stellenwert innerhalb des therapeutischen Prozesses ab. Auch „kein Thema“ kann ein musiktherapeutisches Thema sein. Eine Klientin kommt z. B. mürrisch in die Therapie. Auf die Frage, wie es ihr geht, zuckt sie mit den Schultern. Auf die Frage, ob sie ein Thema mitgebracht hat, schüttelt sie den Kopf. Auf die Frage, ob sie Lust hat zu musizieren, verneint sie. Die Therapeutin schlägt vor: „Gehen Sie zu den Musikinstrumenten und spielen Sie: Ich habe kein Thema und möchte gar nicht hier sein.“ Dieser Vorschlag ist für die Klientin so absurd und offensichtlich gleichzeitig so passend, dass sie lächeln muss, zur Concertina greift und loslegt.
Der dritte Weg: Im Gespräch tauchen häufig Schattenthemen oder Themenschatten auf, auf die die TherapeutInnen hören und die sie ernst nehmen sollten. Werden sie von den KlientInnen musikalisch ausgedrückt und damit hörbar, stecken in ihnen wichtige Erlebnisqualitäten. Zum Beispiel reden KlientInnen manchmal davon, dass ihnen etwas „komisch“ vorkommt oder dass etwas „in der Luft hängt“. Oder die TherapeutInnen spüren eine Atmosphäre, eine nicht greifbare Stimmung. All solche vagen, zunächst nicht konkretisierbaren leiblichen Regungen rufen für uns nach musikalischem Ausdruck. Das gilt auch für therapeutische Prozesse, in denen wir nur am Rande musiktherapeutisch und eher gestaltungs- oder tanztherapeutisch arbeiten. Auch dann ist die Musik, das Musizieren in den meisten Fällen das geeignete Mittel, die Stimmung, die Atmosphäre, die therapeutische Beziehung, das, was „komisch“ ist, das „Nebelige“ und „Diffuse“ hörbar werden zu lassen. In diesem Prozess des Hörbar-Werdens konkretisiert es sich, verdichtet es sich zu Themen, zu Wünschen, zu Problemen, zu Beziehungsaspekten usw. Dann, wenn es konkretisiert ist, kann es auch in Zusammenhänge gestellt und verändernd angegangen werden.
Der vierte Weg besteht im Aufgreifen von musikbezogenen Gesprächsfetzen. Unsere Sprache ist teilweise auditiv ausgerichtet. KlientInnen erwähnen: „Ich glaube, ich höre nicht richtig“, oder erzählen, dass die Stimme der Mutter „bedrohlich“ klang. Hier „haken“ wir gerne ein und sagen: „Dann lassen Sie doch bitte einmal diesen Klang hörbar werden, wie klang die Stimme der Mutter?“ Wenn ein Klient erzählt, er fühle sich „durchgeschüttelt“, können wir ihn bitten, dieses Schütteln mit einem Schüttelinstrument erklingen zu lassen.
Der Boden für alle Wege, für alle Übergänge vom Gespräch ins musiktherapeutische Arbeiten, ist und bleibt, glauben wir, Interesse und Präsenz und der Leitspruch: Die Klientin/den Klienten ernst nehmen und sich selbst ernst nehmen, Mut zu unkonventionellen Wegen, zum Suchen und Ausprobieren, Vertrauen in die Resonanz und in die KlientInnenkompetenz – und Übung, Übung, Übung.