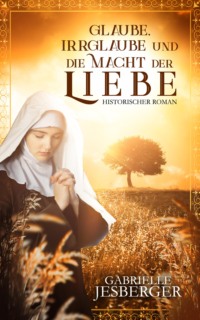Kitabı oku: «Glaube, Irrglaube und die Macht der Liebe», sayfa 5
Anna war nun mehr als eine Mitschwester. Sie war Mutter für alle in der klösterlichen Gemeinschaft. Mit großer Hingabe erfüllte sie ihre neue Aufgabe und doch schlich sich trotz ihrer langen Gebete in ihrer Zelle am Abend auf ihrem Betstuhl - und vor allem wenn sie anschließend im Bett lag - manchmal der Gedanke ein: Wie würde wohl heute mein Leben aussehen, wenn Mutter mich nicht ins Kloster geschickt hätte? Sicher wäre ich verheiratet und hätte eine Familie. Denn die Erinnerungen an ihre Geschwister und an ihre Kindheit bewahrte sie wie einen Schatz in ihrem Herzen. Sie hatte einen starken Willen und damals längst im Stillen eigene Pläne entwickelt. Sobald wie möglich wollte sie das Elternhaus verlassen, in die nächste Stadt gehen und sich eine Arbeit in einem angesehenen Haus suchen. Am liebsten wollte sie sich um die Kinder dort kümmern und sie umsorgen. Das war auch lange ihre Aufgabe zuhause gewesen. Doch ihr war ein ganz anderes Schicksal zugedacht. Damals hatte sie nicht gewagt, mit ihren Eltern offen darüber zu reden.
Ihr Weg schien ihren Willen zu beugen, sie zum Gehorsam zu zwingen. Mit ihrem wachen Geist und ihrem empathischen Wesen harrte sie aus und hatte sich nach und nach in die Ordensgemeinschaft eingefügt, die nach den Regeln des heiligen Benedikts sich in den Dienst der Menschen stellte. Wie er, sahen die Klosterschwestern ihren Alltag nicht beherrscht vom Fasten, denn ein Übermaß der Askese führe oft zur Selbstüberhebung. Ihr Kloster sollte ein Ort der Freude sein. Zwar führten sie in ihrer Gemeinschaft ein beschauliches Leben in Klausur hinter Klostermauern, die aber längst nicht so hoch und unüberwindbar waren, wie viele glaubten und das fröhliche Lachen der Frauen war oft zu hören. Mit den Jahren war Anna zu einem wesentlichen Mitglied dieser Klostergemeinschaft geworden. Und ebenso war sie immer mehr überzeugt, eine höhere Macht habe durch die Entscheidung der Eltern sie zu ihrem Lebensweg auserwählt. Mit dieser Erkenntnis war ein Friede in ihr eingezogen, der durch eine innere Gelassenheit und Ruhe sie unweigerlich ihrem Amt als Äbtissin zugeführt hatte.
In den Klostergarten, der von einer Mauer umschlossen war, führte eine kleine Pforte. Prächtige Obstbäume, üppige Blumenstauden und duftende Kräuter empfingen die Eintretenden. Dort hielt Lucinde sich am liebsten auf. Zita, deren verwundete Pfote inzwischen geheilt war, lag im Schatten der Nachmittagssonne unter dem alten Apfelbaum, eng an sie geschmiegt die Katze, die bereits trächtig war, als sie ihnen vor einiger Zeit zugelaufen war. Ihr weißes Fell mit schwarzen und rötlichen Flecken glänzte im Schattenspiel der Sonnenstrahlen, die durch das Blattwerk fielen. Auf einem Ast des alten Apfelbaumes sah die Mutter ihren Schützling sitzen, völlig selbstversunken in die eigene Welt. Gerade biss Lucinde herzhaft in eine rotbackige Goldparmäne und baumelte fröhlich mit den Beinen.
Als Lucinde aufschaute und die Äbtissin von weitem kommen sah, rief sie: „Mutter, hast du schon gesehen, wie schwer die Äste heuer von den vielen Äpfeln sind?“ Dann hielt sie überrascht inne. Wen hält unsere Mutter denn da an der Hand? Als die beiden näher kamen, begegneten sich die Blicke der Mädchen und gleichzeitig überzog eine solche Freude ihre Gesichter, wie bei einem Wiedersehen nach einer langen Trennung. Vom ersten Augenblick an waren sie innig vertraut. Agnes war ein neuer Schützling, in die Obhut der Klosterschwestern geschickt, um eines Tages den Schleier zu nehmen und das ewige Gelübde abzulegen. Lucinde wurde eine liebevolle Freundin, geduldige Lehrerin und Beschützerin der kleinen Agnes, die doch nur zwei Jahre jünger war. Vollkommen selbstverständlich entfaltete sich in Lucinde durch das Mädchen ein fürsorgliches mütterliches Wesen. Die Äbtissin konnte ihr Agnes anvertrauen. Sie wusste, Lucinde war intuitiv mit einem mütterlichen Urwissen verbunden, wie vom Geist aller weiblichen Ahnen durch die Dunkelheit der Jahrhunderte geleitet. Agnes war in den besten Händen.
Bald jauchzte auch Agnes begeistert, wenn sich ein Vogel in ihrer Nähe im Haselbusch niederließ. Die Aufmerksamkeit und Hingabe, die Lucinde allen Wesen in der Natur schenkte, teilten inzwischen alle Mitschwestern und oft rief eine nach Lucinde, wenn sich gerade ein Eichhörnchen im Garten einfand oder ein Igel sich verirrt hatte. Wenn Lucinde und Agnes mit Zita durch den Garten tollten, gesellte sich auch gern die alte Schwester Adelgunde zum Fangenspielen dazu, bis sie ganz außer Atem war und lachend aufgab.
„Agnes, komm ich muss dir etwas zeigen!“, rief Lucinde, nahm ihre Hand und zog sie in den hinteren Garten. „Schau, dort im Baumloch der alten Eiche sitzt eine kleine Meise. Oben auf dem Ast hockt die Mutter und lockt das Vogelkind, damit es lernt zu fliegen.“ Leise setzten sich die beiden Freundinnen ins Gras und schauten zu. Die junge Meise piepste ängstlich und trippelte hin und her. Doch der unermüdliche Lockruf der Mutter ermutigte das Meisenkind. Endlich breitete es die Flügel aus und bewegte sie flatternd, gab aber wieder auf. Erst beim nächsten Versuch flog es tatsächlich bis zum nächsten Ast und drehte erwartungsvoll sein Köpfchen zur Mutter. Nach einer Weile wagte sich das nächste Vögelchen neugierig aus dem Nest.
Lucinde verband noch einen anderen Gedanken damit, als die Pflege, wenn sie sich um den Kräutergarten kümmerte. „Der liebe Gott lässt für jede Krankheit ein Kraut wachsen!“, behauptete sie immer wieder, wenn sie gefragt wurde, warum sie so emsig die Kräfte und Geheimnisse der Natur erforschen würde. Und bald wuchs im Klostergarten kein Kraut, dessen Abbildung sie nicht in ihren Heften bereits naturgetreu nachgezeichnet hatte. Sie wagte Experimente mit Heilessenzen, die zugleich die Seele nähren sollten, erklärte Lucinde. Und bald holten die Menschen im ganzen Umkreis für die Kranken ihre Heilmittel, die symbolhaft sind für die ewigen Zyklen des Werdens, Vergehens und Neuwerdens auf dieser Erde. Sie sind damit eine heilsame Substanz für einen gesunden Schlaf und das gestärkte Wiederaufwachen nach einer erholsamen Nacht, stellte Lucinde fest.
Sie achtete darauf, wann der Mond ihr die rechte Zeit zum Sammeln der Kräuter und Blüten anzeigte. Sie trocknete die Blätter und Blüten, zerkleinerte Wurzeln, Samen und Rinden, mischte, rührte und brühte auf und bewahrte ihre Medizin in Gläsern auf, die sie beschriftete: „Anis, Fenchel, Brennesseln, Holunderblüten, Süßholzwurzeln, Thymian, Lindenblüten, Heidelbeeren stand auf den Gläsern. Täglich kamen neue dazu und Agnes half ihr gern dabei. Eifrig führte Lucinde Buch über das, was ihre Mitschwestern ihr über die Wirksamkeit berichteten. Neuerdings verarbeitete sie Mohnsamen zu einem Schlaf- oder auch Betäubungsmittel für den Fall, dass eine Operation vorgenommen werden musste.
„Ich will alles aufschreiben in meinem Buch, was wir hier in unserem Kloster über Ursachen und Behandlung von Krankheiten mit natürlichen Heilmitteln herausfinden, damit es auch später allen Hilfesuchenden zur Verfügung steht!“, erklärte Lucinde auf die Fragen. “Wir dürfen nicht das Leben, die Gesundheit und das Leiden der Menschen in unserer Betrachtung loslösen von allen Zusammenhängen. Wir sind in der Welt und die Welt ist in uns. Jedes Geschöpf, die ganze Natur, der Kosmos steht in Zusammenhang mit uns. In allem ist die Schönheit der Schöpfung in wundersamer Vollendung. Und alle Elemente und Kräfte der Natur stellen ihren Dienst zu unserem leibseelischen Wohl zur Verfügung.“
Hin und wieder schlug auch Schwester Adelgunde interessiert das Buch auf. Von ihr hatte Lucinde schon viele Rezepte übernommen, die sie noch von ihrer Mutter kannte: Bei Völlegefühl und Krämpfen hilft eine Teemischung aus Anis, Kümmel, Fenchel, Pfefferminze, Kamille und bei einer fieberhaften Erkältung Lindenblüten. „Leid dringd Bibernell, doann stäibd ijä ned sou schnäll!“ (Leut trinkt Bibernell, dann sterbt ihr nicht so schnell.), zitierte Schwester Adelgunde mit erhobenem Zeigefinger ihre Mutter.
Dass Lucinde seit jeher begabt schien, in Kontakt zu treten mit höheren kosmischen Gesetzmäßigkeiten, war inzwischen für keine Mitschwester mehr etwas Neues und doch zeigte sie immer wieder einen verblüffenden Einblick in andere Sphären und Seinsebenen. Selbst die schwierigsten wissenschaftlichen und weltpolitischen Themen sah sie aus einem multidimensionalen Blickwinkel. Und ihre Gleichnisse und Erkenntnisse überraschten ihre Mitschwestern immer wieder. „Im Universum ist nichts kompliziert. Die Menschen sind es, die es kompliziert machen. Die Erde ist die Schule und das Universum die Hochschule“, war ihre Antwort.
„Mutter, da war heute eine Stimme in mir, die sagte: Die Grundenergie des ganzen Universums ist Liebe und die Grundschwingung unserer Erde ist weiblich, aber das verstehe ich nicht.“ Hilflos zuckte Lucinde mit den Schultern. „Jetzt denk ich doch schon seit Stunden darüber nach. „Lucinde, wir dürfen dabei nicht an einen Mann oder eine Frau denken, wenn wir weiblich oder männlich hören. Wir können uns vorstellen, dass es um Eigenschaften oder Kräfte geht. So können in einer Frau ebenso männliche und in einem Mann weibliche Energien sein. Seit dem Tag unserer Geburt sind wir mit diesem Gesetz der Erde verbunden. Doch die Sehnsucht nach unserer geistigen Heimat, nach der Einheit bleibt in uns und leitet uns auf unserem Weg in diesem Leben.“
„Gott ist unseren irdischen Gesetzen, in der alles dual existiert, wie Tag und Nacht, nicht unterworfen, daher ist er weder männlich noch weiblich. Er ist die Einheit. Oder wir können auch sagen, er ist die Liebe. Und diese Liebe ist unsere geistige Heimat, von der wir kommen und zu der wir wieder gehen am Ende unseres Lebens hier auf dieser Erde. Diese geistige Heimat ist immer ein Teil von uns, auch in unserem vergänglichen Leben. In uns Menschen, in der ganzen Natur um uns herum ist beides: Das Sterbliche, weil unser Körper vergeht und das Unsterbliche, weil es Ewigkeit bedeutet. Daher gilt im Jenseits nicht das Gesetz der Erde, denn das bedeutet lediglich die Vergänglichkeit unseres Körpers. Viele Menschen haben das allerdings vergessen.“ „Mutter, dann müssen wir es ihnen sagen. Ist es nicht dumm, zu glauben, dass es nur dieses eine Leben hier gibt?“ Wieder einmal wurde die Äbtissin sehr nachdenklich.
Lucinde war immer noch nicht zufrieden: „Mutter, was sind denn nun die weiblichen und die männlichen Kräfte?“ „Das weibliche Prinzip ist vor allem Hingabe, es ist empfänglich und passiv. Zu dem Weiblichen zählt man auch das Kreative, Strömende. Das männliche Prinzip ist vor allem Struktur, es ist haltend und aktiv. Dazu zählt man auch das Kämpferische, das Leistungsorientierte.“ Lucinde dachte lange nach: „Dann kann es doch nur so sein“, fragte Lucinde, „dass um uns herum das weibliche Prinzip zu gering und zu schwach ist, sonst dürfte jetzt doch kein Krieg sein?“ „Ja, mein liebes Kind, da kannst du recht haben, jedes Ungleichgewicht führt zu Konflikten. Deshalb gerade ist unsere Aufgabe in unserem Kloster so wichtig“, antwortete die Mutter ernst.
Erst 1631 wurde Würzburg massiv in das Kriegsgeschehen hineingezogen.
Nach der schweren Niederlage der kaiserlichen Truppen lag dem Schwedenkönig der Weg in die katholischen süddeutschen Gebiete offen. Im Oktober wechselte das mehrheitlich protestantische Schweinfurt zu den Schweden über. Daraufhin flohen Bischof Franz von Hatzfeld, die Schüler des Priesterseminares und die Jesuiten mit vielen anderen aus der Stadt.
Das 16. und der Anfang des 17. Jahrhunderts waren für das Mainzer Oberstift Zeiten wirtschaftlicher Blüte. Das nach der Gegenreformation Julius Echters rein katholische Hochstift Würzburg gehörte zur Liga. Dadurch blieb es in den ersten Jahren des Dreißigjährigen Krieges ohne spürbare Beeinträchtigung und von unmittelbaren Kampfhandlungen verschont. Für das Bündnis mussten allerdings hohe Geldleistungen aufgebracht und Truppenkontingente gestellt werden. Gustav Adolf stieß rasch mit seinem Heer zum Main und bis zur Grenze des Hochstifts Würzburg vor. Im Oktober 1631 erschien er auf seinem Siegeszug durch Deutschland mit seinen Truppen vor Würzburg und nahm es vier Tage später im Sturm. Von den schwedischen Truppen war unter Androhungen von Grausamkeiten Einlass in die Stadt gefordert worden. Der Rat war jedoch dem geflohenen Landesherren verpflichtet und bat um vier Tage Aufschub, um dessen Entscheidung einzuholen. Dennoch drangen die Schweden in die wenig befestigten Vorstädte ein. Sie plünderten ihre reich ausgestatteten Kirchen, Klöster und Spitäler.
Erfolglos versuchte der Rat, Bedingungen für die Übergabe der Stadt zu stellen. Da man sich einer Belagerung durch die 26.000 Schweden nicht gewachsen sah, war die Stadt zur Kapitulation gezwungen und öffnete mit Billigung der fürstbischöflichen Regierung die Tore. Gustav Adolf zog mit seinen Truppen ein und besetzte die Stadt. Unter erheblichen Verlusten wurde die Festung Marienberg gestürmt. Hier erscholl zum ersten Mal in den Gassen der Racheschrei „Magdeburger Pardon!“, als die schwedischen Soldaten die Besatzung niedermachten.
Die berühmte Bibliothek Julius Echters, die fürstliche Silberkammer, die Archive und Kleinoden verschiedener Stifte und Klöster wurden Beute des Schwedenkönigs und seiner Soldaten. In der Folgezeit waren die Würzburger weiteren Plünderungen, Morden und anderen Gräueltaten ausgesetzt. Zudem mussten immer wieder neue massive Kontributionszahlungen geleistet werden. Tilly konnte den Vormarsch der Schweden auch im folgenden Jahr nicht aufhalten.
Bereits seit 1631 hatte Gustav Adolf Pläne, den Kurstaat Mainz, zu dem weite Teile des Taunus- und Maingebietes zählten, in ein weltliches Territorium unter schwedischer Herrschaft umzuwandeln. Im November setzte Gustav Adolf eine königliche Landesregierung ein, die Hochstifte Würzburg und Bamberg wurden schwedische Erblehen und im Juni 1633 dem einflussreichen General im schwedischen Heer, Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar, als Herzogtum Franken geschenkt. Dieser errichtete 1634 in Würzburg die königlich schwedische und herzoglich sachsen-weimarische „Zwischenregierung“. Beim Kampf um das Elsass und Breisach, bei dem der Herzog von Frankreich finanziell und mit einem Heer unterstützt wurde, entging dem französischen König nicht, dass Bernhard selbst ein Auge auf das Elsass geworfen hatte. Mit Schmeicheleien und der trügerischen Hoffnung, Bernhard könne sogar Kaiser werden, versuchte Ludwig ihn um den Finger zu wickeln.
Obwohl Bernhard unmittelbar die Festung mit neuen Bastionen versehen ließ, fiel Würzburg im selben Jahr durch General Piccolomini wieder an die kaiserlichen Truppen. Bischof Hatzfeld kehrte zurück und die verbliebenen schwedischen Besatzer zogen von der Festung ab. Die kaiserlichen Truppen setzten der Stadt und ihren Einwohnern jedoch nicht weniger zu, als zuvor die Schweden. Zuletzt mussten die Würzburger im Winter 1647/48 nochmals bayrische Truppen beherbergen. Am Ende waren die meisten der Vermögenswerte, wie auch Kirchenschätze, geplündert oder für Kriegszahlungen verwendet. Die Bevölkerungszahl hatte sich auf 5.000 halbiert.
Am 11. November 1631 besetzte Gustav Adolf Hanau, am 22. Aschaffenburg. Das beherzte Auftreten des Kapuzinerpaters Bernhard rettete die Stadt und das Schloss vor der Plünderung und Zerstörung. Als Gustav Adolf sich mit seiner Armee der Stadt näherte, waren die weltlichen Behörden geflohen, die Stiftsherren nach den Niederlanden, die Jesuiten nach Frankreich. Nur die Kapuziner blieben, trösteten die Zurückgebliebenen und halfen, wo es nötig war. Pater Bernhard ging mit einigen Getreuen über die Mainbrücke, wo schon die schwedischen Regimenter herbei stürmten.
Der schwedische König ritt majestätisch - aufrecht wie eine Säule - auf seinem Schimmel. Die goldenen Sporen glänzten in der Sonne, sein rotblonder Vollbart endete in einer Spitze unter dem Kinn und verlieh ihm eine pompöse Erscheinung. An seiner Brust funkelte eine goldene Kette, an der - in Gold gefasst - ein großer schwerer Türkis hing. Dicht neben ihm blies Magnus als erster laut und gebieterisch die Trompete zu den Trommeln, die ihren Einzug schon von der Ferne ankündigten.
Mit zitternden Knien ging der tapferere Mönch auf den König zu und überreichte ihm auf einem silbernen Teller die Schlüssel der Stadt. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen, schaute dem König fest in die Augen, schilderte die Angst der Bürger und bat um eine gnädige Behandlung. Gustav Adolf, der das Schloss schon im Auge hatte, um es seinen Regimentern zur Plünderung zu überlassen, beeindruckte die Tapferkeit des frommen Mannes. Durch seine klugen und besonnenen Worte konnte der Mönch die Stadt und auch das Schloss vor der Zerstörung retten. Beherzt lud er den Schwedenkönig sogar in sein Kloster ein. „Vergesst nie, Aschaffenburg fand Gnade vor uns um dieses Mannes willen!“, rief Gustav Adolf mit einer weit ausholenden Bewegung seiner Arme, dass sein blauer Umhang wie ein majestätisches Segel im Herbstwind flatterte.
Zwei Wochen später zog er in Frankfurt am Main ein, dem verfassungsmäßigen Mittelpunkt des Heiligen Römischen Reiches und der Krönungsstadt der Kaiser. Die Ratsherren wollten sich vor dem Einmarsch mit dem Kurfürsten von Mainz besprechen, doch der Schwedenkönig rief gebieterisch: „Jetzt, da ich Aschaffenburg erobert habe, bin ich der Kurfürst von Mainz!“ Aschaffenburg, wo des Kurfürsten herrliches Schloss stände, habe ihm gehuldigt. Außerdem habe er Schlüssel, die jede Stadt aufschließen würde, nämlich seine Kanonen. Er berief seinen Kanzler Oxenstierna, die Verwaltung der eroberten Gebiete zu übernehmen und erklärte ihm, im Krieg müsse man sich nach der Gelegenheit richten. Er brauche Geld und das habe er hier in Frankfurt gefunden. Am Rhein und am Main könne er noch mehr auftreiben. Der Bürgermeister setzte es dennoch durch, dass keine schwedische Besatzung in die Stadt gelegt wurde, außer 600 Mann in die Vorstadt Sachsenhausen.
Die protestantischen Prediger im Land verkündeten weiterhin, der schwedische König sei wie der Heiland, der dem Lazarus zugerufen habe: „Steh auf und wandle!“ So werde sich das arme gekreuzigte Volk, das erwürgte und begrabene Römische Reich auf sein Wort wieder erheben und in neuer Jugend und Schönheit ausbreiten. Die Kurfürsten wären wie Wölfe, die das eigene Vaterland in Stücke reißen. Sein Kanzler Oxenstierna zuckte die Achseln: „Der deutsche Adel hat die Großmannssucht. Er gleicht den Jungfrauen, die in Dreck und Mist baden, um eine reine Haut zu bekommen.“ Der König dürfe ihnen nicht trauen und müsse auch mal die Peitsche zeigen.
Während auch der Domprediger in Magdeburg vor der Ankunft des Schwedenkönigs ihn mit dem Einzug Jesu in Jerusalem verglichen hatte, zitterten die Menschen in den katholischen Gegenden vor diesem Herrscher. „Ein Held ist einem Feuer gleich, das einen Wald oder eine Steppe ergreift und unersättlich rast, bis es alles Lebendige gefressen hat und dann sich selbst verzehrt“, erklärte Gustav Adolf seinem Kanzler. Oxenstierna runzelte die Stirn und schwieg.
Während der Kriegszeiten wurden für Freund und Feind die Schwedensignale zum Inbegriff psychologischer musikalischer Kriegsführung. Das Signal des schwedischen Reiterregiments war bald in der ganzen Gegend bekannt. Bereits 1632, als Gustav Adolf bei seiner Durchreise am Main entlang in Hanau übernachtet hatte, ließ er alle umliegenden Wege besetzen. Jeder Hügel erhielt eine schwedische Wache.
Wenn das Schmettern der Trompeten zu hören war, wussten auch die Feinde, es war das Signal zum Angriff. Am Abend unterhielten sie das Heerlager mit alten Weisen aus ihrer Heimat. Vor allem der König verlangte am Ende des Tages nach seinem Trompeter Magnus, der ihn auf seinem Zug durch Deutschland auf Schritt und Tritt begleitete. Unter allen Hoftrompetern hatte er ihn ausgewählt, weil Magnus die Trompete blasen konnte, wie kein anderer.
Seine Trompete hatte eine längliche Bügelform mit drei parallel laufenden Röhren, die durch halbkreisförmig gebogene Rohrstücke verbunden waren. Auf dieser neuen Trompete, die er perfekt beherrschte, konnte er vor allem in höheren Lagen mehr Töne erzeugen, obwohl sie schwerer zu blasen war.
Als der Schwedenkönig mit seinen Truppen von Würzburg über Miltenberg und Aschaffenburg Richtung Mainz zog, fingen auch für Obernburg am Main die furchtbaren Bedrängnisse an. Der Schwedenkönig verlangte Einlass und ein Quartier mit seinen Generälen im Gasthaus Krone. Die Landsknechte, ihre Begleitungen und die Pferde mussten bei den Bürgern unterkommen. Der Bürgermeister hatte Gustav Adolf eine hohe Summe als Tribut und später eine weitere Summe an die Besatzungsmacht zu zahlen. Geistesgegenwärtig reagierte ein Ratsschöffe, als er einem übereifrigen Bürger, der gerade auf einen schwedischen Offizier schießen wollte, die Waffe im letzten Augenblick aus der Hand schlug. Die Stadt wurde verschont.
Auch der gefürchtete Reichskanzler des Königs, Oxenstierna (im Volksmund Ochsenstern genannt) bezog einen Monat später in der Krone Quartier. Der grauhaarige Kanzler sprach deutsch und gesellte sich gerne am Abend zu den Bürgern an den Tisch im Gasthaus. Obwohl der König seinem Rat vertraute, meinte er eines Tages: „Alle Menschen müssten erfrieren, wenn sie so kalt wären wie er.“ Worauf Oxenstierna erwiderte: „Sie würden alle verbrennen, wenn sie so hitzig wären wie der König.“ Gustav Adolf zog ins Pfarrhaus und ließ sich die besten Speisen und Weine vorsetzen.
Später, nach dem Westfälischen Frieden, erinnerten sich die schwedischen Soldaten an das Quartier in Obernburg und General Löwenhaupt kam mit 600 Reitern nochmal herein galoppiert. Diesmal verlangte er einen Endtribut in Form von Lebensmitteln, wie Fleisch, Eier und Wein, die sie als reichliche Verpflegung mitnahmen.
Obwohl die Obernburger Stadtkasse auch für die besetzten Nachbarorte zur Schonung Kontributionen zu zahlen, Geiseln auszulösen oder Schmiergeldzahlungen zu leisten hatte, kam es zu Plünderungen und Zerstörungen durch das Kriegsvolk. Pferde zertrampelten Felder, Wiesen und hinterließen Dreck und Abfall. Unsägliches Leid durch Hunger entstand, wenn Ernteerträge geraubt, Saatgut verfüttert und Wintervorräte geplündert wurden. Hunger, Kälte und Krankheiten rafften viele Einwohner dahin. Von 190 Familien am Anfang des Krieges blieben am Ende nur 84 übrig. Allerdings profitierte auch so mancher Wirt von den Einquartierungen und Verköstigungen, denn die Wirtsleute ließen sich ihre Dienste bezahlen, so dass sie nach dem Krieg besser situiert waren als andere total verarmte Bürger.
Auch wenn in den ersten Kriegsjahren bis 1631 die Region des Spessarts noch nicht in die Kriegshandlungen einbezogen war, vollzog sich doch allmählich ein Wandel. Eine Gesellschaft, die zuvor nur regionale Konflikte kannte, wurde für nahezu zwei Jahrzehnte Austragungsort eines länderübergreifenden Konflikts. Hunger und Seuchen hatten bereits seit Beginn des Hungerjahres 1622 durch die schlechten Ernten die Bevölkerung dezimiert. Die Frucht war am Halm verfault, das Vieh in den Ställen den Seuchen zum Opfer gefallen und das Brot knapp geworden. Nun waren Truppendurchmärsche von Freund und Feind an der Tagesordnung.
Eine ganze kosakische Armee des Kaisers belagerte mit 12.000 Mann Heubach. In der Würzburger Gegend waren sie bekannt für ihre Brutalitäten. Zwar kämpften die Söldner für den Kaiser, aber nach ihren eigenen Gesetzen, die häufig verbunden waren mit Plünderungen, Brandschatzungen und Morden.
50 ihrer Reiter fielen in Eschau ein, brachen die Kirchentüre mit Brechstangen auf, raubten den Kelch und was ihnen sonst noch in die Hände fiel. Sie jagten die Menschen durch die Gassen, schlugen und stachen sie mit ihren Hellebarden und schossen auf sie mit ihren Musketen. Das Vieh trieben sie aus den Ställen, Keller und Speicher durchwühlten sie nach Brot, Fleisch und Wein. Und wenn sie nichts mehr fanden, quälten sie die Menschen mit grausamen Folterungen, um zu erfahren, wo sie ihre Wertsachen versteckt oder vergraben hätten. Den alten Pfarrer Speiser führten sie gefesselt über den Kirchplatz und marterten ihn, bis er auf Befehl das alte Kirchenlied „Erhalt uns Herr bei deinem Wort“ sang.
In seinem Gefolge brachte der Krieg Teuerungen, Hungersnöte und die Pest, die als ausgerottet galt und unzählige Opfer forderte, wieder zurück. Dies blieb auch für den Spessart nicht ohne Folgen.
In Eschau wurde der „Zehnt“ an die Grafen von Erbach entrichtet, in Sommerau an die Fechenbacher. Es galt das Mainzer Landrecht, das durch die „ungeteilte Erbfolge“ bestimmt war. Das bedeutete, dass seit undenklichen Zeiten kein Gut teilweise übergeben werden durfte. Als Fronbauer musste auch Amor Fries - wie alle anderen Bauern nicht nur in Eschau und Sommerau, Hobbach und den umliegenden Dörfern - seinen Zehnt von jeder Ernte entrichten. Entweder in Form des Naturalzinses oder bei einem Viehverkauf in Gulden. Amor war der Verwalter des Kellerhofes der Fechenbacher und als Fronbauer Holzfuhrwerker für den Grafen. Er besaß etwa drei Huben (eine Hube = ungefähr 1 Morgen und entspricht 10.000 qm) und war damit Hofbauer in Sommerau. Es war allgemein üblich, dass der älteste Sohn das Erbe übernahm und für die Eltern und noch nicht verheirateten Geschwister sorgte.
Vermögend konnte keiner werden, die Bevölkerung wurde ausgebeutet, nur um den Wohlstand der Grafen zu gewährleisten. Alle Bürger waren auf gute Ernten angewiesen, damit sie ihre Familien ernähren konnten. Der Unmut gegen die oberen Herrschaften wuchs.
Nach seinem Einzug ins Frankenland hatte Gustav Adolf strenge Regeln für sein Heer aufgestellt. Raub und Plünderungen sollten in den protestantischen Gemeinden vermieden werden. Die katholischen Städte und Dörfer dagegen wurden nicht verschont.
Die Bewohner Eschaus hatten als Protestanten zunächst nichts zu befürchten und konnten die Durchzüge der schwedischen Truppen mit Gelassenheit über sich ergehen lassen.
Groß dagegen war die Angst vor der Pest, von der auch der Spessart im Schwedenkrieg nicht verschont blieb und der Bevölkerung großes Unheil brachte.
1635 erreichte die Seuche ihren Höhepunkt und löschte ganze Familien aus. In der Not wurden große Gruben gegraben und ohne Sarg eilig die Verstorbenen gemeinsam verscharrt. Fast vor jedem Haus war ein Strohwisch aufgestellt, als Zeichen, dass drinnen die Seuche wütete. Beinahe täglich war das Sterbeglöcklein zu hören. Die Not verwandelte die Menschen. Das Elend wurde zu einer Hoffnungslosigkeit, zu einer dumpfen Lethargie, die auch noch den letzten winzigen Funken Lebenskraft zu ersticken drohte.
In ihrer Verzweiflung griffen die Menschen auf alte Heilmittel und auch Rituale zurück, die sie von ihren Vorfahren übernommen hatten. Bei schweren Erkrankungen ließ man sich „brauchen“: Dazu lautete bei einer Augenerkrankung der Spruch: „[…] ich gebiete dir, geh aus dem Auge, vom Auge in die Ader, vom Fleisch in den Wald, dass du keinem Menschen noch Vieh mehr schaden kannst.“ Eine Krankheit wurde als ein böser Dämon angesehen, der als unwillkommener Gast im Menschen wohnte und ausgetrieben werden musste. Und zwar möglichst weit fort in die Wälder, wo er kein Unheil mehr anrichten konnte.
Auch Eschau wurde vom Hunger und der Pest heimgesucht, die ganze Haushalte auslöschte und erst aufhörte, als man mit Hilfe der Schweden einen neuen Brunnen baute. Als Ursache für die Verbreitung sah man den Dorfbrunnen, aus dem das sogenannte „bläuliche Pestwasser“ floss. Vermutlich war er durch Fäkalien verseucht. Man hatte einen neuen Brunnen gegraben, aber aus diesem und auch dem nächsten floss nur das krankmachende Wasser. Schließlich ging man in äußerster Verzweiflung daran, es nochmal mit einem tieferen Aushub zu versuchen. Nur noch wenige Bürger lebten, als man das Vorhaben schon aufgeben wollte.
Da zogen die ersten Schweden ins Dorf, eine ganze Kompanie. Weil sie im protestantischen Dorf willkommen waren und einige Zeit bleiben wollten, packten sie mit an. Schon bald floss reines frisches Wasser. Das Plätschern klang wie ein Versprechen: „Jedz wäddd alles widdä bessä!“ (Jetzt wird alles wieder besser.), ging es von Mund zu Mund. Doch die Sorge um die alten Brunnen war nicht vergessen. So riet der schwedische Hauptmann, einen Schwedenkopf aus der steinernen Säule zu hauen. „Der Schwed wird von unserem Herrgott geliebt und vom Teufel gefürchtet!“, rief er mit selbstherrlicher Miene aus.
Im benachbarten Sommerau schaute der Schlossherr täglich aus dem Fenster und zählte die noch rauchenden Schornsteine, zuletzt waren es nur noch drei. Die Pest hatte so schrecklich gewütet, dass die Schweden das katholische Nachbardorf mieden.
Das Sommerauer Schloss, das im Bauernkrieg teilweise niedergebrannt war und danach wieder aufgebaut wurde, war nun von den Schweden erneut teilweise bis auf den Wehrturm zerstört worden. Die Pfarrei Sommerau und Hobbach musste vom Mönchberger Pfarrer mitbetreut werden, da das Sommerauer Pfarrhaus nach der Plünderung, wie in vielen umliegenden Pfarreien, leerstand. Das Kirchengut war geraubt, die Pfarrhäuser verwaist, jeder konnte ein- und ausgehen.
Auch in dieser traurigen Zeit wurde es Weihnachten. Seit einer Woche schon lag eine dicke Schneedecke auf Feldern und Wiesen. Die Armeen im Land zogen sich in ihre Winterquartiere zurück. Es schien, als ob nun der Himmel alle Schmach, mit der die Erde beladen war und die die Menschen durch den Krieg erleiden mussten, zudecken wolle. Die weiße Landschaft legte mit ihrem Zauber einen Frieden auf die Erde, der die Herzen wieder mit Hoffnung erfüllte. Und doch war dieser Friede, den die Winterlandschaft verkündete, allzu trügerisch.
„Friede auf Erden den Menschen“, verkündete Pfarrer Speiser in Eschau vor einem Häuflein seiner Pfarrgemeinde. In Sommerau hielt Pfarrer Brand für eine kleine Gruppe, zu der in der Nacht sich die wenigen Eichelsbacher und Hobbacher zu Fuß gesellten, die Christmette. Ein Messdiener schwenkte eifrig den Weihrauchkessel. (Nicht umsonst wurden in Pestzeiten die Häuser der Wohlhabenden mit einer Mischung aus Weihrauch, Thymian und Salbei ausgeräuchert.)
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.