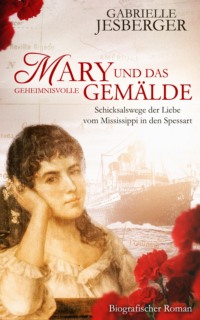Kitabı oku: «Mary und das geheimnisvolle Gemälde», sayfa 3
Im Laufe des Krieges wurde Lilos Mann so schwer verwundet, dass er lange in Lebensgefahr schwebte und zuletzt nur - wegen noch nicht verfügbarer Antibiotika - durch die Amputation eines Beines gerettet werden konnte. Nach seinen vorhergehenden Verwundungen (Streifschuss im Genick, Gehörschädigung, Teillähmung der Hand) war er nun zu hundert Prozent kriegsversehrt. Seine Kameraden meinten scherzhaft, aber bewundernd, er sei wohl mit dem „Teufel im Bunde“, dass er dem Tode so oft entronnen sei. Die Zertrümmerung seiner beiden Knie war seine fünfte Verwundung, die die Amputation des linken Beines bis über das Knie zur Folge hatte. Nun wurde Willi als Oberstleutnant zum Kompanie-Chef der ersten Panzergrenadier-Ausbildung ernannt und als Hauptmann mit seiner Kompanie in der Kampfgruppe Schwarzrock bei Forst an der Neiße zur Abwehr der Russen eingesetzt. Dort wurde er schon am zweiten Tag beim Überfahren einer Panzermine verwundet, die irrtümlich von einer Panzer-Abwehr-Kompanie verlegt worden war. Er kam in ein Lazarett in Schleswig und von dort in die englische Gefangenschaft, wo er nach drei Monaten wieder entlassen wurde. Im Mai 1942 wurde ihm das Deutsche Kreuz in Gold und einen Monat später das Verwundeten-Abzeichen in Gold verliehen.
Das Brüderchen des dreijährigen Wolfgang kam zur Welt, während ihr Papi zur gleichen Zeit schwer verwundet im Städtischen Krankenhaus in Aschaffenburg lag. Beinahe jede Nacht mussten beim Fliegeralarm eiligst die Patienten in den Luftschutzkeller transportiert werden. Die Einschläge und die Erschütterungen waren bis in den Schutzraum zu spüren. Udo, der neue Erdenbürger, lag beschützt in Mamis Arm, die im Rollstuhl in Sicherheit gebracht wurde.
Der Sommer 1944 brachte eine weitere Schreckensnachricht: Annemaries Mann Edgar war gefallen, die kleine Tochter Inge war gerade erst fünf Jahre alt.
Kurz darauf reiste Lilo mit dem einjährigen Udo zu ihrem Mann nach Cottbus, der sich trotz seiner schweren Verletzungen wieder zum Einsatz als Ausbilder einer Kompanie gemeldet hatte. Lilo war in großer Sorge um seine Gesundheit. Die Mutter und Schwester unterstützten ihren Entschluss. Den vierjährigen Wolfgang wusste sie gut behütet im Elternhaus. Mit der kleinen Inge konnte er unbeschwert von den Kriegsereignissen im Haus und im Garten spielen.
In Cottbus war Willi in Wartestellung mit seinen Männern für den Einsatz. Neben der Kaserne stand eine Wohnung für den Kompanieführer zur Verfügung. Durch die liebevolle Pflege seiner Frau erholte sich Willi zusehends und die Freude über den kleinen Sohn, den er nun täglich sehen konnte, trug mit zu seiner Genesung bei.
Bei den täglichen Übungen und Märschen war die Kompanie unvermutet auf eine große Herausforderung gestoßen: Lilo stand in der Küche am Herd. Der kleine Udo saß zufrieden in seinem Laufställchen (ein Gitter ohne Boden) im Schatten eines Baumes im Garten und spielte mit Bauklötzen. Frei laufen konnte er noch nicht, aber das Hochziehen und sich auf diese Weise - mit seiner „Gehhilfe“ – Schritt für Schritt fortzubewegen, machte ihm sichtlich Vergnügen. Seine Mami lief zum Fenster, als sie das laute Kommando hörte: „Kompanie halt!“ Mit offenem Mund stand ihr kleiner Sohn mit seinen Händchen am Laufgitter mitten auf dem Weg und versperrte so den Marsch. Aus der kurzen Hose hing um die nackten Beinchen - ausgerechnet jetzt - die vom Inhalt verschmierte Windel. Mit großen Augen sah Udo zu den Männern auf und bewegte sich keinen Millimeter weiter. Mit eiserner Disziplin bemühten sich die Soldaten, eine ernste Miene zu behalten, als der erste aus den Reihen trat und den Kleinen samt seinem Laufställchen auf die Seite hob und in der Wiese absetzte. Mit hochrotem Gesicht lief Lilo hinaus, um rasch ihren Sohn zu holen.
Regelmäßig in der Nacht - manchmal sogar mehrmals - schreckte ein Fliegeralarm die Schlafenden aus ihrer Nachtruhe. Lilo holte den voller Angst schreienden Udo aus seinem Bettchen und eilte mit ihm in den Luftschutzkeller. Dass sie hier als einzige Frau mit ihrem Kind im Arm unter einer Kompanie Soldaten saß, war für die Männer ein tröstlicher Anblick. Wenn Udo an Mamis Brust trinken durfte, beruhigte er sich wieder und schlief bald weiter. An Heiligabend packte Lilo kleine Päckchen mit ein paar selbstgebackenen Plätzchen und Nüssen. Den Soldaten, die doch alle nur sehnsuchtsvoll an ihre Familien dachten, die jetzt ohne sie zu Hause unter dem Christbaum saßen, erschien die Frau ihres Hauptmannes wie ein Engel, als sie ihnen mit einem Händedruck und einem aufmunternden Lächeln die kleinen Geschenke überreichte.
Als im Frühjahr 1945 die Nachricht kam, dass die Rote Armee näher rücke, musste Lilo mit dem kleinen Udo aus dem Osten fliehen. Willi wollte sie in Sicherheit bringen und fand eine Gelegenheit, mit anderen Flüchtlingen auf der Transportfläche eines Lastwagens Richtung Westen zu fahren. In der ersten Nacht kamen die Flüchtenden alle in einem Lager unter. Lilo war erleichtert, dass sie Udo immer noch stillen konnte und hoffte inständig, ihre Milch würde nicht versiegen. Sie hatte sich mit ausreichend Proviant für die Reise versorgt, den sie unter der Matratze des Kinderwagens deponiert hatte. Am nächsten Tag ging‘s mit der Eisenbahn weiter. Die Gruppe war gerade eine Stunde unterwegs, als sie die tief heranfliegenden Flugzeuge hörten. Die Bremsen quietschten und die Wucht schüttelte die Fahrgäste, dass sie übereinander purzelten. Hastig mussten sie aussteigen, das Gepäck zurücklassen, ins Gelände eilen und sich unter Büschen und in den Straßengräben verstecken. Udo lag beschützt eng an die Brust seiner Mami gedrückt unter ihrem Mantel. Sie hielt ihm die Ohren zu, er sollte den Einschlag nicht hören. Dass ihr Herz vor Angst raste, konnte sie ihm nicht verbergen. Im letzten Augenblick hatte ein Mitreisender den Kinderwagen herausgezerrt. Der Zug wurde getroffen und nun mussten alle zu Fuß weiterziehen. Ein kalter Märzwind schlug ihnen ins Gesicht. Im Kinderwagen lag der kleine Udo warm gebettet im weichen Nerzcape seiner Mami. Es war ein Weihnachtsgeschenk von Willi aus seiner Zeit während des Kriegseinsatzes in Frankreich.
Lilo dachte an ihren Sohn zu Hause. Wie gut, dass wenigstens mein kleiner Wolfgang in Sicherheit ist. Er wird hoffentlich nicht aufgeschreckt werden durch die Sirenen in der Nacht … Mit solchen Gedanken versuchte Lilo, sich Trost zuzusprechen und sammelte alle Kräfte für die weitere Flucht. Nach fünf kräftezehrenden Tagen und Nächten kam sie endlich im Spessart an. Ein Lastwagen hatte sie völlig erschöpft mit dem Rest der Gruppe regelrecht von der Straße aufgelesen. Die Gewissheit, dem Zuhause so nah zu sein, gab ihr jetzt neue Kraft. Das Wetter hatte sich gebessert. Lilo atmete Heimatluft, spürte die ersten Sonnenstrahlen in ihrem Gesicht und schob - in der Vorfreude auf das Wiedersehen zu Hause - beschwingt den Kinderwagen. Sie hatte es geschafft! Erleichtert lächelte sie ihrem Sohn zu, der laut jauchzte, das Gesicht seiner Mutter so fröhlich zu sehen. Noch nie hatte Lilo einen Fußweg in einer solchen Stimmung erlebt: Tränen liefen über ihre Wangen; Dankbarkeit, Glücksgefühle und Freude ließen sie laut jubeln. Die Überraschung war groß, als sie nach etwa vier Stunden an die Haustüre klopfte. Sie fiel der Mutter in die Arme, die sie mit feuchten Augen auffing. Erst jetzt spürte Lilo, wie ihre Knie weich wurden. Sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Annemarie kam mit der kleinen Inge im Arm herbeigeeilt und Opapa, von Freude und Dankbarkeit so überwältigt, dass er sich unbeholfen ein paar Tränen aus den Augenwinkeln wischen musste, hielt sich einen Moment am Türrahmen fest. Endlich konnte Lilo auch ihren so sehr vermissten kleinen Wolfgang, der sie mit großen Augen anschaute, wieder in die Arme schließen. Und endlich ließ sie auch ihren Tränen freien Lauf.
Als 1945, noch kurz vor Ende des Krieges, Bomben auf Aschaffenburg, Darmstadt und Würzburg fielen, waren die Erschütterungen so gewaltig, dass in den Sommerauer Häusern die Möbel und Lampen an der Decke wackelten. Das Donnern der Bomber, die am Abend des 15. März über das Dorf flogen, verbreitete großen Schrecken. Der Angriff auf Würzburg zerstörte die Gebäude zu 90 Prozent. Die brennende Stadt färbte weithin den Nachthimmel rot. Etwa fünftausend Menschen kamen um und Tausende wurden obdachlos.
Wenn die Sirenen aufheulten, flüchteten in Sommerau alle in die Keller. Der ohrenbetäubende Lärm des Alarms sollte unvergesslich bleiben, löste noch viele Jahre bei späteren Feuerwehr-Übungsalarmen Beklemmungen aus und ließ die alten Ängste wieder lebendig werden.
Das Dorf blieb verschont, bis im April 1945 die Nachricht im Eilfeuer durchs Dorf ging, dass die Amerikaner bereits vom Main herauf unterwegs waren. Zwar wurden sie als Retter vor den bösen Russen und als Bollwerk gegen den drohenden Kommunismus erwartet, doch die Angst, dass nun der Krieg sich vor ihrer Haustüre befinden könnte, löste eine Panik aus. Da sich einige SS-Soldaten in einem Waldgebiet zwischen Eschau und Wildenstein verschanzt hatten und von dort auf die Angreifer schossen, lenkten sie den Gegenangriff auf sich. Beinahe gleichzeitig waren die Schüsse der Amerikaner von der anderen Seite, von Eichelsbach her, zu hören. Einige Häuser im Dorf wurden getroffen, ein Schuss traf den Malepartus. Der Schafhof vor dem Ortseingang brannte ab. Vor vielen Häusern flatterten - als Zeichen der Kapitulation - weiße Fahnen, eilig aus Betttüchern gefertigt. Viele Einwohner brachen in Todesangst zu Fuß auf in das etwa acht Kilometer entfernte Wildensee, wo sie sich sicher fühlten. Ganze Karawanen - auch Udo im Kinderwagen mit Mutter und Bruder Wolfgang - waren bergauf unterwegs, andere mit Leiterwagen und Fahrrädern in Begleitung ihrer Hunde. Sie mussten vorbei am Waldstück Wolf, wo sich die SS versteckt hielt und riskierten, von den Amerikanern beschossen zu werden. Das furchterregende Donnern der einfahrenden Panzer trieb die verbliebenen Einwohner in ihre Verstecke in den Kellern.
Zwei Soldaten hämmerten mit ihren Gewehrkolben an die Haustüre. Beherzt öffnete Opapa ihnen. Er wurde auf die Straße kommandiert und in gebrochenem Deutsch und barschem Ton fuhr ein Sergeant ihn schroff an. Opapa hörte immer wieder das Wort „Nazi“ bis er verstand, dass ein Sommerauer den durch die Straße fahrenden Jeeps zugerufen hatte: „Hier wohnt ein Nazi!“ Richard sprach sehr gut englisch und als der Amerikaner erfuhr, dass er einen alten erfahrenen Arzt vor sich hatte, nutzte er die Gelegenheit, seinen medizinischen Rat einzuholen. Zuletzt stellte sich noch heraus, dass der GI, ebenso wie Mary, in St. Louis geboren war. Die Situation entspannte sich und zur Erleichterung aller verlief dieser Tag glimpflich.
Nach außen hin war die Familie zwar bemüht, das Bild der Helden in der Familie, Edgar und Franzkarl, die für Vaterland und Führer im Kampf fielen und Willi, dem zu hundert Prozent Kriegsversehrten, aufrechtzuhalten. Sie alle waren überzeugt gewesen - wie viele andere - ihre patriotische Pflicht für die Ehre des Vaterlandes zu erfüllen. Ihre jugendliche Begeisterungsfähigkeit sah Richard nun schamlos ausgenutzt und geopfert. Doch wenn er in der Dämmerung alleine im Garten saß - es waren auch nach fünfundzwanzig Jahren noch die Stunden im vertrauten Gespräch mit seiner verstorbenen Frau am Ende jedes Tages - wurden der Schmerz und die Trauer so groß, dass er begann zu ahnen, welchem Wahn auch er - wie viele andere - verfallen war. Hitlers Parolen, mit denen er die Massen verführte: „Ihr seid das wahre Herrenvolk! Ich verspreche euch goldene Zeiten!“, klangen jetzt nur noch wie Hohn in seinen Ohren. Wie alle Gewaltherrscher hatte auch Hitler nur so lange vom Frieden für das Vaterland gesprochen bis er seine Armeen aufgerüstet wusste. Und die Dimension der schier unfassbaren Schreckensbilder der Schlachten, der Leiden der Soldaten, der Opfer unter der Zivilbevölkerung, der traumatisierten Rückkehrer und der Familien, denen der Krieg die Söhne, Väter und Ehemänner geraubt hatte, schien unfassbar. Dass zudem mehr und mehr die Gräueltaten der Nazis an der jüdischen Bevölkerung ans Licht kamen, hatte ihn tief getroffen. Zum ersten Mal hörte er Wörter wie Gaskammern, Sonderkommandos, Krematorien. Wenn er in die fröhlichen Gesichter seiner Urenkelkinder schaute, blickte er in Millionen unschuldiger Kinderaugen. Der Mord an diesen Kindern, auch den vielen ungeborenen ließ ihn nicht mehr los. Die Bilder kreisten unablässig in seinem Kopf bis er glaubte, den Verstand zu verlieren.
Bis zum letzten Augenblick war der Glaube an den verheißenen „Endsieg“ wie ein Dogma, niemand in der Familie hatte gewagt, es anzuzweifeln. Der Blick auf die ganze Dimension dieses Krieges, die millionenfachen Verbrechen, die erst nach und nach bekannt wurden, u. a. im Gesprächsaustausch mit dem befreundeten Schlossers Leo (mein Vater), der den verbotenen englischen Sender BBC heimlich abhörte, erschütterten schlagartig sein Bild vom Nationalsozialismus. Die quälenden Gedanken, die ihn keinen Schlaf mehr finden ließen in der Nacht, verfolgten ihn. Was wird nun werden aus meinem geliebten Vaterland? Wer wird Rechenschaft ablegen für diese Verbrechen? Wie werden unsere Kinder und Enkelkinder mit diesem Trauma ihr Leben gestalten können, dem Gefühl der Scham, der Hypothek, die wie eine „Erbsünde“ auf ihnen lasten wird? Er fand nicht mehr die Kraft über die Gedanken, die ihn bewegten und bedrückten, mit seinen Kindern zu reden, nicht einmal mit seinen Freunden, die er immer seltener sah, weil er sich mehr und mehr zurückgezogen hatte. Richard war ein Greis, vom eigenen Schatten verfolgt. Wie in ihm breitete sich in einer ganzen Generation ein Schweigen über den pervertierten Nationalismus aus, das das Grauen unter einem dicken Nebelschleier verbarg, unwissend, dass dieses Schweigen - wie eine Verewigung des Verbrechens - die Türe vor der Wahrheit verschloss und sie aufreißen kann zu einer Neuauflage. Jahrzehntelang war es, als wäre für die meisten der Faden des Gedächtnisses gerissen und das Grauen hinterließ eine ganze traumatisierte Generation.
Martin Luther, der große Reformator des Christentums galt als zentrale Persönlichkeit seit Richards Kindheit in der Familie. Sein markantes Portrait hing an der Wand des Arbeitszimmers seines Vaters, wie seines Großvaters, der ebenso Pastor war, und wenn der Vater ihn zitierte, war es für den kleinen Richard, als kämen die Worte aus Luthers Mund selbst. Er sah die Fehlentwicklungen in der Kirche und wollte sie beseitigen, diese in ihrem ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Entgegen seiner Absicht war es zu einer Kirchenspaltung gekommen. Luthers Bibelübersetzung gilt bis heute als große Leistung. Die spätere Neuorientierung der politischen Verhältnisse Deutschlands und Europas wären ohne die Reformation nicht zu erklären.
Luthers antisemitische Haltung basiert auf seiner Theologie und nicht auf rassistischen Einstellungen. Seine ablehnende Haltung dem jüdischen Volk gegenüber stand in direktem Zusammenhang mit der Legende, die seit zweitausend Jahren von höchsten moralischen Autoritäten gepredigt wurde: Die Juden trügen die Schuld, dass Jesus gekreuzigt worden sei. Der Vorwurf, einen „Gottesmord“ begangen zu haben, sollte als Rechtfertigung dienen für die Hetzjagd und schließlich die Ermordung der Juden. Dass die Römer die Verantwortung für den Tod des Mannes aus Nazareth tragen, hätten die Historiker und Theologen allerdings von Anfang an wissen können, wenn sie die Passionsgeschichten kritischer auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft hätten. So räumte auch Luther nicht dieses Missverständnis aus.
Die Verdrehungen der geschichtlichen Abläufe bis zur Hinrichtung Jesu am Kreuz hatten bereits durch die Aufzeichnungen der vier Evangelisten begonnen, die nicht ahnen konnten, welche verheerenden Auswirkungen dies haben sollte. Wer sich die Botschaften Jesu, die er uns durch sein Beispiel hinterlassen hat, zu Herzen nimmt, wird erkennen, dass er die Nächstenliebe, die alle Lebewesen, die ganze Natur einschließt, furchtlos über alle irdischen Gesetze an die erste Stelle unseres Menschseins gestellt hat.
Bereits in der Kindheit hatte Richard von den „Lügen der Juden“ und antijüdische Äußerungen gehört, über die Luther eine Schrift herausgegeben hatte. Von seinem Vater wusste er, dass Luther ursprünglich sich mit den Juden gegen die Katholiken verbünden wollte. Seine Bemühungen, die Juden zu bekehren, scheiterten. Er wollte ihnen die unsinnige Narrheit des jüdischen Glaubens beweisen und ließ ihnen nur die Wahl zwischen Taufe und Vertreibung. Zunächst beschrieb Luther den Hochmut der Juden. Sie hielten sich aufgrund ihrer Abstammung für Gottes auserwähltes Volk, obwohl sie doch, wie alle Menschen, als Sünder unter Gottes Zorn stünden. Die Juden seien blutdürstig, rachsüchtig, das geldgierigste Volk, leibhaftige Teufel, verstockt. Ihre verdammten Rabbiner verführten die christliche Jugend, sich vom wahren Glauben abzuwenden. Luther zitierte das Neue Testament Mt 12,34: Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Gutes tun sie aus Eigennutz, nicht aus Liebe […]. - Sie lassen uns in unserem eigenen Land gefangen und lassen uns arbeiten […] sind also unsere Herren, wir ihre Knechte. Er appellierte an den Sozialneid der Bevölkerung, um die „Schutzgeldzahlungen“ der Juden zu beenden. Dazu forderte er, ihre Synagogen niederzubrennen, ihre Häuser zu zerstören etc. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass es den Christen verboten sei, die Juden zu verfluchen und persönlich anzugreifen obwohl er sie gerne eigenhändig erwürgen würde. Falls sich seine sieben Schritte nicht durchführen ließen, so bleibe nur, die Juden aus den evangelischen Ländern wie tolle Hunde zu verjagen. Damit sprach Luther den Juden die Menschenwürde ab, die er ihnen noch 1523 zugebilligt hatte. Er wies die evangelischen Pfarrer und Prediger an, seine Ratschläge unabhängig vom Verhalten der Obrigkeit zu befolgen, ihre Gemeinden vor jedem Kontakt mit Juden und jeder Nachbarschaftshilfe für sie zu warnen und verlangte die Weitergabe und ständige Aktualisierung seiner antijüdischen Schriften.
1931 gab Karl-Otto v. d. Bach die Schrift „Luther als Judenfeind“ heraus, in der er in judenfeindlichen Lutherzitaten eine völkische Bedeutung der Reformation gegen die jüdische Plage sah. Diese Ansichten wurden Gemeingut in völkischen und rassistischen Teilen des Protestantismus.
Adolf Hitler stilisierte Luther beim NSDAP-Parteitag 1923 für den geplanten Hitlerputsch zum Vorbild des Führerprinzips: Er habe seinen Kampf gegen „eine Welt von Feinden“ damals ohne jede Stütze gewagt. Dieses Wagnis zeichne einen echten heldischen Staatsmann und Diktator aus. Das NSDAP-Blatt „Der Stürmer“ vereinnahmte ab 1923 oft ausgewählte isolierte Zitate aus dem Neuen Testament und von christlichen Autoren, darunter Luther.
Aber es gab auch andere Stimmen: Pastor Hermann Steinlein (Innere Mission Nürnberg) erklärte, Luther sei keine unfehlbare Autorität. Eduard Lamparter erklärte 1928 für den Verein zur Abwehr des Antisemitismus, Luther sei parteipolitisch zum Kronzeugen des modernen Antisemitismus vereinnahmt worden und sei 1523, auf dem Höhepunkt seines reformatorischen Wirkens, für die Unterdrückten, Verachteten und Verfemten in so warmen Worten eingetreten und hätte der Christenheit die Nächstenliebe als die vornehmste Pflicht auch gegenüber den Juden eindringlich ans Herz gelegt. Prominente evangelische Theologen empfahlen allen Pastoren, die Erklärung als maßgebende Position der evangelischen Kirche zu verlesen: Antisemitismus sei eine Sünde gegen Christus und mit dem christlichen Glauben unvereinbar.
Der Deutsche Evangelische Kirchenbund begrüßte dennoch die Machtergreifung des NS-Regimes am 30. Januar 1933 mit großer Begeisterung. Vertreter, wie Otto Dibelius - als glühender Monarchist, Antidemokrat und Antisemit - lobten beim „Tag von Potsdam“, am 21. März 1933, die Beseitigung der Weimarer Verfassung als „neue Reformation“ und stilisierte Hitler zum gottgesandten Retter des deutschen Volkes. Dieser Tag ging in die Geschichte ein, da in der Garnisonskirche der erste Reichstag nach der Machtübernahme eröffnet wurde und der neue Reichskanzler Adolf Hitler sich vor Reichspräsident Hindenburg verneigte.
In der NS-Zeit wurden Luthers Judentexte neu herausgegeben. 1937 und 38 bekräftigten zwei Artikel im „Stürmer“, Luther müsse als unerbittlicher und rücksichtsloser Antisemit gelten und die evangelischen Pastoren müssten dies viel stärker predigen. Im November 1937 beim „Rezitationsabend“ im Residenztheater in München zur Propaganda-Ausstellung „Der ewige Jude“ wurden zuerst Auszüge aus Luthers Schriften verlesen. Gegen die November-Pogrome protestierte keine Kirchenleitung. Landesbischof Walther Schultz forderte alle Pastoren Mecklenburgs in einem „Mahnwort zur Judenfrage“ am 16. November 1938 auf, Luthers „Vermächtnis“ zu erfüllen, damit die „deutsche Seele“ nun keinen Schaden erleide und die Deutschen […] alles daran setzten, eine Wiederholung der Zersetzung des deutschen Reiches durch den jüdischen Ungeist von innen her für alle Zeiten unmöglich zu machen. Adolf Hitler, nicht „der Jude“ habe am deutschen Volk Barmherzigkeit getan, so dass ihm und seinem – dem deutschen Volk aufgetragenen - Kampf gegen die Juden, die Nächstenliebe, Treue und Gefolgschaft der Christen zu gelten habe. Bischof Martin Sasse stellte in seinem weit verbreiteten Pamphlet Martin Luther über die Juden: Weg mit ihnen! am 23. November 1938 ausgewählte Lutherzitate so zusammen, dass die nationalsozialistische Judenverfolgung als direkte Erfüllung von Luthers Forderungen erschien. Die von elf evangelischen Landeskirchen unterzeichneten „Leitlinien“ vom März 1939 behaupteten, der artgemäße Nationalsozialismus setze Luthers Reformen politisch fort. Der Theologe Theodor Pauls forderte, die Kirche müsse mit dem Evangelium für das deutsche Lebensgesetz gegen die jüdische Macht des Verderbens eintreten, der Staat müsse dieses Lebensgesetz durchsetzen und Gottes Zorn gegen die Juden vollstrecken und untermauerte dies mit Luther-Zitaten. Am 17. Dezember 1941 erklärten sieben evangelische Landeskirchen, der Judenstern entspreche Luthers Forderung, schärfste Maßnahmen gegen die Juden zu ergreifen und sie aus deutschen Landen auszuweisen.
Die evangelischen Kirchenführer ließen sich in vorauseilendem Gehorsam bereitwillig zu Helfershelfern der Nazis instrumentalisieren, tauschten das Neue Testament mit der Bergpredigt gegen „Mein Kampf“. Der frühere US-Präsident Wilson, der sich mehrmals während des Ersten Weltkrieges für Friedensverhandlungen eingesetzt hatte, wäre als herausragendes Vorbild für eine christlich orientierte Politik gewesen.
Luthers Antisemitismus war in klerikalen Kreisen kein Einzelfall. Der ehemalige Zisterzienser-Mönch und Landsmann von Adolf Hitler, Adolf J. Lanz aus Wien (Hochstapler Jörg Lanz von Liebenfels), gründete 1900 einen Zusammenschluss rassistischer Deutsch-Österreicher, den religiösen „Neutempler-Orden“, der die arische Rasse - als die von Gott auserwählten Herrenmenschen - glorifizierte. Als glühender Antisemit fühlte er sich den „Alldeutschen“ verbunden. Lanz legte den Sündenfall des Alten Testamentes so aus, dass die ursprünglich göttlichen Arier sich mit Tieren vermischt hätten und daraus minderwertige Rassen hervorgegangen seien, die zur Reinhaltung des Blutes zu eliminieren wären (Eugenik). Sein menschenverachtendes Frauenbild drückte sich darin aus, dass arische Frauen nur als „Zuchtmütter“ wertvoll seien. Inwieweit sich Hitler von Lanz inspirieren ließ, ist unter Historikern umstritten. Bei SS-Chef Heinrich Himmler dürften neben dem Rassenwahn auch die okkulten Thesen von Lanz auf besonders fruchtbaren Boden gefallen sein (er glaubte die Reinkarnation König Heinrichs zu sein, suchte nach dem Heiligen Gral, gründete die „SS-Herrenmenschen-Zuchtstation Lebensborn“, baute die Wewelsburg zu einer rituellen SS-Hochburg aus) und konnte in diesem Wahn skrupellos den millionenfachen Massenmord organisieren. Wie schizophren, barbarisch und menschenverachtend Himmler war, zeigt eine Rede vor seinen Mordschergen der Sonderkommandos am 4. Oktober 43 in Posen: „Ich meine jetzt die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. ‚Das jüdische Volk wird ausgerottet‘ sagt ein jeder Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm Ausschaltung der Juden; Ausrottung machen wir. Und dann kommen sie alle an, die braven 80 Millionen Deutschen und jeder hat seinen anständigen Juden. Es ist klar, die anderen sind Schweine, aber dieser ist ein prima Jude. Von allen die so reden, hat keiner zugesehen und durchgestanden. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100, 500 oder 1000 Leichen daliegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwäche, ‚anständig‘ geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals geschriebenes Ruhmesblatt unserer Geschichte“. Dass Himmler mit diesen Zahlen untertrieben hat, zeigt stellvertretend das Massaker in der Schlucht von Babyn Yar, Nähe Kiew, bei dem - mit „logistischer“ Unterstützung der Wehrmacht - innerhalb 36 Stunden 33.000 Juden (Männer, Frauen und Kinder) von seinen Schergen erschossen wurden.
Einzelne Vertreter verschiedener Kirchen prangerten in ihren Predigten die Judenverfolgung oder Konzentrationslager an und erhielten daraufhin Rede- und Schreibverbot oder wurden selbst in Konzentrationslagern inhaftiert. Einige Theologen, wie Niemöller und Bonhoeffer, leisteten aktiven und passiven Widerstand. Die Württembergische Pfarrhauskette, organisiert durch Theodor Dipper, war eine Untergrundorganisation evangelischer Pfarrer zur Rettung von Juden. Die Mitglieder der Weißen Rose (Scholl, Probst, Graf, Schmorell) druckten und verteilten im Juni 1942 bis zum Februar 43 Flugblätter. Sie handelten nach eigener Aussage aus christlicher Überzeugung und wurden ebenso wie Bonhoeffer hingerichtet. Doch allen Gruppen des Widerstandes war bewusst, dass sie eine verschwindend kleine Minderheit der Bevölkerung darstellten. Sie besaßen keine realistische Chance, das System grundlegend zu ändern. Eine Unterstützung durch die Alliierten erhielt der deutsche Widerstand nicht, vielmehr führte die Forderung einer bedingungslosen Kapitulation zu einer Solidarisierung mit der Führung und gab dem Widerstand keine Möglichkeit, durch eine Machtübernahme die Friedensbedingungen zu verbessern.
Fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges auf der Synode von Weißensee 1950 leitete die Evangelische Kirche in Deutschland einen Bruch mit dem Antijudaismus ein, schwieg aber lange zu Luthers Judenaussagen. 1969 nahm der Lutherische Weltbund erstmals offiziell Stellung zu Luthers Judentexten: Er habe Juden darin auf grausame und gefährliche Weise angegriffen und damit seiner Kreuzestheologie widersprochen. Zum 500-jährigen Reformationsjubiläum sollte sich die Evangelische Kirche der Klärung von Luthers antijüdischer Grundhaltung stellen. „Das weitreichende Versagen der Evangelischen Kirche gegenüber dem jüdischen Volk erfüllt uns mit Trauer und Scham.“ Der Wissenschaftliche Beirat der EKD erklärte in seiner Orientierungsschrift: Völkische Antisemiten hätten Luthers antijüdische Schriften mit ihrem rassenbiologischen Programm verbunden und für die nationalsozialistische Judenpolitik benutzt. Daran hätten sich „je länger, je mehr“ auch evangelische Theologen beteiligt. Heute gelten Luthers Judenschriften als schlechterdings unvereinbar mit seiner eigenen Theologie und dem Neuen Testament.
Dass sich nicht nur in Deutschland über mehrere Generationen ein tiefsitzender Groll gegen jüdische Bürger aufgebaut hatte, sah Richard bestätigt durch seine eigenen unfreiwilligen Beobachtungen in den letzten Jahren während seiner Hausbesuche im Spessart. Er hatte nicht nur einmal gesehen, wie ein jüdischer Kaufmann in ein Haus ging, das mehr einer Hütte glich, während kurz darauf der Besitzer durch die Hintertüre verschwand. Richard wusste, dies war nicht nur für einen einzigen Schuldner die letzte Möglichkeit, durch seine Ehefrau den angelaufenen Zinsen zu entkommen. Sich Geld zu leihen gegen einen Schuldschein war manchmal in der Not die Rettung vor dem Verhungern. Und wenn einige Juden Zinsen verlangten, die die Schuldner nicht begleichen konnten, wuchs der Unmut. Es hieß, die Zinsen seien für die Juden wie für die Bauern die Egge und der Pflug. Betrügereien durch Deutsche - wie legalisierter Diebstahl jüdischen Eigentums in der NS-Zeit - wurden dagegen verdrängt, da dies nicht in das Bild des angeblich „ehrlichen und aufrechten Deutschen“ passte.
Seit vielen Jahren hatte sich ein Neid-Antisemitismus in einigen Teilen der Bevölkerung entwickelt, der sich ausgebreitet hatte. Die von Hitler angekündigte „Juden-Vernichtung“ nahm kaum jemand wörtlich, wie auch die Reichstagsrede vom 30. Januar 39: „Wenn es dem internationalen Finanzjudentum gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa“ - und im Jahre 1941/42 über die Endlösung: „Wenn wir diese Pest ausrotten, so vollbringen wir eine Tat für die Menschheit […] Wir werden gesund, wenn wir den Juden eliminieren.“
Kaum jemand war in der Lage, sich das Grauen des beginnenden Holocaust vorzustellen. Propagandafilme der Nazis zeigten demonstrativ Filmaufnahmen vom Lager Theresienstadt, in denen der Tagesablauf der jüdischen Familien wie in einem Ferienlager, sogar mit eigenem Gemüsegarten und Sportprogramm, zu sehen war. Die Bilder sollten die Bevölkerung, die mehrheitlich das Aussiedeln der Juden aus Deutschland begrüßten, täuschen und von der grausamen Wahrheit ablenken. Im krassen Gegensatz dazu wurden filmisch auf perfide Weise die grauenhaften Verhältnisse im Warschauer Ghetto für ein verfälschtes Bild „des Juden“ ausgeschlachtet, mit dem Tenor, er sei ein parasitärer, verlauster, schmutziger und unkultivierter Untermensch. Dieser hätte damit, nach der Lesart des angeblich zivilisierten arischen Herrenmenschen, in einem neuen Großdeutschen Reich kein Lebensrecht mehr. Für diese sog. „Parasiten des Deutschen Reichs“ blieb als logische Konsequenz nur die Endlösung mit Zyklon B.