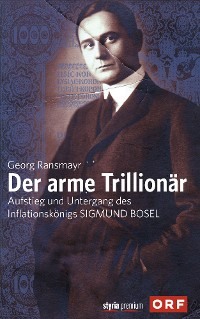Kitabı oku: «Der arme Trillionär», sayfa 3
Die Kinderstube in der Luxuswelt
Leben kam in den parkähnlichen Garten erst viele Jahre später durch die Bosel-Kinder Julie und Alfons, die sich – als sie schon größer waren – auf dem Gelände austoben konnten und vor allem die Kegelbahn hinterm Haus geliebt haben. „Wir sind uns manchmal wie Gäste vorgekommen, weil wir uns auf unseren Streifzügen durch das Anwesen ‚ordentlich‘ benehmen mussten“, schmunzelt Frau Marks. Warum das? Die Nachbarschaft sollte nicht allzu viel davon mitbekommen, dass Julie und ihr Bruder die unehelichen Kinder des Hausherrn waren. Bis 1937 waren die beiden Sprösslinge daher nur fallweise am Wochenende in der Gloriettegasse zu Besuch. Gewohnt haben die Kinder im Wiener Nobelbezirk Döbling, wo sie mit ihrer Mutter Ilona Schulz in einer Villa in der Silbergasse aufgewachsen sind. Behütet und eingepackt in erzieherische Zuckerwatte.
In der Silbergasse gibt es damals eine Köchin, zwei Stubenmädchen und einen Hausbesorger. Auch eine Anstandsdame schwirrt durch den Haushalt. Auf winzigen alten Fotos sieht man, wie die Gouvernante die kleinen Bosel-Sprösslinge bei einem Schaukelpferd bemuttert. „In der Silbergasse war es fantastisch“, erinnert sich Julie Marks. „Im Garten gab es in einer Hütte sogar ein Ringelspiel. Und mit meinem Bruder habe ich mich sehr gut verstanden. Wir beide sind in Wien auch nie in eine Schule gegangen.“ Die Kinder werden von einem Hauslehrer namens Eduard Landskron unterrichtet. Der pensionierte Schuldirektor stellt Julie und Alfons damals Zeugnisse wie in einer richtigen Schule aus, die er fein säuberlich mit Tinte schreibt.25
Den Kindern blieb verborgen, was der Vater während der Woche beruflich macht und warum er an vielen Abenden nicht zu Hause ist. Donnerstags durften die Bosel-Kinder den Papa jedoch in seinem eleganten Bürohaus in der Kramergasse besuchen. Nachher gab es mit der Mama öfters einen Abstecher in den Prater. Der Donnerstag war der Höhepunkt der Woche, an diesem Tag ist immer Kirtagsstimmung aufgekommen. „Wenn wir mit dem Auto in der Stadt herumgefahren sind und zu einer Kreuzung gekommen sind, dann haben die Polizisten immer beim Vorbeifahren salutiert“, erzählt Frau Marks. „Mein Bruder und ich waren sehr beeindruckt, und wir haben auch salutiert.“ Julie muss kurz kichern. „Das war wirklich spaßig. Die Beamten haben sogar dann salutiert, wenn nur mein Bruder und ich im Auto gesessen sind.“26
Von Berufs wegen kannten die Verkehrspolizisten damals die wichtigsten Autonummern der Stadt. Als Freund und Gönner der Exekutive war Bosel jedem Sicherheitsmann ein Begriff. Die Polizei hielt Bosel deshalb auch dann noch in Ehren, als es finanziell mit ihm bergab ging, was Bosel geschickt zu übertünchen wusste. Frau Marks kann sich noch gut an einen Fackelzug in der Ära Dollfuß erinnern, bei dem die Familie Bosel Ehrenplätze auf der VIP-Tribüne hatte.
Beim Plaudern mit Frau Marks wird mir plötzlich klar, dass sie seit 1950 nicht mehr in Österreich gewesen ist. Nach ihrer Rückkehr aus London, wo sie die Nazizeit überlebt hat, habe sie Wien nicht ausstehen können, sagt sie mir. Tief in ihr drinnen sind die Häuser in der Silbergasse und der Gloriettegasse aber lebendig geblieben. Julie zeigt mir auch alte Urlaubsbilder, auf denen sie Seite an Seite mit ihrem Vater und ihrem Bruder knöcheltief im Meer steht. Sigmund Bosel trägt auf dem Foto ein dunkles Badekleid, das in den 1930er Jahren für Männer nach wie vor gängig war und in diversen Seebädern noch Vorschrift gewesen ist. „Wir waren mit unseren Eltern auch auf Reisen. Wir waren in Venedig und in Viareggio in Italien am Strand. Es war absolut phantastisch, ich kam mir vor wie eine kleine Prinzessin.“27
Anmerkungen
1
Habe, Ich stelle mich, 102.
2
„Allerhöchste Eisenbahn“, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, www.monumente-online.de.
3
ZEIT Online, 20. 9. 1991.
4
Herz-Kestranek/Arnbom, … also hab‘ ich nur mich selbst!, 11.
5
Stiefel, Camillo Castiglioni, 325 f., Erman, Bei Kempinski, 107 f.; Habe, Ich stelle mich, 102.
6
SchobA (Karton) 95, SB an Schober, 31. 12. 1922; Ufermann, Könige der Inflation, 83; WStLA, Vr 2562/37 3/226C, Einvernahme SB, 30. 9. 1936.
7
Wiener Wochenausgabe, 25. 2. 1950; Die Stunde, 21. 7. 1923; Neues Wiener Journal, 12. 11. 1922.
8
Interview mit Julie Marks, 17. 2. 2012.
9
Unterreiner, Die Habsburger, 92 ff.; Markus, Katharina Schratt, 74 ff. und 114 ff.; Kurier, 22. 2. 2015.
10
Anna Nahowskis Tochter Helene, die spätere Frau des Komponisten Alban Berg, soll eine uneheliche Tochter von Kaiser Franz Joseph gewesen sein. Vgl. Markus, Katharina Schratt, 78 f.; Kurier, 22. 2. 2015; Morgenstern, Alban Berg und seine Idole, 76; Wohlfahrt, The Emperor close up and personal, in: Vocelka/Mutschlechner, Franz Joseph 1830 – 1916, 74; Morton, Wetterleuchten 1913/1914, 79 f.
11
Sandgruber, Traumzeit für Millionäre, 306 ff.
12
Grundbuch Hietzing, EL 809, ZL 78, Umschreibeband S. 89; AEF, Schiedsinstanz für Naturalrestitution, 724/2010, 9 - 42; Bermann, Illustrirter (sic!) Führer durch Wien und Umgebungen, S. X.
13
Zwischen 1915 und 1918 gehört die Villa Richard von Ortlieb.
14
WStLA, Vr 2562/37 3/226C Einvernahme SB, 1. 10. 1936; Markus, Die zweite Frau des Kaisers, 186 ff.
15
HAPSK, M 28/3, Pfändungsprotokoll, 2. 11. 1926; Wiener Zeitung, 10. 7. 1938. // Die Schätzgutachter kamen 1926 auf die stolze Summe von 155.000 Schilling. Um den Wert der Einrichtung hätte man für sich genommen in Hietzing schon eine Villa mit Garten bekommen.
16
Franz, 14 und 37 f.; Habe, Eine Zeit bricht zusammen, 14 f.; Frischauer, Twilight in Vienna, 198.
17
Die Stunde, 22. 7. 1923; Ufermann, 83.
18
Die Börse, 11. 11. 1926.
19
Interview mit der US-Historikerin Gertrude Schneider. Ihr Vater Pinkas Hirschhorn erwarb in den 1920er Jahren durch seine Bekanntschaft mit Sigmund Bosel eine 2%ige Beteiligung an der Femina. Die Anteilsscheine warfen Zinsen ab, die von einer Bankfiliale in der Wiener Thaliastraße periodisch ausgezahlt wurden. Die jüdische Familie Hirschhorn hatte dadurch nach dem „Anschluss“ noch drei Jahre lang ein kleines finanzielles Zubrot. 1941 wurde die Femina-Bar von den Nazis geschlossen. Siehe zur Femina auch Frischauer, European Commuter, 116.
20
Die Stunde, 14. 2. 1924; Prager Tagblatt, 14. 2. 1924; Neuigkeits-Welt-Blatt, 14. 2. 1924.
21
SchobA, „Bewilligt“, Erpresserbrief vom 18. 12. 1924; Die Stunde, 7. 4. 1925.
22
Die Stunde, 11. 1. 1925.
23
Bettauer, Der Kampf um Wien, Nachwort von Murray G. Hall (2012); Hall, Der Fall Bettauer, 78; Pauley, Eine Geschichte des österreichischen Antisemitismus, 147 ff.; taz, 30. 1. 2013.
24
Neue Freie Presse, 26. 3. 1925, Habe, Ich stelle mich, 111; Franz, Siegmund Bosel, 14 u. 27.
25
WStLA, Vr 2562/37 3/226C, „Prüfungszeugnis von Eduard Landskron für Julchen Bosel, III. Klasse“.
26
Interview mit Julie Marks, 17. 2. 2012, Gespräch mit Julie Marks, 25. 3. 2016.
27
Interview mit Julie Marks, 17. 2. 2012.
3 – DAS SPRUNGBRETT ZUM REICHTUM
„My father was definitely a self-made man“, sagt Julie Marks. An ihrem Tonfall hört man, dass sie noch immer ungemein stolz ist auf die Lebensleistung ihres Vaters. Für Frau Marks ist es das erste Interview, das sie einem österreichischen Journalisten gibt. Am Abend davor hat sie mir beim Vorgespräch eine kleine Zigarettendose gezeigt, in der die Buchstaben „SB“ eingelassen sind. Neben einigen Briefen und alten Fotos ist die braune Holzschachtel das einzige Erinnerungsstück an den Vater. Ja, der Papa habe ziemlich viel geraucht, diese Gewohnheit sei ihr von ihm geblieben, meint Julie mit einem scherzhaften Augenzwinkern. Wie es überhaupt ganz schön hart gewesen sein müsse, dass er als starker Raucher aus religiösen Gründen jeden Freitagabend und den ganzen Samstag über keine Zigaretten angerührt hat.
Von der Fifth Avenue kommt ein hupendes Brummen herauf ins Wohnzimmer. Dennis, der Tontechniker, presst mit beiden Händen die Kopfhörer an die Ohren. Unten auf der Straße ist die Müllabfuhr vorgefahren. Ärgerlich, wo doch Julie beim Erzählen gerade so richtig in Fahrt war und angefangen hat, von ihrer Mutter zu berichten. Und davon, wie sich die Eltern kennengelernt haben dürften. Ein Blick des Tontechnikers sagt mir, dass wir das Interview leider unterbrechen müssen. Julie merkt, dass wir Tonprobleme haben, doch sie redet noch eine Weile weiter. Bis sie auf einmal „Yeah, I can hear it“ sagt und aufsteht, um sich eine von ihren dünnen langen Damenzigaretten zu holen.
Immer wieder hätten sie das in New York, meint Scott, der Kameramann, dass bei Fernseh-Interviews der Straßenlärm von draußen akustisch durchkommt. Ich gehe vom Wohnzimmer hinaus auf den Balkon. Der Blick hinunter auf den Central Park und hinüber zur Skyline der Upper Westside von Manhattan ist großartig. Das Wetter ist mild, der Park liegt in einem zarten Winterlicht. Die Müllabfuhr hat sich mittlerweile einige Blocks nach vorne gearbeitet. Während der Drehpause hat Julie langsam ihre Zigarette geraucht. „I can have a look in the mirror and put a little more lipstick on, if you want“, sagt sie vor einem kurzen Abstecher ins Badezimmer. Dann können wir weitermachen.
Die alte Dame sitzt für unsere Aufnahmen vor einer Kommode, über der ein großes Gemälde hängt, auf dem ein Herr mit gezwirbeltem Schnurrbart und dem Habitus eines altösterreichischen Industriekapitäns in die Ferne blickt. „He was a good-looking guy, wasn’t he, our grandpa!“, sagt Julie Marks freudig, während sie für eine Nahaufnahme zu ihrem Großvater Leopold hinaufschaut. Bosel senior posiert in eleganter Kleidung, mit dunkler Plastron-Krawatte und einem weißen Hemd mit Vatermörderkragen. Die linke Hand hält er lässig am Hosenbund. Das Bildnis seines Vaters hat Sigmund Bosel einst für viel Geld beim berühmten Porträt-Maler John Quincy Adams bestellt. Dieser hat Leopold Bosel, der ein schlecht verdienender Handelsvertreter war, nobel in Szene gesetzt. Wollte Bosel seinen eigenen Lebensentwurf dadurch stylen, dass Quincy Adams dem armen Vater nachträglich eine großbürgerliche Statur überstülpte?
Einen anderen Reim kann man sich auf das wunderschöne Gemälde eigentlich nicht machen. Wenn man sich Bosels märchenhaften Aufstieg vor Augen hält, ist es verständlich, dass der „Trillionär“ seinen familiären Hintergrund in ein eleganteres Licht tauchen wollte. Mit diesem Bemühen war Bosel auch nicht allein. Er und andere Aufsteiger buhlten um die Aufnahme in die Wiener High Society, die neureiche Parvenüs lange auf Respektabstand gehalten hat. Der Presse blieb dieses Schauspiel nicht verborgen: „Die jungen Reichen, die … mit gut gespielter Grandezza ihre Visitenkarten in der ganzen Welt abgeben, haben sich den alten Reichen in ihren Sitten und Gebräuchen so genähert, dass ihre Vergangenheit beinahe so entschwindet wie die Landschaft dem Eisenbahncoupé.“1
Bosel mag zwar innerlich mit dem Luxus auf Kriegsfuß gelebt haben. Nach außen hin hat er aber sehr wohl den Lebensstil imitiert, den der Geldadel vor dem Ersten Weltkrieg gepflogen hatte. 1923 gab es über sein Auftreten auch nichts mehr zu lachen. Als Großaktionär der Unionbank hatte er sich das Tor zu einem richtigen Bankpalast aufgestoßen. Nun war er in der Lage, nach Lust und Laune durch die Etagen eines Gebäudes zu streifen, in dem die Klinken der gepolsterten Türen in Schulterhöhe angebracht waren und jeder Kreditnehmer das Gefühl haben musste, für ewig ein Bittsteller zu bleiben. Dass die alteingesessenen Generaldirektoren über das Tempo pikiert waren, mit dem junge Emporkömmlinge wie er ans Werk gingen, hat Bosel kalt gelassen. Ihn trieb der Ehrgeiz, im Zeitraffer ein zweiter Rothschild zu werden. „Am Anfang seiner Laufbahn hat mein Vater nichts gehabt“, betont Julie Marks. „Auch mein Großvater hat ursprünglich nichts besessen. Ich finde es großartig, dass mein Vater so viel Geld verdienen konnte und so reich geworden ist.“2
Nicht mal ein Jahrzehnt hat Sigmund Bosel gebraucht, um es vom kleinen Textilunternehmer im Schicksalsjahr 1914 zum überlebensgroßen Banker des Jahres 1923 zu schaffen. Von Null auf Hundert in nur neun Jahren. Eigentlich eine amerikanische Tellerwäscher-Karriere, nur halt in Bosels Fall auf Wienerisch. Der Papa sei eben brillant gewesen, meint Frau Marks, und wirklich clever.
Ein Lehrbub macht Karriere
Eine gute Figur hatte Bosel schon als Lehrling gemacht, im Wiener Textilwaren-Geschäft „König & Goldner“. Hier beginnt der junge Sigmund 1908 mit 15 sein Berufsleben – nach fünf Jahren Volksschule, drei Jahren Bürgerschule und einem Jahr Handelsschule. Ein guter Schüler soll Bosel nicht gewesen sein. Doch die Inhaber der Firma sind begeistert, wie der neue Mitarbeiter an seine Aufgaben herangeht. Firmenchef Philipp Goldner wird später dem Wiener Tagblatt erzählen, dass Bosel ein Mitarbeiter war, wie man ihn sich nur wünschen konnte, ein „Praktikant par excellence – brav, anständig, fix, fleißig und vif“. Bosels Abteilungsleiter Michael Rosenbaum wird rückblickend sagen, dass der Super-Lehrling ein junger Mann mit „unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit“ gewesen sei. Bosel erweist sich bei „König & Goldner“ bald als Verkaufskanone.3 Auf Wunsch übernimmt der junge Sigmund auch die Zustellung von Wäschepaketen an so mache Hofratswitwe. Nebenbei erledigt er als dienstbeflissener Handlungsgehilfe für treue Kunden die eine oder andere Besorgung. Zu diesen Botengängen gibt es eine Anekdote, die fast zu gut ist, um wahr zu sein. Demnach hat sich Bosel von zusammengesparten Trinkgeldern eine Aktie gekauft, und zwar eine der Unionbank – jener Großbank, in der er am Höhepunkt seiner Karriere im Chefsessel thronen sollte.4
Im Frühjahr 1914 macht sich Sigmund Bosel selbständig. Mit seinem Arbeitskollegen Rosenbaum, der viel auf ihn hält, gründet er im Mai eine Firma für Wäschewaren, die im Handelsregister als „Pfaidlergewerbe“ eingetragen wird – dem damaligen Begriff für Kleidergeschäfte, die typischerweise Schürzen, Blusen und Hemden führen durften. Bosel ist tüchtig und zielstrebig, er will es in der Textilbranche weiter bringen als sein Vater Leopold, der als „armer Hausierer“ die Familie anfangs nur mit Müh‘ und Not ernähren konnte.5
Nach Wien gekommen war die Familie Bosel ursprünglich um das Jahr 1850 herum aus der Gegend um die südböhmische Stadt Znaim. Die k. u. k. Metropole erlebt damals einen Zuwanderboom, der durch die Industrialisierung und die Hoffnung auf bessere Arbeitsplätze ausgelöst worden ist. So wie die Familie Bosel zieht es auch viele andere jüdische Familien aus der Provinz in die Kaiserstadt. Manche von ihnen haben den Wiener Textilhandel bis in die Zwischenkriegszeit hinein geprägt.6
Bosels Mutter hieß mit Mädchennamen Nossig. Sie war mit ihren Eltern aus Lemberg in Galizien nach Wien übersiedelt, wo die beiden Zuwandererfamilien im selben Zinshaus landen. Leopold Bosel und Julie Nossig wachsen als Nachbarskinder auf und werden ein Liebespaar. Die beiden bekommen sechs Kinder: Max, Elsa, Sigmund, Olga, Robert und Alfred, wobei der älteste Sohn Max noch vor der Heirat geboren wird. Der kleine Sigmund erblickt das Licht der Welt als Nummer drei der Kinderschar am 10. Jänner 1893. Sein Zuhause ist ein rechtschaffenes kleinbürgerliches Elternhaus in Wien-Brigittenau, in dem das Geld kaum reicht. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich Bosel mit unermüdlichem Arbeitseifer hinaufarbeiten will.7
Bosel und Rosenbaum haben als Firmengründer eine interne Arbeitsteilung: Rosenbaum kümmert sich um die Finanzen, Bosel um den Verkauf. Vor allem die Damen-Kundschaft wird von ihm glänzend bedient.8 Obwohl Bosel ein begnadeter Verkäufer war, wäre ihm durch den Handel mit Leinen und anderen Stoffen aber keine außergewöhnliche Laufbahn geglückt. Denn der Textilsektor ist im Fin-de-Siècle-Wien alles andere als ein Wachstumsmarkt. Kleiderfabrikanten wie die Familiendynastie Mandl und andere haben ihre Marktanteile nach der Jahrhundertwende längst abgesteckt. Kaufhausmillionäre wie August Herzmansky oder Alfred Gerngroß und die vielen exklusiven Modesalons der Stadt können auf eine Fülle von Zulieferfirmen zurückgreifen. In den traditionellen Branchen ist die Luft für Neueinsteiger bereits dünn gewesen. Zum Reichwerden in der Ringstraßengesellschaft war Bosel zu spät auf die Welt gekommen.9
Sigmund Bosel ist 21 Jahre alt und gerade erst zwei Monate lang Unternehmer, als Ende Juli 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht. Hunderttausende bekommen ihren Einrückungsbefehl, und viele wollen vor lauter Kriegsbegeisterung schnell weg von ihrem Arbeitsplatz an die Front, um nur ja nichts vom mannhaften „Abenteuerausflug“ ins Feindesland zu versäumen. Nach den blutigen Verlusten bei den Sommerschlachten im Osten schlägt die anfängliche Kriegseuphorie der Bevölkerung jedoch bald um. Die Wirtschaft der Donaumonarchie muss auf einen langen und zermürbenden Krieg umgestellt werden. Die Militärmaschinerie beginnt, gewaltige Mengen an Lebensmitteln, Rohstoffen und Versorgungsgütern zu verschlingen.10
Für die Firmengründer Bosel und Rosenbaum ist der Kriegsausbruch kein guter Start. Im Geschäft bleiben kann Bosel nur dann, wenn er nicht eingezogen wird. Während sein Partner Rosenbaum 1915 einrücken muss, wird Bosel von der zuständigen Stellungskommission „aus gesundheitlichen Gründen“ für untauglich erklärt. Angeblich sollen auch „einflussreiche Damen“ dabei mitgeholfen haben, dass dem schmächtigen, aber charmanten Jungunternehmer der Militärdienst erspart geblieben ist.11
Diese Weggabelung des Schicksals hat in späteren Berichten über Bosels Aufstieg vom „allerkleinsten Ladenbesitzer zum Mitbeherrscher Österreichs“ eine wichtige Rolle gespielt. Viele haben sich gefragt, wie es Bosel nur angestellt hat, dass er ohne seinen Kompagnon bei der Versorgung von Kriegsflüchtlingen in großem Stil Kasse machen konnte. Die einen rühmten sein kaufmännisches Genie, während die anderen seinen Erfolg als das Produkt glücklicher Verbindungen abgetan haben.
Und so taucht in den schillernden Erzählungen über seine Anfänge als Flüchtlingslagerlieferant eine holde Fee auf, die Bosel die Hand zum Millionärsleben reicht. Und zwar in der Person einer hübschen Offiziersgattin, die als Tochter eines ehemaligen Sektionschefs beste Beziehungen zu diversen Entscheidungsträgern gehabt hätte, wie in der linken Boulevard-Zeitung Der Abend zu lesen war. „Das Milchgesicht Bosel, zitternd vor Aufregung, da er hier den Schlüssel zum Sesam wittert, setzt ihr mit allen Mitteln der Schauspielerei, mit Versprechungen, flehentlichen Bitten zu, sie möge sich seiner annehmen … und gibt es ihr mündlich und schriftlich, dass er den Gewinn aus allen Geschäften, die er ihrer Fürsprache verdankt, redlich mit ihr teilen werde.“12
Nachdem Der Abend an Bosel nie ein gutes Haar gelassen hat, überrascht es nicht, dass er der Zeitung zufolge seine Geschäftspartnerin später „mit einem Butterbrot abgespeist“ haben soll. Einer anderen Version nach hätte Bosel instinktiv erkannt, dass sich durch die Flüchtlingswellen im Windschatten der missglückten Feldzüge geschäftliche Chancen auftun könnten. Demnach soll er 1914 durch frühzeitige Hamsterkäufe ein Warenlager angelegt haben, mit dem er später bei der Belieferung von Flüchtlingslagern auftrumpfen konnte.13
Tatsache ist: Die Flüchtlingslager auf österreichischem Boden sind deshalb entstanden, weil der Krieg große Menschenmassen in Bewegung gesetzt hatte. Anfangs handelte es sich um die Bewohner der Grenzgebiete zu Serbien und Russland. Ganz Landstriche wurden evakuiert, um die gefährdete Zivilbevölkerung vor den Kampfhandlungen in Sicherheit zu bringen. Die Kriegsplaner wollten die Truppen auch ungestört und unbeobachtet bewegen können. Zehntausende Untertanen des Kaisers wurden zwangsweise umgesiedelt. Im August 1914 kam es deshalb in Galizien und in der Bukowina zu einer ersten Völkerwanderung in das Innere der Monarchie, wie der Historiker Manfried Rauchensteiner in seinem Standardwerk über den Ersten Weltkrieg schreibt.14
Wenige Wochen nach Kriegsbeginn musste die k. u. k. Armee schwere Niederlagen gegen russische Truppen einstecken. Es kam der Befehl zum Rückzug, der eine gewaltige Flüchtlingslawine ins Hinterland der österreichischen Reichshälfte auslöste. Im November 1914 gab es in Wien bereits 140.000 Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina. Weil die beiden Gebiete zur österreichischen Reichshälfte gehörten, musste Österreich weit mehr Flüchtlinge aufnehmen als Ungarn, wo man sich mit allen Mitteln der Kunst gegen die k. u. k. Landsleute gewehrt hat. Die österreichischen Behörden sind deshalb vor der Herausforderung gestanden, dass hunderttausende Menschen entweder nach Böhmen, nach Mähren oder ins Innere Österreichs gelenkt werden mussten. Somit hat sich das Innenministerium in Wien darum kümmern müssen, dass die vielen mittellosen Flüchtlinge möglichst rasch in österreichischen Auffanglagern untergebracht werden. Aufgebaut wurden diese Lager meist von Kriegsgefangenen und von Privatfirmen. Ortsansässige Handwerker sind dadurch zu Aufträgen gekommen. Mit der Errichtung der Lager war es aber nicht getan. Die Menschen in den Barackensiedlungen mussten laufend mit Nahrung versorgt werden. Sie haben auch Taschengeld bekommen und sie wurden mit Bekleidung, Schuhwerk und Decken ausgerüstet.15