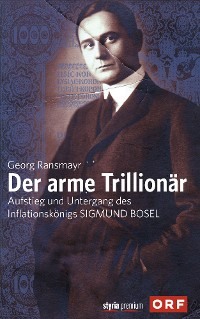Kitabı oku: «Der arme Trillionär», sayfa 5
Anmerkungen
1
Die Börse, 6. 12. 1923.
2
Die Börse, 11. 11. 1926; Julie Marks in der TV-Doku „Der Massenmörder und der Trillionär“ (ORF, 2013).
3
Hoffmann, Der Fall Sigmund Bosel, 9 ff.
4
Berliner Tageblatt, 11. 11. 1926; Franz, Siegmund Bosel, 5 f.
5
WStLA, Handelsregister, „Bosel & Rosenbaum“, Sign. 2.3.3.B76. 29. 231; Hoffmann, 10; Franz, 4.
6
Österreichische Industriegeschichte GmbH (Hrsg.): Österreichische Handelsgeschichte, 169.
7
Hoffmann, 8 f.; Max Bosel, der Erstgeborene, ist bereits 1908 im Alter von 21 Jahren gestorben.
8
Neues Wiener Tagblatt, 19. 1. 1927.
9
Sandgruber, Traumzeit für Millionäre, 55 ff.
10
Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie, 204 ff.
11
Tagblatt, 7. 7. 1937; Hoffmann, 11.
12
Der Abend, 9. 11. 1923.
13
Franz, 6 f. – Hinter dem Namen „Karl Franz“ stand der Journalist Bruno Frei, der auch für die Zeitung Der Abend tätig war und 1926 unter seinem Pseudonym eine frühe Biografie über Bosel herausgebracht hat.
14
Rauchensteiner, 836 ff.
15
Prager Tagblatt, 18. 10. 1918.
16
Rauchensteiner, 842 f.
17
Franz, 7.
18
SchobA, Zeugenvernehmung Schober, Vr XXXI 4844/23, 25. 10. 1923; Berger, Zur Situation des öst. Bürgertums nach dem 1. WKR, in: Konrad/Maderthaner (Hrsg.), … der Rest ist Österreich, Bd. 2, 78.
19
Rauchensteiner, 588 ff.; Wiener Zeitung, 22. 4. 1916.
20
ÖStA – AdR, HBbBuT BMfHuV Präs, Auszeichnungsanträge, Bosel, 2664/1920: Schreiben der Polizeidirektion Wien an das Staatsamt für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten, 21. 6. 1920.
21
Wiener Zeitung, 28. 1. 1917; Franz, 8.
22
Rauchensteiner, 845 f.; Prager Tagblatt, 18. 10. 1918.
23
Franz, 8; Lewinson, Die Umschichtung der europäischen Vermögen, 251.
24
Wiener Zeitung, 28. 1. 1917.
25
Wiener Zeitung, 16. 3. 1917.
26
Amtsblatt zur Wiener Zeitung, 4. 7. 1917; Tagblatt, 7. 7. 1937, Die Presse, 5. 1. 2014; ÖStA – AdR, HBbBuT BMfHuV Präs, Auszeichnungsanträge, Bosel 2664/1920, 21. 6. 1920.
27
Frei, 8; Der Abend, 1. 2. 1926.
28
Der Abend, 12. 4. 1926.
29
Wiener Zeitung, 11. 9. 1918.
30
Ufermann, Könige der Inflation, 77.
31
Scheffer, Bankwesen, 354.
32
WStLA, Vr 2562/37 3/226C Einvernahme Bosel, 5. 7. 1926; Reichspost, 19. 12. 1926.
33
Rauchensteiner, 995 ff.
34
Arbeiter-Zeitung, 6. 6. 1918.
35
Arbeiter-Zeitung, 17. 6. 1918; Reiter, Gustav Harpner, 503.
36
SchobA 95, Schober: „An das Präsidium des k. k. Ministeriums des Inneren“.
37
ÖStA, AdR, HBbBuT BMfHuV Präs, Auszeichnungsanträge, Bosel, 2664/1920, 21. 6. 1920; SchobA 95, LG Wien Vr XXXI 4844/23, Zeugenaussage Schober, 25. 10. 1923.
38
Hubert, Schober, 65.
39
SchobA 95, Schober: „Wie ich … Bosel kennenlernte“, SB an Schober, 27. 2. 1919.
40
ÖStA AdR, HBbBuT BMfHuV Präs, Auszeichnungsanträge, Bosel, 2664/1920, 21. 6. 1920.
41
Ebenda.
42
SchobA 95, Zeugenaussage Schober, 25. 10. 1923, LG Wien, Geschäftszahl Vr XXXI 4844/23.
43
SchobA 95, Schober: „Wie ich Herrn Präsident Siegmund Bosel kennenlernte“.
44
Hubert, 61.
45
Ebenda, 65 ff; Brandl, Kaiser, Politiker und Menschen, 284; SchobA 95, SB an Schober, 18. 12. 1922.
46
SchobA 95, SB an Schober, 28. 2. 1919.
47
SchobA 95, Sitzungsprotokoll vom 3. 3. 1919.
48
SchobA 95, Brief an den Verwaltungsausschuss, 15. 10. 1919.
49
SchobA 95, Schober: „Wie ich Herrn Präsident Siegmund Bosel kennenlernte“.
4 – IM KLUB DER GLÜCKSRITTER
Die Stadt, in der Sigmund Bosel sein Vermögen aus dem Krieg in den Frieden hinübergerettet hatte, war 1919 nur mehr ein Abklatsch ihrer alten Größe. Wien hatte als Metropole einer Großmacht abgedankt. Die Stadt war nun das überdimensionierte Zentrum einer kleinen Alpenrepublik, die in einer kolossalen Identitätskrise steckte. Der Bestseller-Autor Hans Habe, der auch Sigmund Bosel persönlich kannte, hat den Knacks im rot-weiß-roten Selbstwertgefühl später so umrissen: Österreich sei „eine Operette mit tragischem Ausgang“ gewesen.1 Als am 12. November 1918 in Wien die Republik ausgerufen wurde, nannte sich der frischgeborene Staat „Deutsch-Österreich“. Gedacht war er als Zwischenstufe bis zum Anschluss an das neue demokratische Deutschland. Doch der Friedensvertrag von Saint-Germain erlaubte der Ersten Republik keinen Zusammenschluss mit der Weimarer Republik. Die Nachkriegsösterreicher mussten also die Suppe alleine auslöffeln, die ihnen der ach so gute alte Kaiser durch seine gemeingefährliche Bereitschaft für den „großen“ Krieg eingebrockt hatte.
Das Ende der Monarchie war für die Bevölkerung ein Wechselbad der Gefühle. Für die einen war es ein Untergang, für die anderen ein Umbruch, durch den mit der lästigen Bevormundung durch die Aristokratie endlich Schluss war. Doch dem Staat, den keiner in der Form wollte, wie er Wirklichkeit geworden war, fehlte es an Energie und Selbstsicherheit. Viele Bewohner konnten sich nicht vorstellen, dass ihr neues Staatsgebilde überlebensfähig war. Österreich war ein Armenhaus mit abertausenden Kriegswitwen, Waisenkindern und verkrüppelten Heimkehrern, in dem noch dazu die Spanische Grippe wütete. Die Kriegsgeneration war verbittert, das Bürgertum wirkte orientierungslos, die Arbeiterschaft sehnte sich nach einer sozialen Revolution. Am allermeisten wurde die Katerstimmung im Land aber von der katastrophalen Geldentwertung getragen. Sie war eine gewaltige Vermögensumverteilung und erzeugte einen enormen Politfrust.
Traumatisiert von der Inflation, verloren viele Menschen den Blick darauf, dass es während der rot-schwarzen Koalition von 1918 bis 1920 wichtige sozialpolitische Errungenschaften gab – wie das Allgemeine Wahlrecht auch für Frauen, das Arbeitslosengeld oder den Acht-Stunden-Arbeitstag. Im Tollhaus der Inflation ging der staatsbürgerlich-emanzipatorische Wert dieser Reformen unter, wie der Schriftsteller Hugo Bettauer 1922 in seinem Roman Der Kampf um Wien beklagt hat: „Die Bürger waren nie so frei, wussten aber nichts Rechtes damit anzufangen, und sehnten sich zurück nach der Monarchie mit ihren Orden und Titeln.“2
Um eine republikanische Ersatzbefriedigung für die althergebrachte Titelsucht zu schaffen, haben auch die Würdenträger der Ersten Republik munter Ehrungen verteilt. Was der inflationär vergebene Hofratstitel für die Beamtenschaft war, sollte in der Welt der Wirtschaftstreibenden der „Kommerzialrat“ werden. Diesen Titel hatte es so wie den „Hofrat“ in der Monarchie auch schon gegeben. Als Anerkennung für kommerzielle Leistungen hatte man den prestigeträchtigen „Kommerzialrat“ zu Kaisers Zeiten allerdings nicht vergeben. Ihn bekamen nur Mitglieder einer berufsständischen Kommission, die mit der Export-Statistik zu tun hatte. War die Funktionsperiode um, war die Auszeichnung wieder weg. Außer der Kaiser „geruhte“, den Titel in speziellen Fällen auf Lebenszeit zu verlängern. Nach Kriegsende hing die Kommerzialratswürde eine Zeit lang in der Luft. Die erwähnte Kommission gab es zwar weiterhin, aber die Republik hatte Wichtigeres zu tun, als dieses Gremium zu erneuern.3
Im Juni 1920 flattert dann im Handelsministerium, genauer gesagt, im damaligen „Österreichischen Staatsamt für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten“ ein Antrag der Wiener Polizei auf den Tisch. Sigmund Bosel möge doch für seine Verdienste mit dem Kommerzialratstitel belohnt werden, heißt es darin. Die mitgelieferte Begründung kommt von Polizeipräsident Schober höchstpersönlich: „Ich erlaube mir, die Aufmerksamkeit auf die verdienstvolle Betätigung zu lenken, welche Sigmund Bosel als kommerzieller Leiter des Lebensmittellagerbetriebes der Polizeidirektion in Wien im Interesse der mir unterstehenden Behörde, wie auch unmittelbar im Interesse der Republik Österreich entfaltet hat und bitte, für ihn eine Auszeichnung zu erwirken.“4
Den Beamten fällt auf, dass für den jungen Kaufmann parteipolitische Schwergewichte intervenieren. Allen voran der Hausherr und amtierende Ressortchef, der Sozialdemokrat Wilhelm Ellenbogen. Auch Matthias Eldersch, der sozialdemokratische „Staatssekretär für Inneres“, unterstützt den Antrag. Und zwar „wärmstens“, wie Eldersch in einem Begleitbrief meint.5 Befürwortet wird die Angelegenheit gleichfalls vom christlichsozialen Spitzenpolitiker Eduard Heinl. „Nachdrücklichst“, wie Heinl wissen lässt. Sigmund Bosel hat gewichtige Fürsprecher aus der roten und schwarzen „Reichshälfte“, die sich für einen Kommerzialratstitel ins Zeug legen.
Die großkoalitionäre Politikerphalanx holt sich vom Beamtenapparat jedoch eine Abfuhr. Die Republik könne funktionsgebundene Kommerzialratstitel nicht freihändig verleihen, erklärt das Präsidialbüro. Die beiläufige Anregung der Politiker, Bosel doch in die neu zu gründende Statistik-Kommission zu entsenden, damit er „auf diesem Weg des Kommerzialratstitels teilhaftig“ werde, blocken die zuständigen Stellen bockig ab. Man brauche kein extra bestelltes Mitglied und schon gar keinen 27-Jährigen mit Protektion. Die Beamten bekommen den politischen Willen aber recht bald zu spüren. Im November 1920 wird Bosel zum Mitglied des Beirates für Handelsstatistik ernannt. Damit darf er während der Dauer seiner Mitgliedschaft den Titel „Kommerzialrat“ führen.6
Einige Monate später bekommt Bosel den heiß ersehnten Titel ein zweites Mal verliehen, diesmal aber auf Lebenszeit. Die Republik hat auf Empfehlung des Handelsministeriums, in dem mittlerweile Eduard Heinl das Kommando führt, den „Kommerzialrat“ neu eingeführt, und zwar explizit für Wirtschaftstreibende, die sich besondere Verdienste erworben haben. Im März 1921 verlautbart die Präsidentschaftskanzlei, wer zur Riege der Auserwählten gehört. Bosel steht ganz oben auf der Liste, er ist der erste und mit Abstand jüngste Kommerzialrat der Ersten Republik.7
Hätte die Monarchie überlebt, wäre Bosel wie vereinbart mit dem Titel „Kaiserlicher Rat“ belohnt worden. Früher oder später hätte man ihn dann wohl auch in den Adelsstand erhoben. Nachdem Adelstitel bereits vor dem Ersten Weltkrieg käuflich zu haben waren, hätte der junge Bosel für eine Nobilitierung sicher freudig in die Tasche gegriffen.8 Nach dem Krieg waren solche Gedankenspielereien jedoch Schnee von gestern. Das Parlament hatte den Adel per Gesetz abgeschafft. Damit war die gesellschaftliche Zugehörigkeit nun mehr denn je eine Frage des Geldes.
Das Gespenst der Nachkriegsinflation
Doch mit dem Geld war das in der Ersten Republik so eine Sache. Viele Menschen hatten den Glauben ans Geld komplett verloren. Stefan Zweig schrieb über das Jahr 1919 in seinem Roman Rausch der Verwandlung: „Ein ganzer Winter von Banknoten und Nullen schneit vom Himmel. Hundertausende, Millionen, aber jede Flocke, jeder Tausender schmilzt dir in der Hand.“9
Es gab Tage, an denen die Preise stündlich in die Höhe kletterten und verzweifelte Konsumenten die Geschäfte stürmten. Hausfrauen investierten ihr Geld auf Teufel komm‘ raus in unverderbliche Erzeugnisse wie Kaffee oder Kristallzucker. Und das bei immer monströser anmutenden Preisen. Anfang 1914 hatte ein Kilo Kristallzucker noch weniger als eine Krone gekostet. Im Jänner 1921 waren es schon 96 Kronen, im Oktober 1923 absurde 12.400 Kronen pro Kilo. Durch die horrende Inflation ist den Menschen damals das Geld buchstäblich zwischen den Fingern zerronnen. Wien war „bevölkert von notleidenden Millionären“, die sich nichts mehr leisten konnten.10
Die Geldentwertung war freilich schon mit der Mobilmachung im August 1914 losgetreten worden. Stolz und blindwütig war die Monarchie in einen Waffengang gestolpert, für den sie weder militärisch noch finanziell vorgesorgt hatte. Als sich der schnelle Sieg als eine grauenhafte Illusion erwiesen hatte und die Kriegskosten explodierten, brachte das Kaiserreich eine Reihe von Kriegsanleihen unters Volk. Mit dem Geld, das dadurch hereinkam, konnte die Finanzverwaltung immerhin 60 Prozent der Kriegskosten bis 1918 decken. Die restlichen 40 Prozent „bezahlte“ der Staat, indem er sich immer größere Kredite bei der k. u. k. Notenbank genehmigte, die für die notwendige Geldschwemme sorgte. Für das viele Papiergeld gab es im Lauf des Krieges aber immer weniger zu kaufen. Für die verbliebenen Waren und Lebensmittel sind die Preise daher in den Himmel geschossen. Im November 1918 musste man für einen typischen Einkaufskorb 16-mal so viel zahlen wie im Juli 1914.11
Nach der kriegsbedingten Inflation wurde Österreich Ende 1918 von einer Nachkriegsinflation erfasst, die sich an den Versorgungsengpässen in vielen Bereichen der Wirtschaft entzündete. Ab September 1919 verschärften sich die Preissteigerungen, weil der Friedensvertrag von Saint-Germain für Österreich herbe Enttäuschungen brachte. Die Teuerung fing an zu galoppieren, bevor sie im Herbst 1921 komplett ausuferte und den Staat bis Oktober 1922 durch einen hyperinflationären Würgegriff beinahe in den Ruin trieb. Darüber hinaus war der Wechselkurs der österreichischen Krone nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie in den Keller gerasselt. Dadurch explodierten die Importpreise für Kohle, Rohstoffe und Lebensmittel, was die Inflation zusätzlich anheizte. Die Erste Republik kam budgetär nur über die Runden, indem sie auf Teufel komm‘ raus das benötigte Geld ungeniert drucken ließ. Oder wie der Kaffeehaus-Literat Anton Kuh ironisch gemeint hat: „Der Staat lebte nur noch vom Banknotenfälschen.“12
Der Glaube ans Geld wurde vom Glauben ans Glück abgelöst. Um den erlösenden Tipp für die Flucht aus dem Alltag zu erheischen, boomte das Geschäft mit der Hellseherei. Aus der „Alles ist hin“-Stimmung wurde die „Alles oder nichts“-Stimmung, die zu einer Spielleidenschaft führte, die breite Schichten wie eine Epidemie erfasste.13
Der Mittelstand war auch demoralisiert genug, um leichtlebigen Verdrängungsmechanismen zu verfallen. Viele hatten ihre Ersparnisse in festverzinslichen Kriegsanleihen angelegt, die wertlos geworden waren. Vor allem die Beamten und ehemaligen Offiziere konnten von ihrem früheren Leben nur mehr träumen. Viele mussten den Familienschmuck ins Pfandhaus tragen. Andere halfen sich damit, dass Untermieter aufgenommen oder private Spielsalons mit Bewirtung aufgezogen wurden oder – Ehefrauen und Töchter der Prostitution nachgingen, um das karge Haushaltsbudget aufzubessern. Nicht umsonst wird in den „Inflationsromanen“ der Zwischenkriegszeit häufig die Armutsgefährdung thematisiert, die viele Frauen schichtenübergreifend dazu gezwungen habe, sich zu verkaufen.14
Aber auch dort, wo die Finanznöte nicht so dramatische Auswirkungen hatten, war der Mittelstand von Abstiegsängsten geplagt. Einfache Industriearbeiter kamen nämlich mit ihren Löhnen, die periodisch an die Geldentwertung angepasst wurden, immer näher an das Einkommensniveau der bürgerlichen Mittelschichten heran. Schwer angeknackst war das Selbstwertgefühl des Beamtenbürgertums durch das Erscheinen wirtschaftskundiger Newcomer mit kleinbürgerlichem Hintergrund. Ihr Erfolg ließ standesbewusste Inflationsverlierer als Versager dastehen. Die wirren Nachkriegsjahre waren eben eine Zeit, in der sich talentierte Aufsteiger und erfolgshungrige Zuwanderer durchschlängeln und hinaufarbeiten konnten.15
Man darf auch nicht glauben, dass die Geldentwertung damals ganz Österreich in ein ruinöses Flimmerlicht tauchte und überall nur Jammerstimmung geherrscht hat. Im Gegenteil: 1921 gab es eine kurze Hochkonjunktur mit Vollbeschäftigung. Die Baubranche erlebte durch den Siegeszug der E-Wirtschaft einen Aufschwung. In bestimmten Branchen konnten innovationsfreudige Firmen dem üblen Wirtschaftsklima durchaus Paroli bieten.16
Die Tricks der Inflationsgewinnler
Die Inflation, die ganz Wien elektrisiert hat, war für Sigmund Bosel keine Tragödie. Der junge Kommerzialrat kann sich 1920 glücklich schätzen, dass er zu Kriegszeiten seine Gewinne teilweise ins Ausland transferiert hat. Während die inländischen Sparguthaben durch die Geldentwertung ausradiert werden, hat Bosel Fremdwährungen in der Hinterhand. Damit entwickelt der Millionär, der sich inflationsbedingt schnell zum Milliardär mausert, eine gewaltige Kaufkraft.
Überhaupt sind damals all jene fein heraus gewesen, denen der Wunderglaube gefehlt hat, dass die Monarchie den Krieg gewinnt und überlebt. Manche haben schon vor 1918 ihr Vermögen in die Schweiz und andere neutrale Staaten verfrachtet. Als im Frühjahr 1919 die Angst umgeht, dass mit dem ungarischen Kommunisten Béla Kun der Funke der Revolution auf Wien überspringt, nimmt die Kapitalflucht aus Österreich enorme Dimensionen an. Der Wert der „Krone“ stürzt in den Keller. In Wien und anderswo wollen auf einmal alle ihre Kronen-Banknoten loswerden, so als würden die Scheine einen schädlichen Virus übertragen. Der ständige Währungsverfall wird zu einer Begleiterscheinung der Inflation.17
Der ökonomische Hausverstand sagt damals, dass man durchs Schuldenmachen reich werden kann. Indem man vorzugsweise auf Pump Wertpapiere oder Wertsachen kauft und sich mit den Kreditraten Zeit lässt. Bis 1922 ist dieses Geschäftsprinzip mit etwas Glück und Nervenstärke deppensicher gewesen. Man hat nur jemanden finden müssen, der einem Geld borgt. Denn wegen der horrenden Inflation rechnet sich praktisch jede Investition. Während die ausgeborgte Darlehenssumme gleich bleibt, steigen die erzielbaren Erlöse wie das Amen im Gebet. Damit wird jede Kredit-Rückzahlung ein Kinderspiel. Der 1999 verstorbene Börsen-Guru André Kostolany hat das Wesen der Nachkriegsinflation daher so umrissen: „Die Inflation ist die Hölle der Gläubiger und das Paradies der Schuldner.“18
Zu den Tricks der Inflationsgewinnler gehört auch eine andere Methode – nämlich Rechnungen, die auf einen fixen Kronen-Betrag lauten, so spät wie möglich zu begleichen. Einkäufer mit einer laxen Zahlungsmoral haben mit dieser Masche de facto Zusatzrabatte einstreichen können. Irgendwann hat wohl auch Sigmund Bosel damit angefangen, seine Zahlungsfristen zu strecken. Gleichzeitig nimmt sich der Finanzjongleur bei seinen Hausbanken in großem Stil Kredite, mit denen er neben Aktien und Schmuck auch Immobilien und Firmenübernahmen finanziert. „Bosel verstand am frühesten von allen die Melodie der Zeit, die einfach wie ein Gassenhauer war: Kronen schuldig bleiben und Sachwerte auftürmen. Da er diese Parole am zügigsten aufgriff, galt er eben als genial.“19

In den Geschäften der Luxuswarenhersteller und Schmuckhändler sind die neureichen Inflationsgewinnler gerne gesehen.
Sigmund Bosel ist damals nicht mehr der Bittsteller von einst, der die Hinterstiegen hinaufeilt, um devot in Empfangszimmern vorzusprechen. Der schmächtige Mann mit der lässigen Haltung und den scheuen, dunklen Augen beschäftigt mittlerweile selbst einen Empfangsdiener, der Geschäftspartner anmeldet oder unliebsame Kunden hinauskomplimentiert. Mit Hilfe der Verkehrsbank, die zu den führenden Wiener Finanzhäusern gehört, und dem Buchhalter Karl Rosenberg hat Bosel auch seine Buchführung in Ordnung gebracht, die lange Zeit recht salopp geführt wurde.20 So etwas kann sich der angehende Finanzkrösus nicht mehr leisten. Er ist im Big Business angekommen.
Bosel spürt jedoch, dass er für seinen Expansionsdrang mehr Knowhow und Kontakte braucht. Der nimmermüde Geschäftsmann wirbt daher von staatlichen Einrichtungen wie der Volksbekleidungsstelle oder der Devisenzentrale Mitarbeiter ab. Diese Leute versprechen sich im Windschatten des Aufsteigers höhere Gehälter als im karg entlohnten Staatsdienst. Neben dem Diplomaten Richard Oppenheimer-Marnholm holt Bosel auch zwei Sektionschefs in seinen wachsenden „Hofstaat“. Einer der beiden Herren wird der Majordomus für alle Diener, Referenten und Sekretäre in der Bosel’schen Firmenkanzlei. Der andere Sektionschef wird als Spezialberater und Deutschlehrer eingestellt. Er soll Bosel, der Hemmungen hat, in einem größeren Kreis vor anderen zu sprechen, den rhetorischen Schliff verpassen.21
Seinen wichtigsten Vertrauensmann hat Bosel bereits 1917 kennengelernt. Es ist dies der Anwalt Wolfgang Dawid, den es als Kriegsflüchtling aus der ukrainischen Stadt Czernowitz nach Wien verschlagen hat. Dawid wird Bosels engster Rechtsberater, sein Generalbevollmächtigter in Firmen und Aufsichtsräten sowie sein Mittelsmann bei heiklen Verhandlungen. Dass sein Kumpan mit dem christlich-sozialen Handelsminister Eduard Heinl befreundet ist, hat Bosel bei der Erlangung des Kommerzialratstitels geholfen. Zwei Jahrzehnte lang werden Bosel und Dawid beruflich durch dick und dünn gehen.22
Nach seinem Rückzug aus den Versorgungsbetrieben der Polizei baut Bosel still und leise seine Geschäfte aus. Mitte 1919 tritt der Kronen-Milliardär erneut als Unternehmensgründer in Erscheinung. Die Firma, die er bis dahin hatte, war noch der Gemischtwaren-Großhandel aus Kriegszeiten. Nun macht Bosel ein richtiges Handelshaus auf – mit dem vielsagenden Namen „Omnia“. Geschäftszweck des Unternehmens sind Import-Export-Geschäfte aller Art mit Waren quer durch den Gemüsegarten. Geschäftsführer und Mitgesellschafter ist der Wiener Karl Landeis, der viele Jahre später im Leben von Bosels Freundin Ilona Schulz noch eine wichtige Rolle spielen wird.
Bosel bringt mit der Omnia einträgliche Deals im staatsnahen Bereich zustande, indem er bei der Verwertung übrig gebliebener Armeebestände mitmischt und gehortete Textilien verkauft. Als das erste Geschäftsjahr vorbei ist, steigt Bosel von der Verkehrsbank auf die Länderbank als Kreditgeber um, bevor sein Handelshaus in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wird. Kritische Beobachter sagen später, dass Bosel nicht als „Schieber“ gelten wollte und sich daher hinter der Omnia versteckt hätte.23
Über das Handelsunternehmen, das sich am Friedrich-Schmidt-Platz Nummer 5 unweit vom Wiener Rathaus einquartiert, dringt nur wenig nach außen. Länderbank-Generaldirektor Markus Rotter und der christlich-soziale Minister Heinrich Mataja mischen im Hintergrund mit. Gehandelt wird nicht nur mit Textilien, sondern auch mit Nahrungsmitteln, Kohle und Naphtalin. Dieser Stoff wird damals zur Herstellung von Treibstoffzusätzen und Mottenkugeln verwendet.24
Zu einer unheimlichen Geldmaschine entwickelt sich die Omnia aber durch ihre Tabakimporte. Ende 1921 sichert sich Bosel Lieferverträge mit der staatlichen österreichischen Tabakregie, dem Vorläuferunternehmen der Austria Tabak. Es geht um die Einfuhr von 2.000 Tonnen bulgarischem Rohtabak. Zur Relation: Österreich verbraucht damals in etwa 14.000 Tonnen Rohtabak pro Jahr. Die Omnia fädelt einen großangelegten Vertrag ein, wodurch andere Tabakhändler das Nachsehen haben. Österreich wird für Bulgarien der wichtigste Tabak-Abnehmer. Bosel bekommt dafür 1923 einen bulgarischen Orden verliehen – das Komturkreuz mit dem Stern.25