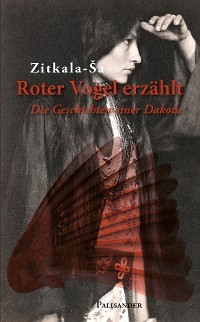Kitabı oku: «Roter Vogel erzählt», sayfa 5
Allein in meinem Zimmer saß ich gleich der versteinerten Indianerfrau da, von der mir meine Mutter oft erzählt hatte. Ich wünschte, dass die Last auf meinem Herzen mich in einen gefühllosen Stein verwandeln würde. Wie hilflos war ich doch, lebendig in meinem Grab!
Für die Schriften des Weißen Mannes hatte ich meinen Glauben an den Großen Geist aufgegeben. Für eben diese Werke aus Papier hatte ich die Heilkraft von Bäumen und Bächen vergessen. Wegen der einfachen Weltsicht meiner Mutter und weil ich selbst überhaupt keine Weltsicht mehr besaß, hatte ich auch meine Mutter aufgegeben. Ich hatte keine Freunde gefunden unter den Menschen der mir verhassten Rasse. Einst war ich gleich einem schlanken Bäumchen in der Mutter, in der Natur und in Gott verwurzelt gewesen, und nun war ich entwurzelt. Meine Zweige, die einst in Mitleid und Liebe für die Heimat und die Freunde gewedelt hatten, waren mir abgeschlagen worden, und meine Rindenhaut, die mein übersensibles Wesen geschützt hatte, war im Handumdrehen abgeschabt.
Ich schien nun nichts weiter zu sein als eine kalte, kahle Stange, die man in fremden Boden gepflanzt hatte. Doch noch immer hatte mich die Hoffnung nicht verlassen, dass der Tag kommen würde, an dem mein sprachloses, schmerzendes Haupt sich zum Himmel höbe und all mein Leid sich in einem gewaltigen Blitz entlüde, der den Himmel von einem Ende zum anderen zerrisse. Mit diesem Traum davon, dass mein allzu lang eingepferchtes Bewusstsein endlich Befreiung finden würde, konnte ich wieder unter den Menschen wandeln.
Schließlich, nach einem anstrengenden Tag im Klassenzimmer, kam mir die Idee von einer neuen Möglichkeit, wie ich das Problem meines innersten Wesens lösen könnte. Ich gab meine Stellung als Lehrerin auf, und heute lebe ich in einer Stadt des Ostens und absolviere die umfangreiche Ausbildung, die ich mir selbst auferlegt habe.
Wenn ich jetzt auf die jüngere Vergangenheit zurückblicke, so sehe ich sie aus der Ferne als ein Ganzes. Ich erinnere mich daran, wie den ganzen Tag über, vom Morgen bis zum Abend, immer wieder Exemplare zivilisierter Menschen die Indianerschule besichtigt haben. Die Stadtleute waren mit Gehstöcken und Brillen ausgestattet, die Landleute hatten sonnenverbrannte Gesichter und plumpe Füße. Doch in ihrer geradezu kindlichen Neugierde vergaßen sie allesamt ihren jeweiligen sozialen Rang. Beide Typen dieser christlichen Bleichgesichter waren gleichermaßen erstaunt, sobald sie sahen, dass die Kinder von wilden Kriegern so fügsam und fleißig waren.
Wenn sie nun ihre oberflächlichen Fragen stellten, dann wurden ihnen Beispiele von Schülerarbeiten gezeigt. Nachdem sie die ordentlich beschriebenen Seiten betrachtet und zugeschaut hatten, wie sich die indianischen Mädchen und Jungen über ihre Bücher beugten, verließen die weißen Besucher das Schulhaus hochzufrieden: Man erzog die Kinder des Roten Mannes! Sie zahlten einen großzügigen Beitrag für die Regierungsangestellten, in deren fähigen Händen sich der kleine Wald aus indianischem Holz befand.
Auf diese Weise sind in den letzten zehn Jahren viele Leute müßig durch die Indianerschulen geschlendert und haben sich danach ihrer Wohltätigkeit gegenüber den nordamerikanischen Indianern gebrüstet. Doch nur sehr wenige haben innegehalten, um nachzufragen, ob sich eigentlich hinter diesem Anschein von Zivilisation wirkliches Leben oder ein langanhaltendes Sterben verbarg.
Der Große Geist
Wenn der Geist in meiner Brust anschwillt, liebe ich es, ziellos zwischen den grünen Hügeln umherzustreifen. Manchmal setze ich mich dann auch an den Rand des murmelnden Missouri, und ich bewundere das große Blau in der Höhe. Mit halbgeschlossenen Augen beobachte ich die gewaltigen Schatten der Wolken in ihrem lautlosen Spiel auf den hohen Felsen am gegenüberliegenden Ufer, während das plätschernde Lied des Flusses mit seinen sanften Rhythmen in meinen Ohren klingt. Die Hände ruhen verschränkt – und vergessen – auf meinem Schoß. Klein wie ein pulsierendes Sandkorn liegen mein Herz und ich auf dem Boden. Die dahinziehenden Wolken, das leise klickernde Wasser und die Wärme eines milden Sommertages zeugen beredt von dem liebevollen Geheimnis, das uns umgibt.
Während der Mußezeit, die ich am sonnigen Uferrand verbrachte, bin ich ein wenig gewachsen, wenn auch nicht so üppig wie das grüne Gras, das die Kante des hohen Felsens hinter mir säumt. Schließlich gehe ich den kaum erkennbaren Pfad, der die steile Uferböschung hinaufführt, wieder zurück, weil es mich zu dem ebenen Land zieht, auf dem die wilden Blumen der Prärie blühen. Und sie, diese anmutigen kleinen Geschöpfe, besänftigen mit ihrem duftenden Atem meine Seele. Ihre hübschen, runden Gesichter von den unterschiedlichsten Farben überzeugen das vor froher Überraschung in der Brust hüpfende Herz, dass auch sie lebende Symbole eines allmächtigen Gedankens sind. Mit dem eifrigen Auge eines Kindes trinke ich die unzähligen sternförmigen Muster, die mit verschwenderischer Farbenpracht in das Grün eingeflochten sind. Die spirituelle Essenz, die sie verkörpern, ist einfach schön.
Ich überlasse sie, die im Windhauch leise schwanken, sich selbst, aber den Eindruck, den sie in meinem Herzen hinterlassen haben, nehme ich mit mir. Ich mache Halt, um mich auf einem Felsblock auszuruhen, der an der Flanke eines Hügelausläufers eingebettet liegt, und von dem aus der Blick auf die tiefergelegenen Flussauen geht. Hier tollt der Steinknabe herum, von dem die Ureinwohner Amerikas berichten. Er versendet seine Kinderpfeile und schreit laut vor Freude über die winzigen Blitzstrahlen, die die glänzenden Pfeilspitzen im Fluge aussenden. Was für ein vollendeter Krieger er doch wurde, der der Belagerung des Schädlingsgetiers aus dem ganzen Land standhielt, bis er schließlich ihren vereinten Angriff zurückschlug. Und hier lag er – Inyan, unser Urgroßvater, älter als der Hügel, auf dem er ruht, älter als die Rasse der Menschen, die von seiner wunderbaren Laufbahn erzählen.
Diese indianische Legende von dem Felsblock hat mich ergriffen, und ich möchte gern das feinsinnige Wissen der Alten erfassen, dank dessen sie eine Verwandtschaft zwischen allem, was sich in diesem unermesslichen Universum befindet, erkennen konnten.
Ich lasse mich von einem alten Pfad in Richtung des Indianerdorfs führen.
Ein starkes, glückliches Empfinden, dass sowohl das Große wie das Kleine Raum hat in Seiner Gewaltigkeit, das jeglichem Ding sein eigenes, individuelles Feld an Möglichkeiten zugewiesen ist, versetzt mich in Hochstimmung.
Ein Vögelchen mit gelber Brust schaukelt auf dem schlanken Stengel einer wilden Sonnenblume und trällert seine liebliche Zustimmung zu alledem, als ich nahe an ihm vorübergehe. Es unterbricht sein kristallklares Lied, dreht sein winziges Köpfchen von Seite zu Seite und beäugt mich weise, während ich langsam auf meinen Mokassins vorbeischlendere. Und schon gibt es sich wieder ganz seinem Jubelgesang hin. Schwirrend und flatternd, bald hierhin, bald dorthin, erfüllt es den sommerlichen Himmel mit seiner flotten, süßen Melodie. Und es scheint wahrhaftig so zu sein, dass es eher sein kleiner Geist ist, der ihm seine lebendige Freiheit verleiht, als seine Flügeln.
Mit solchen Gedanken gelange ich zur Blockhütte, zu der mich die starke Bindung eines Kindes an seine bejahrte Mutter zieht. Mein vierbeiniger Freund kommt mir entgegengesprungen, er umtanzt mich mit ins Auge springender Freude. Chan ist eine struppige, schwarze Hündin, eine »kleine, reinrassige Promenadenmischung«, auf die ich sehr stolz bin. Chan scheint viele Worte der Sioux-Sprache zu verstehen; es langt, dass ich ihr das entsprechende Wort zuflüstere, und sie begibt sich zu ihrer Matte. Allerdings denke ich, dass sie allgemein eher auf den Klang der Stimme reagiert. Oft versucht sie, den gleitenden Tonfall und die langgezogenen Worte zu imitieren, was unsere Gäste stets erheitert, aber ihre Aussprache ist für meine Ohren nicht ganz verständlich. Mit beiden Händen halte ich ihren zerzausten Kopf, und ich blicke ihr in die großen, braunen Augen. Plötzlich ziehen sich die weiten Pupillen zu kleinen, schwarzen Punkten zusammen, als wollte der schalkhafte Geist, der in ihr wohnt, meinen Fragen ausweichen.
Als ich schließlich zu dem Stuhl an meinem Schreibpult zurückkehre, verspüre ich ein starkes Mitempfinden gegenüber all meinen Mitgeschöpfen, deren Verwandtschaft untereinander mir wieder einmal so klar geworden ist. Die Grenzlinien zwischen den Rassen, einst von solch bitterer Realität, dienen heute nur noch dazu, ein lebendiges Mosaik des Menschengeschlechts zu markieren. Und die Menschen ein und derselben Hautfarbe gleichen dabei den elfenbeinernen Tasten ein und desselben Instruments, von denen eine jede allen anderen gleicht und dennoch von ihnen hinsichtlich Tonhöhe und Stimmklang verschieden ist. Und jene Geschöpfe, die zeitweise nichts sind als die bloßen Echos des Klanges anderer, erinnern an das Märchen von dem kranken, dürren Mann, dessen verzerrter Schatten, gekleidet wie ein echter Mensch, sich zu einem alten Meister begab, damit er diesem als Schatten folgen dürfe. Und von Mitgefühl für alle Echos in Menschengestalt durchdrungen, grüße ich den ernst dreinblickenden »eingeborenen Prediger«, der bereits auf mich wartete. Ich höre ihm mit dem einem Geschöpf Gottes gebührenden Respekt zu, obgleich er auf sonderbarste Weise die scheppernden Phrasen eines bigotten Glaubensbekenntnisses von sich gibt.
Da unser Stamm eine einzige große Familie ist, bei der jede Person mit der anderen verwandt ist, sprach er mich mit den folgenden Worten an: »Cousine, ich komme von der Morgenandacht, um mit dir zu sprechen.«
»Ja?«, sagte ich fragend, da er innehielt und auf eine Antwort von mir zu warten schien.
Unbehaglich auf dem hochlehnigen Stuhl hin und her rutschend, auf dem er saß, begann er: »An jedem heiligen Tag (er sprach vom Sonntag) blicke ich mich in unserem kleinen Gotteshaus um, und da ich dich nicht sehe, bin ich enttäuscht. Das ist der Grund, aus dem ich heute komme. Cousine, ich beobachte dich aus der Ferne, ich erkenne kein unziemliches Verhalten, und ich höre nur Gutes von dir, was den Wunsch, dass du ein Mitglied unserer Kirche würdest, nur um so mehr in mir brennen lässt. Cousine, vor langen Jahren haben freundliche Missionare mich gelehrt, die Heilige Schrift zu lesen. Diese Gottesmänner haben mir auch die Narrheit unseres alten Glaubens aufgezeigt.
Es gibt einen Gott, der die Gattung der toten Menschen belohnt oder bestraft. In der höchsten Sphäre sind die christlichen Toten versammelt zu unaufhörlichem Gesang und Gebet. Unten, in der tiefen Grube, tanzen die toten Sünder inmitten schrecklicher Flammen.
Denk über diese Dinge nach, meine Cousine, und entscheide dich jetzt dafür, dem Höllenfeuer der Verdammnis zu entrinnen!«
Es folgte eine lange Pause, während derer er immer wieder seine Finger fest ineinander verschränkte und wieder voneinander löste.
Bilder vom Werdegang meiner eigenen Mutter blitzten in meiner Erinnerung auf, denn auch sie ist inzwischen eine Anhängerin des neuen Aberglaubens. Ich hörte sie sagen: »Eine übelwollende Hand hat an einer Stelle die Füllung zwischen den Blöcken unserer Hütte herausgeschlagen und eine brennende Fackel aus geflochtenem, trockenem Gras hineingeschoben, aber die böse Absicht ging fehl, und der halb abgebrannte Graszopf fiel innen zu Boden. Direkt darüber, auf einem Regalbrett, lag die Heilige Schrift. Das ist es, was wir vorfanden, als wir von einem Besuch, der mehrere Tage gedauert hatte, zurückgekehrt waren. Ohne Zweifel ist in der Heiligen Schrift eine gewaltige Macht verborgen!«
Ich wischte dieses und viele ähnliche Bilder, die mir vor Augen standen, fort, und bot dem konvertierten Indianer, der wortlos und mit bedrücktem Gesichtsausdruck dasaß, ein Mittagsmahl an. Kaum, dass er mit den Worten: »Cousine, es hat mir geschmeckt«, aufgestanden war, läutete die Kirchenglocke.
Unverzüglich eilte er zur Kirche, um dort seine Nachmittagspredigt zu halten. Ich schaute ihm nach, wie er dahinhastete, die Augen fest auf die staubige Straße gerichtet, bis er schließlich nach einer Viertelmeile meinen Blicken entschwand.
Diese kleine Begebenheit erinnerte mich an die Kopie einer Missionarsschrift, die mir jemand vor ein paar Tagen gezeigt hatte, und in der ein »christlicher« Eiferer einen kürzlich erschienen Artikel aus meiner Feder kommentiert und dabei auf gröbste Weise den Sinn meiner Worte verdreht hatte. Und doch würde ich nie vergessen, dass sowohl der Bleichgesicht-Missionar als auch der unglückselige eingeborene Priester Kinder Gottes sind, wenn auch wahrlich sehr beschränkt in ihrem Verständnis Seiner unendlichen Liebe. Ich bin nur ein kleines Kind, das durch eine Welt voll Wunder taumelt, und somit ziehe ich ihren Glaubenssätzenmeine Ausflüge in die Gärten der Natur vor, wo die Stimme des Großen Geistes im Zwitschern der Vögel, im Plätschern der großen Gewässer und im süßen Atem der Blumen zu vernehmen ist.4
Hier, inmitten flüchtiger Stille, weckt mich das flatternde Gewand des Großen Geistes. Nach meinem tiefsten Verständnis ist das wahrnehmbare Universum ein königlicher Umhang, der von Seinem göttlichen Atem vibriert. Eingefangen in seinem fließenden Fransensaum sind, Pailletten und schillernden Brillanten gleich, die Sonne, der Mond und die Sterne.
Der sanftmütige Sioux
I
Ich saß in unserem Tipi neben dem Feuer. Meine rote Decke hatte ich fest um meine gekreuzten Beine gewickelt, und ich dachte über die bevorstehende Jahreszeit nach, meinen sechzehnten Winter. Meine Eltern saßen an den einander gegenüberliegenden Seiten des Tipis. Mein Vater pfiff zwischen seinen Zähnen eine Melodie vor sich hin, während er mit bloßer Hand eine rote Steinpfeife polierte, die er vor kurzem geschnitzt hatte. Fast genau mir gegenüber, auf der anderen Seite des Feuers in der Mitte des Tipis, saß meine alte Großmutter in der Nähe des Eingangs.
Sie hatte sich nach rechts gewandt und sprach fast die ganze Zeit mit meiner Mutter. Ab und zu richtete sie das Wort an mich, aber sie gestattete ihren Augen nie, auf dem Ehemann ihrer Tochter, meinem Vater, zu ruhen. Nur zu sehr seltenen Gelegenheiten sagte sie überhaupt etwas zu ihm. Und so waren seine Ohren stets offen und bereit, den kleinsten Wunsch, den sie kundtun mochte, aufzufangen. Manchmal, wenn meine Großmutter Dinge, die ihm gefielen, gesagt hatte, äußerte er sich dazu. Bei anderen Gelegenheiten, wenn er dem, was sie sagte, nicht beipflichten konnte, pflegte er schweigend zu arbeiten oder zu rauchen.
An jenem Abend begann meine Großmutter mit mir zu reden. Sie füllte den Kopf ihrer roten Steinpfeife mit getrockneter Weidenrinde und blickte mich an. »Mein Enkelkind, du bist nun groß geworden und kein kleiner Junge mehr.« Sie zog die Brauen zusammen und fragte: »Mein Enkelkind, wann wirst du eine hübsche junge Frau heimbringen?« Ich wich ihrem Blick aus und starrte ins Feuer. Während sie auf meine Antwort wartete, beugte sie sich vor und sog durch den langen Stiel eine Flamme in die rote Steinpfeife.
Ich lächelte, wobei meine Augen noch immer das helle Feuer fixierten, aber ich gab ihr keine Antwort. Sie wandte sich meiner Mutter zu und bot ihr die Pfeife an. Ich warf einen verstohlenen Blick auf meine Großmutter. Einer der lockeren Ärmel ihres Wildlederkleids war bis zum Ellbogen zurückgerutscht und gab den Blick auf ein mit silbernen Armreifen geschmücktes Handgelenk frei. An den nach oben gestreckten Fingern ihrer linken Hand zählte sie die begehrenswerten jungen Frauen unseres Dorfes auf. – »Welche, mein Enkelkind, welche?«, fragte sie schließlich.
»Ho!«, rief ich und zog verwirrt meine Decke zusammen. »Noch nicht!«
Als ich das gesagt hatte, gab meine Mutter die Pfeife über das Feuer hinweg an meinen Vater weiter. Dann begann auch sie darüber zu reden, was ich tun sollte: »Mein Sohn, sei stets tätig. Verschmähe nicht die lange Jagd. Lern erst, wie du reichlich Büffelfleisch und Felle erbeutest, bevor du eine Frau mit nach Hause bringst.«
Nun reichte mein Vater die Pfeife an die Großmutter weiter, und er leistete ebenfalls seinen Beitrag zu den Ermahnungen. »Nun, mein Sohn, ich habe mir gerade im Geiste die tapfersten Krieger unseres Volkes vorgestellt, einen nach dem anderen. Unter ihnen ist kein einziger, der sich seinen Ruf bereits in seinem sechzehnten Winter erworben hätte. Mein Sohn, das wäre eine große Aufgabe für einen Burschen von sechzehn Wintern.«
Ich wusste nicht, was ich darauf hätte erwidern sollen. Ich kannte den Ruf meines Kriegervaters. Er hatte das Recht erworben, solche Dinge zu sagen, bereits als er ein Bursche in meinem Alter gewesen war. Ich lehnte es ab, die Pfeife meiner Großmutter zu rauchen, da mein Herz von all diesen Worten zu aufgewühlt war, und tief bedrückt von der Furcht, sie alle zu enttäuschen, erhob ich mich, um das Tipi zu verlassen. Ich zog meine Decke über die Schultern und sagte, während ich zum Eingang ging: »Ich werde meinem Pony die Beinfesseln anlegen. Es ist schon sehr spät.«
II
Der Schnee von neun Wintern hatte jene Nacht begraben, in der meine Großmutter, gemeinsam mit meinem Vater und meiner Mutter, meine Zukunft im Lichte eines Zeltfeuers vorzeichnete.
Und doch wurde ich weder der Krieger, der Jäger noch der Ehemann, der ich hätte werden sollen. An der Missionsschule lernte ich, dass es falsch sei zu töten. Neun Winter lang war ich auf der Jagd nach dem sanften Herzen Christi, und ich betete für die Jäger, die den Büffel auf den Prärien jagten.
Im Herbst des zehnten Jahres wurde ich zurück zu meinem Stamm gesandt, damit ich dort den christlichen Glauben verkündete. Mit der Bibel des Weißen Mannes in der Hand und dem empfindsamen Herzen des Weißen Mannes in der Brust, kehrte ich zu meinem Volk zurück.
Ich trug die Kleidung von Fremdlingen, und als ein Fremdling kam ich in das Dorf meines Vaters.
Ich fragte nach dem Weg – ich hatte meine Muttersprache nicht vergessen –, und ein alter Mann führte mich zu dem Tipi, in dem mein Vater lag. Mein Begleiter erzählte mir, dass mein Vater bereits seit vielen Monden krank sei. Als wir in die Nähe des Tipis gelangten, hörte ich den Gesang eines Medizinmannes aus dem Inneren. Ich wollte unverzüglich hineingehen und den Präriezauberer aus meinem Heim hinausjagen, aber der alte Krieger hielt mich zurück. »Ho! Warte draußen, bis der Medizinmann deinen Vater verlässt«, sagte er. Indem er das sagte, musterte er mich von Kopf bis Fuß. Dann wandte er sich um und ging in Richtung der Mitte des Zeltlagers. Die Behausung meines Vaters stand am Rand des runden Dorfes.
Mit jedem Herzschlag wuchs meine Ungeduld, endlich das Tipi zu betreten.
Ich blätterte gerade mit nervösen Fingern in meiner Bibel, als der Medizinmann endlich aus dem Zelt trat und sich raschen Schrittes fortbegab. Sein Kopf und sein Gesicht waren in dem weiten Gewand verborgen, das auch seine gesamte Gestalt verhüllte.
Er war groß und breit gebaut. Niemals seither habe ich seine ausgreifenden Schritte vergessen. Sie wirkten auf mich wie der unheimliche Gang des ewigen Todes. Rasch steckte ich die Bibel in die Tasche und betrat das Tipi.
Mein Vater lag auf einer Matte. Sein Gesicht war zerfurcht, sein Haar war grau. Die Augen und die Wangen waren tief eingesunken. Dünne, fahle Haut umspannte die spitz wirkende Nase und die hohen Wangenknochen. Ich beugte mich über ihn und ergriff seine fiebrige Hand. »Hau, Ate!« – »Sei gegrüßt, Vater!«, sagte ich.
In seinen apathischen Augen glomm etwas auf, und seine trockenen Lippen öffneten sich. »Mein Sohn!«, murmelte er mit schwacher Stimme. Daraufhin verebbte die Welle aus Freude und Wiedererkennen. Er schloss die Augen, und seine Hand sank zu Boden, als ich meine Hand öffnete.
Ich schaute mich um und sah eine alte Frau, die mit gebeugtem Haupt dasaß. Erst als ich ihr die Hand gab, erkannte ich meine Mutter wieder. Ich setzte mich zwischen meinen Vater und meine Mutter, wie ich es früher immer getan hatte, aber ich hatte nicht mehr das Gefühl, zu Hause zu sein. Der Platz, an dem meine alte Großmutter zu sitzen pflegte, war nun leer. Gleich meiner Mutter neigte auch ich mein Haupt. Unser beider Kehlen waren wie abgeschnürt, und Tränen strömten uns aus den Augen; aber im Geiste waren wir nicht eins, denn unsere Gedanken und unser Glaube trennten uns. Ich war um die unerlöste Seele bekümmert, wohingegen meine Mutter, wie ich annahm, darüber weinte, den Körper eines tapferen Mannes von der Krankheit gebrochen zu sehen.
Vergeblich war mein Versuch, den Glauben an den Medizinmann in den Glauben an eine abstrakte Macht, Gott genannt, zu wandeln. Eines Tages packte mich ein gewaltiger Zorn darüber, dass der Medizinmann weiterhin die Seele meines Vaters umgarnte. Und als er begann, seine heiligen Lieder zu singen, wies ich zum Eingang und befahl ihm zu gehen! Die Augen des Mannes funkelten mich einen Moment lang an. Mit langsamen Bewegungen raffte er seinen Umhang zusammen, wandte dem Kranken den Rücken zu und verließ unser Tipi. »Oh, mein Sohn, mein Sohn! Ich kann ohne den Medizinmann nicht leben!«, rief mein Vater. Ich hörte ihn weinen, als der heilige Mann gegangen war.
III
An einem hellen Tag, zu der Zeit, da die gefiederten Samen des Präriegrases die Luft erfüllten, begab ich mich gemessenen Schrittes in die Mitte des Zeltlagers. Mein Herz pochte hart und ungleichmäßig. Ich presste die Heilige Schrift, die ich unter dem Arm trug, fester an mich. Der Augenblick war gekommen, in dem meine Lebensaufgabe beginnen würde.
Obgleich ich wusste, dass es schwierig sein würde, glaubte ich nicht einen Moment an die Möglichkeit eines Misserfolgs. Während ich mit ungleichmäßigem Gang über den welligen Boden schritt, dachte ich an die Krieger, die sich schon bald die Kriegsbemalung vom Gesicht waschen und mir folgen würden.
Endlich erreichte ich den Platz, an dem die Leute sich versammelt hatten, um sich meine Predigt anzuhören. In einem großen Kreis saßen Männer und Frauen auf trockenem, rötlichem Gras. Mitten in diesem Ring würde ich stehen, die Bibel des Weißen Mannes in der Hand. Ich würde ihnen von dem sanften Herzen Christi erzählen.
Schweigend saßen die barhäuptigen Krieger unter der Nachmittagssonne. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn und begab mich in den Ring. Das Schweigen der Versammelten stimmte mich sehr hoffnungsvoll.
Ich richtete gerade meine Gedanken in Dankbarkeit auf den Himmel, als eine Bewegung mich zurück auf die Erde holte.
Ein hochgewachsener, starker Mann erhob sich. Sein weiter Umhang hing in Falten über seiner rechten Schulter. Ein Paar zupackender, schwarzer Augen hefteten sich gleich den Giftzähnen einer Schlange auf mich. Es war der Medizinmann. Ein Beben durchschauerte mein Herz, und eisige Kälte durchströmte meine Adern.
Zornig wies er mit seinem langen Zeigefinger auf mich und fragte: »Was für ein treuer Sohn ist denn das, der die Kleidung eines Fremdlings trägt, wenn er zu seines Vaters Volk zurückkehrt?« Er machte eine kurze Pause und fuhr dann fort: »Es ist die Kleidung jenes Fremdlings, von dem es heißt, dass er einen eingeborenen Sohn unseres Landes gefesselt, trockenes Holz um ihn herum aufgehäuft und ein Feuer zu seinen Füßen entfacht habe!« Er stieß die Hand in meine Richtung und rief: »Hier ist der Verräter seines Volkes!«
Ich war hilflos. Vor den Augen der Menge verwandelte der gerissene Zauberer mein ehrliches Herz in einen verruchten Hort des Verrats. Und ach! Mit finsteren Blicken sahen mich nun die Leute an.
»Hört!«, fuhr er fort. »Wer von euch, der diesen jungen Mann gesehen hat, kann ihn denn durchschauen und die Leute vor dem Nest voll junger Schlangen warnen, das in seiner Brust verborgen ist? Wessen Ohr ist so scharf, dass er das Zischen der Schlangen vernimmt, wenn dieser junge Mann seinen Mund öffnet? Der da ist nicht nur voll Falschheit euch gegenüber, sondern sogar gegenüber dem Großen Geist, der ihn erschaffen hat. Er ist ein Narr! Warum sitzt ihr hier und leiht euer Ohr einem närrischen Mann, der sein eigenes Volk nicht verteidigen konnte, aus Furcht, töten zu müssen, der kein Wild nach Hause bringen konnte, um das Leben seines kranken Vaters zu erneuern? Lasst ihn doch mit seinen Gebeten den Feind vertreiben! Soll er mit seinem sanften Herzen die Hungersnot abwenden! Wir werden an einen anderen Ort ziehen, um auf unbesudeltem Boden zu leben.«
Mit diesen Worten löste er die Menge auf. Als die Sonne im Westen unterging und der Wind abgeflaut war, war das Dorf aus kegelförmigen Tipis verschwunden. Der Medizinmann hatte die Herzen der Menschen gewonnen.
Nur meines Vaters Behausung war geblieben, wie eine Erinnerung an den Ort des Kampfes.
IV
Nach einer langen Nacht am Lager meines Vaters verließ ich das Tipi, um den Morgen zu begrüßen. Die gelbe Sonne stand gerade dort, wo das schneebedeckte Land und der wolkenlose, blaue Himmel einander berührten. Das Licht des neuen Tages war kalt. Der starke Atem des Winters hatte den Schnee verkrusten lassen und kristallene Decken auf die Flüsse und Seen gelegt. Ich stand vor dem Tipi und dachte an die unermesslichen Weiten der Prärie, die uns von unserem Stamm trennten. Ich fragte mich, ob das hohe Himmelsgewölbe auf gleiche Weise den sanftmütigen Sohn Gottes von uns trennte. Ein eisiger Nordwind blies mir durch das Haar bis auf den Schädel. Mein vernachlässigtes Haar war wieder lang gewachsen und fiel mir in den Nacken.
Mein Vater war nicht mehr von seinem Bett aufgestanden, seit der Medizinmann den Stamm fortgeführt hatte. Ich las aus der Bibel vor und betete auf Knien an seinem Lager, aber mein Vater hörte nicht zu. Doch ich glaubte, dass meine Gebete im Himmel nicht unbeachtet blieben.
»Oh, mein Sohn«, seufzte mein Vater, als der erste Schnee fiel. »Mein Sohn, wir haben nichts mehr zu essen. Niemand ist da, der uns Fleisch bringen könnte. Mein Sohn, dein sanftes Herz hat dich unfähig zu allem werden lassen!« Daraufhin zog er sich seine Büffeldecke über das Gesicht und sagte nichts mehr.
Als ich nun an diesem Wintermorgen vor dem Tipi stand, litt ich großen Hunger. Seit zwei Tagen hatte ich keine Nahrung mehr zu Gesicht bekommen. Doch dass mir kalt war und ich hungerte, war unbedeutend angesichts des klagenden Aufschreis des kranken, alten Mannes.
Ich begab mich wieder ins Tipi und band meine Schneeschuhe los, die an den Zeltstangen befestigt waren.
Meine arme Mutter, die bei dem Kranken wachte und gewissenhaft Holz ins Feuer nachlegte, sagte zu mir: »Mein Sohn, wenn du es wieder nicht schaffst, deinem Vater Fleisch zu bringen, wird er verhungern.«
»Hau, Ina« – »Ja, Mutter«, antwortete ich traurig.
Ich brach auf, um für meine betagten Eltern auf die Jagd zu gehen. Den ganzen Tag lang durchstreifte ich das flache, weiße Gelände – umsonst. Nirgendwo gab es andere Fußspuren als meine eigenen! Am Abend dieses dritten Fastentages kehrte ich ohne Fleisch zurück. Nur ein Bündel Holz für das Feuer trug ich auf dem Rücken. Ich ließ das Holz vor dem Tipi fallen, öffnete die Türöffnung und setzte einen Fuß in das Zelt.
Wie betäubt stand ich da, und mir wurde schwindlig. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Vor mir lag mein alter, grauhaariger Vater und schluchzte wie ein Kind. Mit seinen schwieligen Händen hatte er das Büffelgewand ergriffen, und mit seinen Zähnen nagte er den Rand davon ab. Während er die trockenen, borstigen Haare und das Büffelleder kaute, suchten seine Augen meine Hände. Als er sah, dass sie leer waren, rief er: »Mein Sohn, dein sanftes Herz wird mich verhungern lassen, bevor du mir Fleisch bringst! Zwei Hügel weiter östlich steht eine Herde Rinder. Und doch wirst du mich sterben sehen, bevor du mir zu essen bringst!«
Meine Mutter lag mit bedecktem Haupt auf ihrer Matte, ich aber eilte hinaus in die Nacht.
Mit einer sonderbaren Wärme in meinem Herzen und mit erstaunlich flinken Füßen überquerte ich den ersten Hügel und bald darauf den zweiten. Das Mondlicht, das auf das weiße Land schien, zeigte mir einen deutlichen Pfad zu den Rindern des Weißen Mannes. Meine Hand ruhte auf dem Messer in meinem Gürtel, als ich mich schwer gegen die Umzäunung lehnte und die Herde zählte.
Insgesamt waren es zwanzig Tiere. Unter diesen wählte ich das fetteste aus. Ich sprang über den Zaun und stieß ihm mein Messer in den Leib.
Mein langes Messer war scharf, und meine Hände, die ihre Furcht und ihre Langsamkeit verloren hatten, schnitten ausgewählte Stücke warmem Fleisches heraus. Gebeugt unter der Last des Fleisches, das ich für meinen sterbenden Vater genommen hatte, eilte ich über die Prärie.
Ich rannte buchstäblich nach Hause mit der lebensspendenden Nahrung auf meinem Rücken. Kaum hatte ich den zweiten Hügel erklommen, hörte ich Geräusche hinter mir. Ich lief immer schneller mit der Last für meinen Vater, aber die Geräusche kamen näher. Ich hörte das Klappern von Schneeschuhen und das Knarren von Lederriemen, aber ich drehte mich nicht um, um zu sehen, was mir auf den Fersen war, denn ich hatte nichts im Sinn, als meinen Vater zu erreichen. Plötzlich erscholl wie Donner eine wütende Stimme und schrie Flüche und Drohungen in mein Ohr! Eine rauhe Hand zerrte mich an der Schulter und nahm mir das Fleisch weg. Ich hörte auf, mich dem Griff entwinden zu wollen, um wegzulaufen. Ein betäubendes Dröhnen füllte meinen Schädel. Der Mond und die Sterne begannen sich zu bewegen. Plötzlich war die weiße Prärie zum Himmel geworden, und die Sterne lagen unter meinen Füßen. Und wieder drehte sich alles. Schließlich war das Sternenzelt wieder an seinen Platz gerückt. Das Geräusch in meinem Ohren war verstummt. Eine große Stille erfüllte die Luft. Ich sah, dass ich mein langes Messer in der Hand hielt und dass Blut von ihm herabtropfte. Zu meinen Füßen lag im blutgefärbten Schnee ein Mann auf dem Bauch. Die schreckliche Szenerie schien eine Sinnestäuschung zu sein, denn ich konnte nicht begreifen, was sich zugetragen hatte. Lange starrte ich auf den blutbefleckten Schnee, bis mir endlich das Fleisch für meinen verhungernden Vater wieder ins Bewusstsein trat. Ich warf es mir über die Schulter und setzte den Weg nach Hause fort.