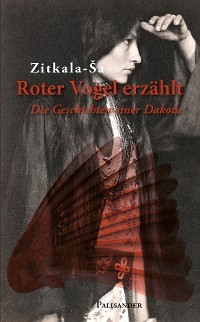Kitabı oku: «Roter Vogel erzählt», sayfa 4
Dawée bereitete sich eifrig darauf vor, auszugehen, und ich hielt mühsam meine Tränen zurück. Doch als ich ihn auf seinem Pony davongaloppieren hörte, barg ich das Gesicht in meinen Armen und weinte bitterlich.
Mein Mutter war sehr bekümmert, dass ich so unglücklich war. Sie kam zu mir und hielt mir das einzige gedruckte Werk hin, das wir zu Hause hatten. Es war eine Indianerbibel, die ein Missionar ihr vor einigen Jahren geschenkt hatte. Sie versuchte, mich zu trösten. »Hier, mein Kind, sind die Schriften des Weißen Mannes. Lies doch ein bisschen darin«, sagte sie voll Ehrfurcht.
Ich ergriff die Bibel um ihretwillen, aber in meinem Ärger wäre mir eher danach gewesen, das Buch zu verbrennen, von dem ich keine Hilfe zu erwarten hatte und das meine Mutter vollkommen in die Irre leitete. Anstatt es zu lesen, legte ich das Buch ungeöffnet auf den Boden, auf dem ich selbst zusammengekauert hockte. Mein Zorn auf die Mächte des Schicksals verzehrte meine Tränen, bevor sie mir aus den Augen treten konnten. Meine Mutter warf sich einen Schal über Kopf und Schultern und ging hinaus in die Dunkelheit.
Ich hockte wie versteinert da, mit tief gesenktem Kopf. Die ein gedämpftes gelbes Licht ausstrahlende Flamme des geflochtenen Musselindochts, der in einem kleinen Ölbehälter brannte, flackerte und knisterte in dem schrecklichen, stillen Sturm, der meiner Zurückweisung der Bibel entsprungen war.
Nachdem ich eine Zeitlang in ratloser Einsamkeit verharrt hatte, schrak ich plötzlich auf von einem lauten Schrei, der die Nacht durchdrang. Es war die Stimme meiner Mutter, die zwischen den kahlen Hügeln erscholl, in denen die Gebeine begrabener Kriegern ruhten. Sie rief nach den Geistern ihrer Brüder, damit sie ihr zu Hilfe kämen in ihrem verzweifelten Elend. Meine Finger wurden eiskalt, als ich begriff, dass meine unbeherrschten Tränen ihr mein Leid verraten hatten, und dass sie nun meinetwegen solch großen Kummer hatte.
Obwohl ich wusste, dass sie wieder auf dem Weg zur Hütte war, da ihr Wehklagen verstummt war, löschte ich das Licht. Dann ging ich zum Fenster und lehnte die Stirn aufs Fensterbrett.
Ich hatte nur noch eines im Sinn: Ich wollte weg von diesem Ort.
Es dauerte noch einige wenige Monate, als die Unruhe, die mich befallen hatte, mich erneut zu der Schule im Osten trieb. Ich ritt wieder auf dem Eisenross des Weißen Mannes und glaubte, dass es mich in einigen Wintern, wenn ich groß sein würde, wieder zurückbringen würde zur Mutter. Und ich glaubte, dass mich dann Freunde erwarten würden, die mich verstünden.
VII – Ich ziehe mir das Missfallen meiner Mutter zu
Meine zweite Reise in den Osten hatte ich nicht ohne einige Vorkehrungen angetreten. Heimlich hatte ich einen unserer besten Medizinmänner aufgesucht und ihn befragt, und als ich sein Tipi verließ, war in meinem Ärmel ein kleines Bündel magischer Wurzeln sicher befestigt. Sie würden dafür sorgen, dass ich überall Freunde finden würde, wo auch immer ich hinkäme. Ich glaubte so unerschütterlich an diesen Zauber, dass ich die Wurzeln über ein Jahr lang während des Schulalltags ständig bei mir trug. Dann aber, noch bevor ich den Glauben an die toten Wurzeln verlor, verlor ich das Wildlederbeutelchen, das all mein Glück enthalten hatte.
Am Ende dieses zweiten dreijährigen Schulbesuchs war ich die stolze Inhaberin meines ersten Schulabschlusses. Im darauffolgenden Herbst ging ich gegen den Willen meiner Mutter auf ein College.
Ich hatte ihr geschrieben, um sie um Erlaubnis darum zu bitten, aber ihre Antwort enthielt nicht die leiseste Ermutigung. Sie wies mich auf die Kinder ihrer Nachbarn hin, die ihre Ausbildung innerhalb von drei Jahren abgeschlossen hatten. Danach waren sie nach Hause zurückgekehrt und konnten nun mit den Siedlern des Grenzlands Englisch sprechen. Ihre kurze Antwort deutete an, dass ich besser daran täte, meinen langwierigen Versuch, die Wege des Weißen Mannes zu studieren, aufzugeben, und mich damit zufriedenzugeben, die Prärien zu durchstreifen und so zu leben, wie unsere Vorfahren es taten. Ich teilte ihr mit, dass ich ihr nicht gehorchen würde, und brachte sie damit zum Schweigen.
Und so, heimatlos und mit schwerem Herzen, begann ich erneut ein Leben unter Fremden.
Immer, wenn ich mich in meinen kleinen Raum im Schlafsaal des Colleges zurückgezogen hatte, fern der höhnischen und zugleich neugierigen Blicke der Studenten, sehnte ich mich danach, dass jemand Mitleid mit mir haben mochte. Oft weinte ich heimlich, wünschte mir, doch wieder in den Westen gegangen zu sein, genährt von der Liebe meiner Mutter, anstatt hier bei diesen kalten Menschen zu weilen, deren Herzen vor lauter Vorurteil gefroren waren.
Den ganzen Herbst und den ganzen Winter hindurch hatte ich kaum einen wirklichen Freund, auch wenn inzwischen mehrere meiner Mitstudenten mich aus sicherer Distanz heraus höflich behandelten.
Meine Mutter hatte mir meine Grobheit ihr gegenüber nicht verziehen, und ich selbst nahm mir nicht die Zeit, ihr zu schreiben. Im Licht des Tages wie im Lampenlicht rang ich darum, die englische Sprache zu beherrschen, und mir war dabei, als verwöbe ich mit müden Händen Disteln und Schilf zu einem magischen Muster, das mir eines Tages den Respekt des Weißen Mannes einbringen würde.
Endlich, im Frühjahr, nahm ich an einem Redewettstreit zwischen mehreren Klassen teil. Als der Tag des Wettbewerbs näher heranrückte, schien es mir zunächst undenkbar, dass das Ereignis bereits vor der Tür stand, aber tatsächlich war dies der Fall. Die einzelnen Klassen versammelten sich in der Kapelle, gemeinsam mit geladenen Gästen. Das hohe Podium war mit Teppichboden belegt und mit Girlanden in den Farben des Colleges geschmückt worden. Der Raum war von hellem, weißem Licht erleuchtet, und die großen, polierten Balken, die das Fachwerk des Deckengewölbes bildeten, traten deutlich hervor. Die versammelte Menge erfüllte den Raum mit an- und abschwellendem Gemurmel. Als es Zeit für die Reden war, wurde den Zuschauern bedeutet, still zu sein. Nur das ruhige Ticken der alten Wanduhr, die den Beginn der Prüfung anzeigte, war noch zu vernehmen.
Ich sah und hörte die Redner, einen nach dem anderen. Doch ich hatte nicht das Gefühl, dass auch nur einer von ihnen so inbrünstig auf ein günstiges Urteil der Preisrichter hoffte, wie ich es tat. Jeder Teilnehmer am Wettbewerb erhielt lauten Applaus, und manche wurden mit großer Herzlichkeit bejubelt. Viel zu schnell kam die Reihe an mich. Ich verharrte einen Augenblick hinter den Vorhängen, um noch einmal tief Atem zu schöpfen. Nachdem ich meine letzten Worte gesprochen hatte, vernahm ich den gleichen Applaus, wie ihn die anderen hervorgerufen hatten.
Als ich mich umdrehte und nach hinten gehen wollte, überraschten mich meine Mitstudenten mit einem großen Rosenstrauß, der mit flauschigen Bändern zusammengebunden war. Ich ergriff die lieblichen Blumen und floh von der Bühne. Ich empfand dieses freundliche Geschenk wie einen Tadel für all die schlechten Gedanken, die ich ihnen gegenüber gehegt hatte.
Am Ende des Wettbewerbs entschieden die Preisrichter, dass ich den ersten Platz errungen hatte. Ein wildes Getöse brach in der Halle los; meine Mitstudenten sangen und schrien aus Leibeskräften meinen Namen, während die enttäuschten Studenten der anderen Klassen johlten und in beängstigend dissonante Blechtrompeten bliesen. Inmitten dieses Tumults stürzten glückliche Studenten auf mich zu, um mir zu gratulieren. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen, als sie mich baten, mich in einer Prozession in die studentischen Wohnräume geleiten zu dürfen. Ich dankte ihnen für die Freundlichkeit, die sie auf diese Idee gebracht hatte, aber ich zog es vor, mich allein mit der Dunkelheit der Nacht in mein kleines Zimmer zu begeben.
Einige Wochen darauf wurde ich vom College als Vertreterin für einen anderen Wettbewerb berufen. Diesmal war es ein Wettstreit von Rednern aus verschiedenen Colleges unseres Staates. Er wurde in der Hauptstadt des Bundesstaates abgehalten, in einem der größten Opernhäuser.
Auch hier schlugen mir große Vorurteile gegen mein Volk entgegen. Am Abend, als das Publikum das Haus zu füllen begann, gerieten die Studentenschaften miteinander in heftigen Streit. Glücklicherweise blieb es mir erspart, Zeuge des wilden Gerangels vor Beginn des Wettbewerbs zu werden. Die Verunglimpfungen der Indianer, die die Lippen unserer Gegner besudelten, brannten aber bereits wie ein trockenes Fieber in meiner Brust.
Doch als am Ende alle Reden gehalten waren, erwartete mich eine noch größere Schmach. Mitten im großen Saal, vor unzähligen Augen, entrollten einige College-Rowdies ein großes, weißes Banner, auf das ein höchst verloren wirkendes Indianermädchen gezeichnet war. Und darunter hatten sie mit fetten, schwarzen Druckbuchstaben Worte geschrieben, die jenes College, das durch eine »Squaw« vertreten wurde, verhöhnte. Solch eine mehr als barbarische Rohheit verbitterte mich. Während wir auf das Urteil der Preisrichter warteten, starrte ich grimmig auf das Gewimmel der Bleichgesichter. Ich presste die Zähne aufeinander, als ich sah, dass das weiße Banner noch immer frech in der Luft schwebte.
Voll Unruhe beobachteten wir den Mann, der den Umschlag, welcher die endgültige Entscheidung enthielt, zur Bühne brachte. Zwei Preise sollte an diesem Abend verliehen werden … Und ich hatte einen von ihnen gewonnen!2
Ein böser Geist lachte laut auf in mir, als das weiße Banner plötzlich zu Boden fiel und die Hände, die es geschwenkt hatten, kraftlos herabsanken, von der Niederlage vernichtend getroffen.
Ich verließ die Menge so rasch wie möglich. Bald war ich wieder allein in meinem Zimmer. Den Rest der Nacht saß ich in einem Sessel und starrte in das prasselnde Feuer. Mir war nicht mehr nach triumphierendem Lachen zumute. Dieser kleine Sieg konnte nicht den Hunger meines Herzens stillen. Vor meinem inneren Auge sah ich meine Mutter, weit weg in den Ebenen des Westens, und sie zürnte mir.
Als indianische Lehrerin unter Indianern
I – Mein erster Tag
Ich wurde krank und musste meine Collegeausbildung abbrechen. Aber ich war zu stolz, um zu meiner Mutter zurückzukehren. Hätte sie von meinem miserablen Zustand gewusst, dann hätte sie gesagt, dass alles Papier des Weißen Mannes die Freiheit und die Gesundheit, die ich dafür verloren hatte, nicht wert sei. Doch solch einen Vorwurf vonseiten meiner Mutter hätte ich nicht ertragen; allzu viel Wahrheit hätte darin gelegen.
Seit jenem Winter, als ich zum ersten Mal von den roten Äpfeln geträumt hatte, war ich allmählich immer weiter in Richtung Sonnenaufgang gereist. Inzwischen hatte ich keine Zweifel mehr, wohin mein weiterer Weg gehen sollte, damit ich meine Energie zugunsten der indianischen Rasse würde einsetzen können. Aus diesem Grund schrieb ich meiner Mutter nur einen kurzen Brief, in dem ich ihr mitteilte, dass ich nun ein Jahr lang Unterricht an einer Indianerschule im Osten geben würde. Kaum, dass ich diese Botschaft in den Westen gesandt hatte, brach ich weiter in Richtung Osten auf.
Und so stand ich nun müde und erhitzt inmitten dunkler Schwaden von Rauch, der von Lokomotiven herrührte, an einer Straßenecke in einer altmodischen Stadt und wartete auf einen Wagen, der mich zum Schulgelände bringen würde, wo eine Arbeit auf mich wartete, für die ich keinerlei Erfahrung mitbrachte.
Dort angekommen, war ich überrascht über die dicht beieinander stehenden Gebäude, die ein malerisches, kleines Dorf bildeten, das viel interessanter wirkte als die Stadt selbst. Die hohen Bäume zwischen den Häusern spendeten dem Ort kühlen, erfrischenden Schatten, in dem sattgrünes Gras wuchs. Mitten in dem großen, von Gras und Bäumen bewachsenen Hof stand eine niedrige grüne Wasserpumpe. Das sonderbare kastenförmige Gehäuse war an der Seite mit einem Drehgriff ausgestattet, der ständig klirrte und quietschte.
Ich stellte mich vor, und man zeigte mir mein Zimmer – ein kleiner Raum mit Teppichboden; Wände und Decke waren auffallend hässlich. Die zwei Fenster, beide nebeneinander in einer Wand, waren mit schweren Musselinvorhängen verhängt, die vom Alter gelb geworden waren. Ein sauberes, weißes Bett stand in einer Zimmerecke, und in der gegenüberliegenden Ecke stand ein quadratischer Tisch aus Kiefernholz mit einer Tischdecke aus schwarzer Wolle.
Ohne den Hut abzusetzen, setzte ich mich auf einen der beiden hochlehnigen Stühle, die beim Tisch standen. Einige heftige Herzschläge lang saß ich schweigend da, blickte von der Zimmerdecke zum Fußboden, von Wand zu Wand und versuchte mir mit Macht vorzustellen, dass ich hier jahrelang zufrieden würde leben können. Ich fragte mich gerade, ob meine erschöpften Kräfte dazu ausreichen würden, als ich schwere Schritte hörte, die abrupt vor meiner Tür anhielten. Ich öffnete und sah vor mir die eindrucksvolle Gestalt eines stattlichen, grauhaarigen Mannes. In seiner Linken hielt er einen leichten Strohhut, und die rechte Hand streckte er mir zur Begrüßung entgegen. Er lächelte mich freundlich an. Aus irgendeinem Grund fühlte ich mich eingeschüchtert von seiner bemerkenswerten Größe und seinen starken, quadratischen Schultern, die sich, wie mir schien, knapp oberhalb meines Kopfes befanden. Mir war klar, dass es sich um den Schulleiter handeln musste.
Ich war schon immer etwas schmächtig gewesen, und die schwere Krankheit, die mich zu Beginn des Frühjahrs befallen hatte, ließ mich zerbrechlich und schwächlich wirken. Die flinken Augen des Mannes musterten meine Gestalt. Dann blickte er mir ins Gesicht. Mir schien, dass ein Schatten über sein Antlitz lief, als er meine Hand wieder losließ. Mir war bewusst, dass selbst der Eisenbahnruß, der mir das Gesicht geschwärzt hatte, nicht die Linien des Leids darin hatten auslöschen können.
»Aha! Sie sind also das kleine Indianermädchen, das für so viel Aufregung bei den College-Rednern gesorgt hat!«, sagte er mehr zu sich selbst als an mich gerichtet. Ich glaubte, einen leichten Unterton von Enttäuschung in seiner Stimme wahrzunehmen. Er warf einen Blick in mein Zimmer und fragte dann, ob ich noch irgendetwas dafür brauchte.
Nachdem er sich umgedreht hatte und gegangen war, lauschte ich noch auf seine Schritte, bis sie aus der Ferne kaum noch zu vernehmen waren.
Einen Moment lang lachte ich innerlich über all mein Missgeschick und dachte, dass ich mir doch einfach etwas Mühe geben sollte, um meine Lage zu verbessern. Aber als ich meinen Hut abnahm und beiseite warf, überkam mich eine bleierne Müdigkeit, und mir war, als würde jahrelange Erschöpfung gleich Holzblöcken, die mit Wasser vollgesogenen waren, auf mir lasten. Ich warf mich aufs Bett, schloss die Augen und hatte im nächsten Moment meine guten Absichten vergessen.
II – Eine Reise nach Westen
Einen bedrückenden Monat lang saß ich an einem Schreibtisch, auf dem sich die Arbeit türmte. Jetzt, wenn ich daran zurückdenke, frage ich mich, wie ich die Warnungen der Natur so rücksichtslos habe ignorieren können. Zum Glück hat mir die unglaubliche Ausdauer, die ich von meinen Vorfahren geerbt habe, die Kraft gegeben, mich zu biegen, ohne dabei zu zerbrechen.
Meine täglichen Wege zwischen meinem Zimmer und dem Büro pflegte ich unglücklich schweigend zurückzulegen. Ich spürte, dass man mich die ganze Zeit über genau im Auge behielt. Eines frühen Morgens wurde ich ins Büro des Superintendenten gerufen. Eine halbe Stunde lang hörte ich mir an, was er mir zu sagen hatte. Aber als ich zurück in mein Zimmer ging, war es vor allem ein Satz, der mir im Gedächtnis geblieben war: »Ich lasse Sie frei auf die Weide gehen!« Er wollte mich in den Westen schicken, damit ich dort indianische Kinder für unsere Schule rekrutieren sollte, und das war seine Art, dies auszudrücken.
Ich sollte also Futter für die Schule finden; aber eine Reise im Hochsommer quer über den Kontinent, um auf den heißen Prärien nach vertrauensseligen Eltern zu suchen, die ihre Kinder Wildfremden anvertrauen würden, bedeutete ein mageres Weideland. Doch die Hoffnung, dass ich meine Mutter wiedersehen könnte, belebte mich. Ich überzeugte mich selbst davon, dass eine Veränderung Erholung bedeuten würde. Nach ein paar Tagen brach ich auf, um zur Hütte meiner Mutter zu reisen.
Die brütende Hitze und der stickige Rauch der Lokomotive, die mich den ganzen Weg nach Hause begleiteten, belebten meine Lebensgeister nicht allzu sehr. Stunde für Stunde starrte ich auf das Land, das schnell hinter mir zurückwich. Ich bemerkte, wie der Horizont allmählich weiter wurde, als wir aus den Waldregionen in die Prärien gelangten. Die großen und hohen Gebäude, deren Türme über das dichte Waldland hinausragten und deren gigantische Zusammenballungen große Städte bildeten, verschwanden gemeinsam mit dem Gehölz, bis nur noch kleine Blockhäuser zu sehen waren, die behaglich auf der Brust der weiten Prärie ruhten. Die Wolkenschatten, die über das wogende Gelb der ausgedörrten Gräser zogen, ließen mich vor Aufregung fiebern; es war, als begegnete ich alten Freunden.
In einem kleinen Bahnhof, der aus einem einzelnen Fachwerkhaus, welches von einer wackligen Holzplattform umgeben war, bestand, verließ ich das Eisenross. Nur noch dreißig Meilen trennten mich von meiner Mutter und meinem Bruder Dawée. Ein starker, heißer Wind schien sich dazu entschlossen zu haben, mir den Hut vom Kopf zu blasen, damit es wieder so wäre wie in den alten Tagen, als ich barhäuptig über die Hügel zu ziehen pflegte. Nachdem die puffende Lokomotive meines Zuges den Bahnhof verlassen hatte, stand ich einsam und verlassen auf dem Bahnsteig. Ich blickte auf das sanft wogende Land, das sich bis zu den kahlen Hügeln hinzog.
Zwischen den Hügeln hindurch wand sich eine breite, graue Straße bis hin zum Bahnhof. Auf dieser Straße fuhr ich nun in einem leichten Gefährt mit einem zuverlässigen Kutscher, dessen zerzaustes, flachsiges Haar struppig über seinen Ohren hing und dessen ledriges Genick rötlich gefärbt war. Bei einem Unfall oder durch Fäule hatte er einen seiner langen Vorderzähne verloren.
Obwohl ich ihn als Bleichgesicht betrachtete, waren seine Wangen ziegelrot. Seine wasserblauen Augen waren trüb und blutunterlaufen, und unaufhörlich zuckten sie. Schon seit langer Zeit pflegte er die Strecke zwischen seinem einsamen Bahnhof und dem Indianerdorf zu fahren, durch Gras und durch Schnee. Seine wettergebleichte Kleidung saß schlecht auf seinen krummen Schultern. Er hatte eine gebückte Haltung, und sein vorstehendes Kinn, das mit einem Büschel trockenen Flachses bewachsen war, bewegte sich genauso monoton auf und ab wie der Kopf seines treuen Zugpferdes.
Den ganzen Morgen blickte ich umher und erkannte alte, vertraute Silhouetten von schroffen Felsen und runden Hügelkuppen wieder. Am Straßenrand sah ich verschiedene Pflanzen, deren süße Wurzeln bei meinem Volk als Delikatessen galten. Als ich das erste kegelförmige Tipi erblickte, konnte ich einen begeisterten Aufschrei nicht zurückhalten, der meinen Fahrer jäh aus seiner Schläfrigkeit riss.
Mittags, als wir die östliche Grenze der Reservation überquerten, befielen mich große Ungeduld und Unruhe. Unaufhörlich fragte ich mich, was meine Mutter sagen würde, wenn sie sah, dass ihre kleine Tochter groß geworden war. Ich hatte ihr den Tag meiner Ankunft nicht geschrieben, da ich sie überraschen wollte. Wir durchquerten eine Schlucht, die von niedrigem Gebüsch und Pflaumensträuchern bewachsen war und gelangten zu einer großen, gelben, mit wilden Sonnenblumen bestandenen Fläche. Direkt hinter diesem Garten der Natur gelangten wir zum Gehöft meiner Mutter. Nahe bei der Blockhütte stand ein kleines, mit Leinwand bespanntes Tipi. Der Fahrer hielt vor der offenen Tür, doch erst nach einiger Zeit erschien meine Mutter auf der Schwelle.
Ich hatte erwartet, dass sie mir entgegeneilen würde, um mich zu begrüßen, aber sie stand still da und starrte auf den wettergegerbten Mann an meiner Seite. Schließlich, als ihr Stolz mir unerträglich geworden war, rief ich: »Mutter, warum bleibst du denn stehen?«
Dies schien den Bann zu brechen, und sie kam eilig herbei, um meinen Kopf an ihre Wange zu drücken.
»Meine Tochter, welch ein Wahn hat dich befallen, dass du solch einen Kerl mit nach Hause bringst?«, fragte sie schließlich und zeigte auf den Fahrer, der in seinen Hosentaschen nach Wechselgeld kramte, während er den Schein, den ich ihm gegeben hatte, zwischen seinen zerklüfteten Zähnen hielt.
»Ihn mitgebracht? Aber Mutter, nicht doch! Er hat mich gebracht! Er ist ein Fahrer!«, rief ich aus.
Nach dieser Offenbarung schlang meine Mutter ihre Arme um mich und entschuldigte sich für ihre irrige Annahme. Wir lachten uns das Missverständnis von der Seele. Dann entfachte sie ein lebhaftes Feuer auf dem Boden des Tipis und hing einen geschwärzten Kaffeekessel an eine der Zacken eines gegabelten, über die Flammen geneigten Stocks. In einer Pfanne, die sie auf einen Haufen roter Glut stellte, buk sie etwas ungesäuertes Brot. Dieses leichte Mittagsmahl brachte sie in die Hütte, wo sie es auf einen Tisch mit karierter Wachstuchtischdecke stellte.
Meine Mutter war nie zur Schule gegangen, und obwohl sie glaubte, bereit zu sein, ihre alten Gewohnheiten nach Belieben zugunsten der Lebensweise des Weißen Mannes aufzugeben, war sie in Wirklichkeit nur ein paar Kompromisse eingegangen. Die Vorhänge ihrer beiden Fenster, die einander genau gegenüberlagen, waren mit rosafarbenen Blumen bedruckt. Die ungestrichenen, grob mit der Axt behauenen und ineinander verfugten Holzblöcke waren ohne Flecken. Das Rasendach der Hütte schien sich mit winzigen Sonnenblumen brüsten zu wollen, deren Samen wahrscheinlich der ständig wehende Wind herbeigetragen hatte.
Ich lehnte meinen Kopf an die Wand und nahm den besonderen Geruch wahr, den ich nie habe vergessen können. Der Regen hatte die Erde und das Dach immer wieder durchtränkt, so dass es, wie in allen Behausungen dieser Art, stets nach feuchtem Lehmboden roch.
»Mutter, warum hast du denn dein Haus nicht betonieren lassen? Möchtest du denn keinen gemütlicheren Unterschlupf haben?«, fragte ich, als ich bemerkte, dass die offenkundigen Unbequemlichkeiten ihres Heims ihr gleichgültig zu sein schienen.
»Du vergisst, mein Kind, dass ich inzwischen alt geworden bin, und ich mache auch keine Perlenstickerei mehr. Und dein Bruder Dawée hat seine Anstellung verloren; wir haben nicht einmal mehr genug Geld, um uns etwas zu essen zu kaufen«, erwiderte sie.
Das letzte Mal, als ich von Dawée gehört hatte, war er Regierungsangestellter in der Reservation gewesen. Ich war überrascht, zu hören, dass er nun arbeitslos sei. Als sie die Verwirrung in meinem Antlitz sah, erklärte meine Mutter: »Dawée! Oh, hat er dir denn nicht erzählt, dass der Große Vater in Washington einen weißen Sohn geschickt hat, damit dieser den Stift deines Bruders von ihm übernehme? Seither kann Dawée nichts mehr mit seiner Ausbildung anfangen, die er in der Schule im Osten erhalten hat.«
Mir fehlten die Worte für eine Antwort. Ich fühlte mich innerlich aufgewühlt, und es gab nichts, was meine Gefühle hätte besänftigen können.
Dawée war in der Prärie unterwegs, und meine Mutter erwartete ihn nicht vor dem nächsten Tag zurück. Wir schwiegen.
Als ich einige Zeit später meinen Kopf hob, um das Seufzen des Windes in den Eckbalken besser hören zu können, bemerkte ich, dass an mehreren Stellen, an denen die Holzblöcke nicht ordentlich miteinander verfugt waren, Tageslicht durch die Wände in die schäbige Hütte sickerte. Ich wandte mich meiner Mutter zu und bat sie, mir mehr über Dawées Schwierigkeiten zu erzählen, aber sie sagte nur: »Nun, meine Tochter, seit vielen Wintern schon ist dieses Dorf ein Tummelplatz für weiße Räuber. Die Indianer können sich beim Großen Vater in Washington nicht beschweren, ohne dafür hier bestraft zu werden. Dawée versuchte, in einer unbedeutenden Angelegenheit für unseren Stamm für Gerechtigkeit zu sorgen, und jetzt siehst du, wie närrisch das war.«
Sie wartete darauf, was ich dazu sagen würde. Doch ich schwieg.
»Mein Kind, es gibt nur eine einzige Quelle der Gerechtigkeit, und ich habe unerschütterlich zum Großen Geist gebetet, damit er das Unrecht, das uns angetan wurde, rächen möge«, sagte sie schließlich, als sie sah, dass meine Lippen verschlossen blieben.
Ich war in meinen Grundfesten so erschüttert, dass ich an gar nichts mehr glauben konnte, und verzweifelt rief ich aus: »Mutter, hör auf zu beten! Der Große Geist schert sich nicht darum, ob wir leben oder sterben! Lass uns nicht nach dem Guten oder nach Gerechtigkeit suchen, dann werden wir auch keine Enttäuschung mehr finden!«
»Pst, mein Kind, red nicht so verrückt daher. Es ist Taku Iyotan Wasaka,3 zu dem ich bete«, antwortete sie mir und streichelte mir den Kopf, so wie sie es zu tun pflegte, als ich noch ein kleines Kind war.
III – Meine Mutter verflucht die weißen Siedler
In einer finsteren Nacht saßen meine Mutter und ich allein vor unserer Hütte im matten Licht der Sterne. Wir blickten in die Richtung des Flusses, während wir darüber sprachen, dass die Grenzen unseres Dorfes immer enger wurden. Sie erzählte mir von den von Armut getriebenen weißen Siedlern, die in Höhlen lebten, die sie in den langgezogenen Schluchten zwischen den hohen Hügeln auf der anderen Seite des Flusses gegraben hatten. Ein ganzer Stamm plumpfüßiger weißer Bettler war hierher geströmt, um Anspruch auf diesen wilden Landstrich zu erheben.
Ich konnte am Steilufer ein schwaches, flimmerndes Licht erkennen.
»Dort, wo du das Feuer siehst, steht die Hütte eines Weißen Mannes«, sagte meine Mutter. Unweit davon, aber etwas tiefer, war noch ein Licht. Je besser meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten, erblickte ich immer mehr blinkende Lichter, verstreut über das weite, schwarze Gelände entlang des Flusses.
Ohne die Augen von dem fernen Feuer abzuwenden, fuhr meine Mutter fort: »Meine Tochter, hüte dich vor den Bleichgesichtern. Es war das grausame Bleichgesicht, das den Tod deiner Schwester und deines Onkels, meines tapferen Bruders, verursacht hat. Es ist eben dieses Bleichgesicht, das dir mit der einen Hand die Heilige Schrift reicht und mit der anderen die heilige Taufe mit Feuerwasser vollzieht. Es ist der Heuchler, der mit einem Auge liest: ›Du sollst nicht töten‹ und sich mit dem anderen am Unglück der indianischen Rasse weidet.« Als sie beim Steilufer plötzlich noch ein Feuer sichtete, rief sie aus: »Nun, meine Tochter, dort ist das Licht eines weiteren weißen Lumpen!«
Sie sprang auf, und unerschütterlich neben ihrem Tipi stehend, sandte sie einen Fluch aus gegen jene, die um das Licht des verhassten Weißen Mannes herum saßen. Mit einer gewaltsamen Bewegung hob sie ihren rechten Arm auf Augenhöhe empor und stieß die geballte Faust in Richtung der Fremdlinge. All ihre Macht lag in diesem Stoß. Sie öffnete die Faust. Lange stand sie so da, die ausgestreckten Finger in Richtung der Hütte des Siedlers, und es war, als strömte eine unsichtbare Kraft aus ihnen hin zu dem Bösen, auf das sie zielte.
IV – Rückschau
Ich verließ meine Mutter und kehrte in die Schule im Osten zurück. Etliche Monate vergingen, und langsam begriff ich, dass die große Armee der weißen Lehrer an den Indianerschulen einen noch größeren missionarischen Eifer besaß, als ich gedacht hatte.
Bei diesem Eifer ging es nicht weniger um Selbsterhaltung als um die Ausbildung von Indianern.
Unter den Lehrern für die Indianer war ein Opiumesser, und ich verstand nicht, was von ihm Gutes zu erwarten sei, bis mir ein Christ, der eine verantwortliche Position innehatte, erklärte, dass diese kürbisfarbene Kreatur eine schwache Mutter habe, die er unterstützen müsse.
Ein ständig angetrunkenes Bleichgesicht hockte blöde auf seinem Arztstuhl, und seine indianischen Patienten mussten ihre Gebrechen vor der Zeit zu Grabe tragen. Der Mann hatte nämlich eine schöne Frau, die ohne sein Doktorgehalt nichts zu essen gehabt hätte.
Es fällt mir auch schwer, jenen Weißen Mann einen Lehrer zu nennen, der einen ehrgeizigen indianischen Jugendlichen, der bereit war, tapfer die Wege der Weißen zu beschreiten, immer wieder damit quälte, dass er ihn regelmäßig daran erinnerte, dass er nichts weiter sei als ein »Almosenempfänger der Regierung«.
Überall entdeckte ich Beispiele, die nicht weniger beschämend waren als die erwähnten, und eine tiefe Scham brannte in mir. Doch ich konnte nichts sehen, was hätte helfen können. Manchmal gab es auch Weiße, die auf edelmütige Weise für meine Rasse tätig waren. Aber diese wenigen hatten nicht die Macht, ihresgleichen für die Arbeit einzustellen. Ein Mann wurde vom Großen Vater ausgesandt, damit er die Indianerschulen inspiziere, aber was er zu Gesicht bekam, waren üblicherweise Musterarbeiten von Schülern, die zu Ausstellungszwecken angefertigt wurden. Mich ärgerte diese Verschlagenheit der Angestellten, die den bleichen Vater der Indianer in Washington hintergingen.
Meine Krankheit, die mich davon abgehalten hatte, meine Collegeausbildung abzuschließen, und das, was meine Mutter über die vordringenden Grenzlandsiedler berichtet hatte, hatten mich nicht in die Stimmung versetzt, mir Mühe zu geben, die potentiell guten Seiten meiner weißen Kollegen ergründen zu wollen.
In diesem Stadium meiner Entwicklung war ich bereit, Männer, die nichts Großes zu leisten vermochten, dafür zu verfluchen, dass sie die Zwerge waren, als die Gott sie geschaffen hatte. Im Laufe meiner Ausbildung hatte ich alle Aufmerksamkeit für meine natürliche Umgebung verloren. Und somit wandte ich mich, ohne es zu wissen, von meinem eigenen Heil ab, wenn ich mich heimlich grollend in das kleine, weißwandige Gefängnis zurückzog, das ich als mein Zimmer bezeichnete.