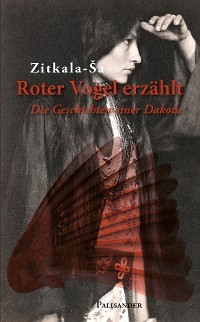Kitabı oku: «Roter Vogel erzählt», sayfa 6
Müde und gehetzt erreichte ich den Eingang des Tipis. Ich nahm das Fleisch in die Arme und betrat das Tipi.
»Vater, hier ist Nahrung«, rief ich und ließ das Fleisch nahe meiner Mutter zu Boden fallen. Es kam keine Antwort. Als ich mich umdreht, erkannte ich, dass mein grauhaariger Vater tot war! Im unsteten Licht des Feuers nahm ich ein altes, grauhaariges Skelett wahr, das starr und steif dalag.
Ich ging hinaus und weinte, und der Schnee zu meinen Füßen färbte sich vom Blut.
V
Am Tag, nachdem mein Vater gestorben war, führte ich meine Mutter zum Lager des Medizinmannes, und dann stellte ich mich denen, die nach dem Mörder des Bleichgesichts suchten.
Sie banden mir Hände und Füße. Vor vier Tagen brachten sie mich in diese Zelle.
Die jaulenden Winterwinde sind mir hierher gefolgt. Sie rütteln an den Gitterstäben und heulen unaufhörlich: »Dein sanftes Herz! Dein sanftes Herz wird mich sterben sehen, bevor du mir zu essen bringst!«
Horch! Die Kette an der Tür scheppert. Die Tür wird geöffnet. Aus der dunklen Nacht kommt eine schwarze Gestalt über die Schwelle geschritten … Es ist der Wärter. Er kommt, um mir mein Schicksal zu verkünden. Er sagt mir, dass ich morgen sterben müsse. Ich lache ihm laut ins ernste Gesicht. Ich habe keine Furcht vor dem Tod.
Und doch wüsste ich gern, wer mich willkommen heißen wird in dem fremden Reich. Wird mir der liebevolle Jesus Vergebung gewähren und meiner Seele besänftigenden Schlummer schenken? Oder wird mein Kriegervater mich begrüßen und mich als seinen Sohn empfangen? Wird mein Geist hinauf in einen glücklichen Himmel fliegen? Oder werde ich in eine bodenlose Grube stürzen, verstoßen von einem Gott der unendlichen Liebe?
Bald, sehr bald werde ich es wissen, denn ich sehe bereits, wie sich der östliche Himmel zu röten beginnt. Mein Herz ist stark. Mein Antlitz ist ruhig. Meine Augen sind trocken und begierig darauf, neue Dinge zu erblicken. Meine Hände hängen ruhig an meinen Seiten. Gelassen und tapfer wartet meine Seele auf die Männer, die mich zum Galgen führen werden für einen neuen Flug. Ich gehe.
Der Weg der Prüfung
Es war eine Herbstnacht in der Prärie. Die Rauchabzugsklappen des kegelförmigen Tipis flatterten matt im Wind. Vom tiefstehenden Nachthimmel mit seinen unzähligen Feuerpünktchen spähte ein großer, heller Stern durch das Abzugsloch auf zwei Dakota-Frauen herab, die sich im Dunkeln unterhielten. Eine junge Frau von zwanzig Sommern, die auf einem Bett aus Süßgras lag, trank mit den Augen das sanfte Licht des Sterns. Auf der entgegengesetzten Seite des Tipis, hinter der Feuerstelle in der Mitte, hatte die Großmutter ihre Decke ausgebreitet. Sie hatte sich bereits hingelegt gehabt, aber da sie eine Geschichte erzählen wollte, hatte sie sich wieder aufgerichtet.
Ihre Augen sind fest geschlossen. Mit ihrer mageren Hand streicht sie sich über ihr vom Wind gelichtetes Haar.
»Ja, meine Enkeltochter, die Legende besagt, dass die großen, hellen Sterne weise, alte Krieger und die kleinen, matt leuchtenden hübsche, junge Burschen sind«, sagt sie mit hoher, zittriger Stimme.
»Dann ist der, der oben durch das Rauchloch hereinspäht, mein lieber, alter Großvater«, scherzt die junge Frau mit langgezogenen Worten.
Ihre weiche, volle Stimme schwebt durch die Dunkelheit im Tipi, über die erkaltete Asche, die sich auf der Feuerstelle häuft, und dringt in das Ohr der zahnlosen Alten, die still vor sich hinträumt. Von dort aus fliegt sie auf schnellen Flügeln über den Schnee vieler Winter hinweg, bis sie sich schließlich ihren Weg bahnt in die warme, lichte Welt der Jugend ihres Großvaters. Von diesem Ort kommt die Antwort ihrer Großmutter: »Hör zu! Ich bin wieder jung. Es ist der Tag, an dem dein Großvater stirbt. Ich meine den älteren, denn es gab ja zwei von ihnen. Sie waren wie Zwillinge, obgleich sie keine Brüder waren. Unzertrennliche Freunde waren sie! Alle Dinge, die guten wie die schlechten, teilten sie miteinander, bis auf eines, das sie um den Verstand brachte. In heißem Wahn erschlug der jüngere Mann seinen engsten Freund. Er tötete seinen älteren Bruder, denn ihre Zuneigung hatte sie zu Verwandten werden lassen.«
Die Stimme der alten Frau brach. Mit nach vorn gebeugten Schultern schaukelte sie, auf den Fersen hockend, vor und zurück, und sie murmelte mit verhaltenem Atem unverständliche Worte. Ihre Augen, die sie vor der Nacht fest verschlossen hielt, betrachteten das dahinterliegende Licht vergangener Tage. Wieder sah sie, wie eine schwarze Wolke sich über das Land wälzte. Ihr Ohr vernahm das tiefe Grollen eines Gewitters im Westen. Sie zog den Kopf tief ein, während wütende Donnervögel ihre Schreie durch den Himmel schallen ließen. »Heya! Heya!« – »Nein! Nein!«, stöhnte die Großmutter angesichts des Wütens, das sie durch ihr Erinnern heraufbeschworen hatte. Doch der herrliche Frieden, der folgte, als der strahlende Sonnenschein die Menschen wieder froh stimmte, lockte ihre Erinnerung weiter, durch das Unwetter hindurch.
»Wie schnell, wie laut schlägt mein Herz nun, da ich die schreckliche Geschichte des Boten vernehme!«, stößt sie hervor. »Vom frischen Grab des Ermordeten ist er zu unserem Tipi geeilt. Ohne dazu aufgefordert zu sein, lässt er sich bedächtig, die bloßen Schienbeine überkreuzt, neben meinem Vater nieder, der eine langstielige Pfeife raucht. Kaum ist er etwas zu Atem gekommen, beginnt er, noch immer keuchend: ›Er war ein einziger Sohn und ein vielgeliebter Bruder.‹
Er wirft mir einen wilden, argwöhnischen Blick zu, als wäre ich mit dem Mörder, meinem Liebsten, verbündet. Mein Vater, der den süß duftenden Rauch ausstößt, lässt ein zustimmendes ›Hau!‹ vernehmen. Dann unterbricht er das ›Eya‹, das sich auf den Lippen des rundäugigen Übermittlers der Nachricht formt, und fragt: ›Mein Freund, möchtest du rauchen?‹ Er ergreift die Pfeife an ihrem Kopf aus rotem Stein und hält dem Mann den schlanken Stiel hin. ›Ja, ja, mein Freund‹, antwortet dieser und streckt seinen langen, braunen Arm aus.
Viele Herzschläge lang pafft er blauen Rauch aus, der wie eine Wolke zwischen uns steht. Doch sogar durch den Nebel aus Rauch hindurch sehe ich, wie seine scharfen, schwarzen Augen zu mir herüber funkeln. Ich brenne darauf zu fragen, welches Schicksal den jungen Mörder erwartete, aber ich wage nicht, meine Lippen zu öffnen, damit nicht stattdessen Schreie aus mir herausbrechen. Mein Vater stellt die Frage. Der Mann gibt die Pfeife zurück und erwidert: ›Oh, der Häuptling und seine besten Männer haben sich beraten. Sie sind übereingekommen, dass es nicht sicher wäre, einen Mörder frei unter uns zu haben. Derjenige, der einen aus unserem Stamm tötet, ist ein Feind, und er muss das Schicksal eines Feindes erleiden.‹
Meine Schläfen schlagen wie zwei Herzen!
Während ich zuhöre, kommt ein berittener Ausrufer am Tipi meines Vaters vorüber. Mit den Schritten seines Ponys schwankend, ruft er mit lauter Stimme die folgenden Worte (Horch! Ich kann sie jetzt hören!): ›Ho-po! Hört zu, ihr Leute. Eine schreckliche Tat ist geschehen. Zwei Freunde – ach, Brüder im Herzen! – hatten Streit miteinander. Nun liegt der eine aufgebahrt auf dem Hügel, während der andere, ein furchtbarer Menschenmörder, in seiner Behausung sitzt. Unser Häuptling sagt: ‚Er, der einen aus unserem Stamm tötet, verübt den Angriff eines Feindes. Als ein solcher muss er verurteilt werden. Lasst den Vater des toten Mannes die Art der Folter oder des Todes wählen. Er hat grausame Qualen erlitten, und er allein kann beurteilen, mit welcher Strafe seine Missetat gesühnt werden muss.‘ Dies ist geschehen.
Kommt nun alle herbei, damit ihr seht, wie das Urteil vollstreckt wird, das ein Vaters über jenen, der einst der beste Freund seines Sohnes war, gefällt hat. Ein wildes Pony ist mit dem Lasso eingefangen worden. Der Mörder muss aufsitzen und die tobende Bestie reiten. Bildet zwei parallele Reihen, vom Tipi im Zentrum, das der trauernden Familie gehört, bis zum Tipi im Außenkreis. In dem großen Zwischenraum zwischen euch liegt der Weg der Prüfung. Am Außenkreis muss der Reiter aufsitzen und sein Pony zum Tipi in der Mitte bringen. Wenn er es schafft, die gesamte Strecke auf dem Rücken des Ponys zurückzulegen, dann wird sein Leben geschont, und es wird ihm vergeben. Doch sollte er fallen, dann hat er selbst den Tod gewählt.‹
Der Ausrufer verstummt. Im ganzen Dorf herrscht atemlose Stille. Dann eilen Füße durch das hohe Gras – raschel, raschel. Schluchzende Frauen eilen zum Weg der Prüfung. Das gedämpfte Stöhnen, das das ganze runde Zeltlager durchdringt, ist unerträglich. Oh! Ich sehe starke Männer, die versuchen, das Pony am Lasso zu führen. Es schlägt aus und bäumt sich, und weißer Schaum fliegt ihm vom Maul. Der Schmerz schnürt mir die Kehle zu, als ich meinen schönen Liebsten erkenne, wie er einsam und verlassen mit versteinertem Gesicht auf das Pony zuschreitet. ›Falle nicht! Wähle das Leben und mich!‹, ruft es in mir, aber meine Lippen verberge ich hinter meiner dicken Decke.
In einem Augenblick springt er rittlings auf den Rücken des verängstigten Pferdes, und die Männer lassen es los. Wie ein Pfeil, der von einem starken Bogen schnellt, jagt das Pony mit vorgestreckten Nüstern den halben Weg zum Tipi im Zentrum hin. Mit all seiner Kraft zieht der Reiter an den starken Zügeln. Das Pony macht die Beine steif und hält jäh an. Der Reiter wird nach vorn geschleudert, aber er stürzt nicht herab. Nun schlägt die rasende Kreatur aus, mit fliegenden Hinterbeinen. Die Reihe der Männer und Frauen weicht zurück. Jetzt stehen alle wieder still, sicher vor der ausschlagenden, schnaubenden Bestie.
Das Pony ist wild, seine großen, schwarzen Augen treten ihm aus den Höhlen. Es springt in die Luft, den Rücken zu einem Buckel gekrümmt, die Nase zum Boden gerichtet. Ich schließe die Augen. Ich will ihn nicht fallen sehen.
Ein lauter Schrei steigt aus den rauhen Kehlen der Männer und Frauen. Ich öffne die Augen. Ha! Das wilde Pferd ist besiegt. Mein Liebster sitzt am Eingang des Tipis im Zentrum ab. Das Pony, schweißnass und vor Erschöpfung bebend, steht wie ein schuldbewusster Hund an der Seite seines Herrn und Meisters. Hier, am Eingang des Tipis, sitzen die Hinterbliebenen, der Vater, die Mutter und die Schwester. Der alte Vater erhebt sich. Mit zwei großen Schritten geht er auf den Mörder seines einzigen Sohnes zu und ergreift seine Hand. Er hält sie, so dass die Leute es sehen können, und er ruft mit leidenschaftlicher Stimme: ›Mein Sohn!‹ Überraschtes Gemurmel, einem plötzlichen Windstoß gleich, durcheilt die Reihen.
Die Mutter, deren Augen geschwollen sind und deren Haar glatt über ihren Schultern abgeschnitten ist, steht jetzt ebenfalls auf. Sie eilt zu dem jungen Mann, nimmt seine rechte Hand. ›Mein Sohn!‹, grüßt sie ihn. Doch beim zweiten Wort bricht ihre Stimme, und schluchzend wendet sie sich ab.
Die jungen Leute heften ihre Augen auf die junge Frau. Sie rührt sich nicht. Mit gebeugtem Haupt sitzt sie reglos da. Der alte Krieger spricht zu ihr: ›Gib dem jungen Burschen die Hand, meine kleine Tochter. Er war viele Jahre lang der Freund deines Bruders. Nun muss er dir Freund und Bruder zugleich sein.‹
Bei diesen Worten erhebt sich das Mädchen. Langsam streckt sie ihre schlanke Hand aus, dabei weint sie, und ihre Lippen sind verzerrt. –›Mein Bruder!‹ Und damit ist die Prüfung beendet.«
»Großmutter!« platzte es aus dem Mädchen auf dem Bett aus Süßgras heraus. »Ist das wahr?«
»Aber gewiss doch!«, antwortete die Großmutter mit warmherziger Stimme. »All das ist wahr. In den fünfzehn Jahren, die wir miteinander verheiratet waren, gingen viele Ponys durch unsere Hände, aber dieser kleine Sieger, Ohiyesa, war stets ein Mitglied unserer Familie. Schließlich, an dem traurigen Tag, an dem dein Großvater starb, wurde Ohiyesa an seinem Grab getötet.«
Inzwischen waren die verschiedenen Sternengruppen weitergezogen und zeigten an, dass es bereits tief in der Nacht war, doch die alte Dakota-Frau begann, die Begräbniszeremonie zu schildern.
»Mein Enkelkind, ich habe kaum je von den heiligen Geheimnissen in meinem Herzen gesprochen. Doch heute Nacht muss ich dir eines davon offenbaren. Gewiss bist du nun alt genug, es zu verstehen.
Unser weiser Medizinmann sagte, dass ich gut daran getan habe, Ohiyesa seinem Herrn hinterherzuschicken. Vielleicht wird dein Großvater bei der Reise auf dem Geisterpfad müde, und sein Herz wird sich nach seinem Pony sehnen. Das Tier, das bereits auf den Weg der Geister gesendet wurde, wird dann von diesem zarten Wunsch angezogen werden. Gemeinsam werden dann Herr und Pferd das nächste Zeltlager erreichen.«
Die Frau verstummte. Nur noch die tiefen Atemzüge des Mädchens waren in der Stille zu vernehmen, denn sogar der Wind hatte sich inzwischen selbst in den Schlaf gewiegt.
»Hinnu! Hinnu!5 Sie schläft!«, murmelte sie missmutig. »Ich habe ungehört ins Dunkle hinein geredet. Ich hätte gewünscht, dass das Mädchen dieser heiligen Geschichte ihr Herz widmen würde.«
Sie kuschelte sich in ihr Bett aus süß duftendem Gras und dämmerte in einen anderen Traum hinüber. Noch immer strahlte der Beschützer-Stern am nächtlichen Himmel voll Mitgefühl auf das kleine Tipi in der Prärie herab.
Die Tochter eines Kriegers
Im nachmittäglichen Schatten eines großen Tipis mit rotbemalten Rauchabzugsklappen saß ein Krieger-Vater mit gekreuzten Beinen. Er hielt den Kopf so, dass sein schweifender Blick ohne Weiteres das gewaltige Flachland bis hin zum östlichen Horizont erfassen konnte.
Er war des Häuptlings tapferster Krieger. Mit seinen Heldentaten hatte er sich das Privileg verdient, sein Zelt im Innern des großen Kreises der Tipis aufschlagen zu können.
Er war auch einer der freigebigsten Männer gegenüber den zahnlosen, alten Leuten. Dies war der Grund, weshalb er ein Recht auf rotbemalte Rauchabzugsklappen an seiner kegelförmigen Behausung hatte. Er war stolz auf diese Ehren. Er wurde nie müde, Abend für Abend seine eigenen Heldentaten zum Besten zu geben. Auch wenn er es liebte, sich an Tipifeuern über seinen hohen Rang und seinen großen Ruhm zu verbreiten, so war seine größte Freude doch seine kleine, stämmige, schwarzäugige Tochter von acht Wintern.
Er saß im weichen Gras neben seiner Frau, die über ihre Perlenarbeit gebeugt war, sang ein Tanzlied und schlug mit seinen schlanken Händen leicht den Rhythmus dazu.
Seine scharfen Augen blickten vor Freude milde, während er zusah, wie der kleine Körper inmitten des Grüns mit leichten Bewegungen tanzte.
Es ist Tusees erste Tanzstunde. Ihre fest geflochtenen Zöpfe biegen sich über ihren braunen Ohren wie ein Paar gekrümmter, kleiner Hörner, die in der Sommersonne schimmern.
Die Füße, die in bequemen Mokassins stecken, stehen dicht beieinander. Eine ihrer kleinen Hände ist an ihrem Gürtel, um die lange Perlenkette, die von ihrem bloßen Hals herabhängt, festzuhalten. Sanft beugt sie die Knie im Rhythmus der Stimme ihres Vaters.
Nun wagt sie eine größere Bewegung, leicht aufwärts gerichtet und zur Seite, in einem Kreis. Schließlich kommt das Lied an sein Ende, und die kleine Frau, die ein Kleid aus perlenbesticktem Hirschleder trägt, setzt sich neben die große Frau. Gleich ihrer Mutter hockt sie auf ihren Fersen. Nach einer kurzen Pause wiederholt der Krieger den letzten Refrain. Schon springt Tusee wieder auf und tanzt zum schwingenden Rhythmus der letzten Takte.
Gerade, als der Tanz zu Ende war, ritt ein älterer Mann, der sein kurzes, drahtiges Haar lose über den kantigen Schultern trug, von hinten an sie heran und sprang gewandt vom Rücken seines Ponys. Er ließ die rohledernen Zügel zu Boden fallen und sank träge ins Gras.
»Hunhe,6 du bist schnell zurückgekehrt«, sagte der Krieger, während er die Hand nach seiner kleinen Tochter ausstreckte.
Rasch eilte das Kind an seine Seite und kauerte sich neben ihn hin, und er legte ihm zärtlich seinen starken Arm um die Schultern. Vater und Tochter blickten zu dem im Gras liegenden Mann und warteten auf seinen Bericht.
»Es ist wahr«, begann der Mann, der einen fremdartigen Akzent hatte. »Dies ist die Nacht des Tanzes.«
»Hunhe!«, murmelte leicht überrascht der Krieger.
Der Mann stützte sich auf die Ellbogen und hob sein Gesicht. Seine Züge waren die eines Indianers aus dem Süden. Vor vielen Jahren hatte Tusees Vater ihn in einem feindlichen Lager gefangengenommen. Doch die ungewöhnlichen Fähigkeiten des Sklaven hatten das Herz des Sioux erweicht, und vor drei Wintern hatte er ihm die Freiheit geschenkt. Er war nun wieder ein echter Mann. Er durfte sein Haar wieder lang wachsen lassen. Er hatte sich allerdings dazu entschlossen, bei der Familie des Kriegers zu bleiben.
»Hunhe!«, stieß erneut der Krieger-Vater hervor. Dann wandte er sich an seine kleine Tochter und fragte:«Tusee, hast du das gehört?«
»Ja, Vater, und ich werde heute Abend tanzen!«
Mit diesen Worten entwand sie sich seinem Arm und tollte vor Freude umher.
Als sie dies sah, lachte die Mutter verhalten. Dann fragte sie skeptisch, die neugierigen Augen fest auf das Mädchen gerichtet: »Mein Kind, zu Ehren deines ersten Tanzes muss dein Vater ein großzügiges Geschenk spenden. Seine Ponys sind wild und streifen hinter dem großen Hügel umher. Sag doch bitte, was könnte er denn anbieten?«
»Ein Pony aus der Herde, Mutter, ein flinkfüßiges Pony aus der Herde!«, rief Tusee spontan aus. Sie wies mit ihrem kleinen Zeigefinger auf den im Gras liegenden Mann und rief: »Onkel, du musst morgen ein Pony holen!« Und zufrieden mit ihrer Lösung des Problems, hüpfte sie wild umher. Ihr kindliches Vertrauen zu ihren Eltern beruhte nicht auf dem Wissen um die den Menschen gesetzten Grenzen, sondern auf dem Glauben, dass für Erwachsene alles möglich sei.
»Ha-hob!«, rief die Mutter aus, mit ansteigendem Tonfall; damit brachte sie ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass der in den Wolken schwebende Geist ihrer Tochter nicht von einer Ablehnung beschwert werden möge.
Der Mann reagierte unverzüglich und sagte: »Hau! Ich gehe, wenn Tusee das so möchte!«
Dies erfreute die Kleine über die Maßen, und ihre schwarzen Augen strahlten. Sie stand vor dem starken Mann und klatschte vor Freude in die Hände.
»Wie froh mich das macht! Mein Herz ist so glücklich! Geh, Onkel, und bringe mir ein hübsches Pony!«, rief sie. Sogleich wollte sie forthüpfen, aber eine plötzliche Eingebung hielt sie an dem Ort, an dem sie in schräger Haltung stand, fest. Der Mann hatte ihr viele Wörter und Sätze aus seiner eigenen Sprache beigebracht, und in dieser Sprache brach es aus ihr hervor: »Danke, guter Onkel, danke!«, und schon tollte sie vom schieren Übermaß an Freude getrieben wild umher.
Der stolze Krieger-Vater lächelte und zog die Brauen zusammen. Zustimmend murmelte er: »Howo! Hechetu!«7
Wie ihre Mutter hat Tusee feingezeichnete Augenbrauen und leicht vergrößerte Nasenlöcher, aber von ihrer kräftigen Statur her ähnelt sie dem Vater. Dieser versucht nun, da sie herangewachsen ist, all ihre Freier abzuwehren, da keiner dem Stolz seines alten Herzens gerecht zu werden scheint.
Als treue Tochter sitzt sie in ihrem Tipi und bestickt für ihren Vater Hirschleder mit Perlen. Doch Tusee ist nicht allein in ihrer Behausung. Nahe beim Eingang sitzt ein junger Bursche halb zurückgelehnt auf einer Matte. Schweigend betrachtet er die Blütenblätter einer Wildrose, die auf dem weichen Wildleder entstehen. Mit flinken Händen lässt die junge Frau die Perlen auf den silbrigen Sehnenfaden gleiten und arbeitet sie in das hübsche Blumenmuster ein. Schließlich sagt der junge Mann mit leiser, tiefer Stimme: »Die Sonne hat den Zenit längst überschritten. Sie steht nur noch mannshoch über dem westlichen Rand des Landes. Ich bin hierher geeilt, um dir zu sagen, dass ich mich morgen dem Kriegertrupp anschließen werde.«
Er wartet auf eine Antwort, aber der Kopf der jungen Frau neigt sich noch tiefer über ihr Hirschleder, und ihre Lippen sind noch fester verschlossen. Er fährt fort: »Letzte Nacht im Mondschein bin ich deinem Vater begegnet. Er schien zu wissen, dass ich gerade aus deinem Tipi gekommen war. Ich fürchte, das hat ihm nicht gefallen, denn obgleich ich ihn grüßte, blieb er stumm. Ich stellte mich ihm in den Weg. Mit aller Kühnheit, die ich aufbringen konnte, bat ich ihn, während mein Herz in der Brust fast zersprang, um die Hand seiner einzigen Tochter.
Er richtete sich hoch auf, zog seinen Umhang fester um seine stolze Gestalt, und seine blitzenden Augen schienen mich zu durchbohren. ›Junger Mann‹, sagte er langsam mit solch kalter Stimme, dass ich bis ins Knochenmark fröstelte, ›hör mir zu. Mit nichts als der Skalplocke eines Feindes, frisch von deiner eigenen Hand gepflückt, wirst du Tusee als deine Frau gewinnen können.‹ Dann wandte er sich auf den Fersen um und stolzierte davon.«
Tusee schob ihre Arbeit zur Seite. Mit ernstem Blick betrachtete sie das Antlitz ihres Liebsten. »Mein Vater hat eigentlich ein freundliches Herz. Er möchte sicher sein, dass du tapfer und aufrichtig bist«, murmelte die Tochter, die keine Feindseligkeit zwischen den beiden, die sie liebte, wünschte.
Der junge Mann stand auf, um zu gehen, und streckte ihr die rechte Hand entgegen. »Ergreife meine Hand ein einziges Mal ganz fest, bevor ich gehe. – Hoye!8 – Bitte sag mir, wirst du auf mich warten und nach mir Ausschau halten?«
Tusee nickte nur zustimmend, denn bloße Worte sind nichtssagend.
Am frühen Morgen erwacht das runde Zeltlager mit einem Lied. Männer und Frauen singen von Mut und Triumph. Das lässt die Brüste der bemalten Krieger vor Stolz schwellen, die auf tänzelnden Ponys sitzen, welche mit grünen Zweigen geschmückt sind.
Ein laut singender Krieger nach dem anderen reitet langsam den großen Kreis der kegelförmigen Tipis entlang und schwört, einst begangenes Unrecht zu rächen; er stößt den bloßen, braunen Arm in Richtung des purpurfarbenen Ostens und ruft den Großen Geist an, dass er seinen Schwur vernehmen möge. Nachdem ein jeder diese Runde gemacht hat, galoppiert der singende Kriegertrupp nach Süden.
Rittlings auf ihren mit Nahrung und Hirschhäuten beladenen Ponys sitzend, folgen tapfere ältere Frauen ihren Kriegern. Weit vorn unter ihnen reitet eine junge Frau in einem kunstvoll mit Perlen bestickten Wildlederkleid. Stolz sitzt sie da, und sie zügelt ein wildäugiges Pony mit einer Schlaufe aus Rohleder. Es ist Tusee auf dem Kriegspferd ihres Vaters.
Und so entschwindet der Kriegertrupp aus indianischen Männern und ihren getreuen Frauen am südlichen Horizont.
Eine Tagesreise bringt sie sehr nah ans Grenzland des Feindes. Bei Einbruch der Nacht stehen zwei gleich aussehende Tipis in einer tiefen Schlucht. Das eine beherbergt die bemalten Krieger, die ihre Pfeifen rauchen und sich im Licht des Feuers unheimliche Geschichten erzählen, während im anderen Zelt wachsame Frauen ängstlich um das Feuer herum hocken.
Im ersten, fahlen Dämmerlicht im Osten sind die Tipis abgebaut. Es ist niemand mehr da. Die Krieger sind im Lager des Feindes und zerschlagen Träume mit ihren Tomahawks. Die Frauen sind an verborgenen Orten in der langen, mit Gebüsch bestandenen Schlucht versteckt.
Der Tag ist weit fortgeschritten, die rote Sonne senkt sich im Westen herab.
Endlich kehren die Krieger in die Schlucht zurück, einer nach dem anderen. Im Zwielicht zählen sie die ihren. Drei werden vermisst. Von diesen sind zwei tot, aber der dritte, ein junger Mann, ist ein Gefangener des Feindes.
»He-he!«, klagen die Krieger und essen hastig.
Schweigend eilen die Frauen mit langen Schritten hin und her, binden große Bündel auf die Rücken ihrer Ponys. Rasch muss der Kriegertrupp im Schutz der Nacht heimwärts reiten. Reglos, mit gebeugtem Haupt, sitzt eine Frau in ihrem Versteck. Sie trauert um ihren Liebsten.
Mit Bitterkeit im Herzen hört sie das Gemurmel der Krieger. Mit zusammengebissenen Zähnen schmiedet sie einen Plan, wie sie mit List dem verhassten Feind seinen Gefangenen entreißen kann. Jetzt werden leise Signale gegeben, und der Kriegertrupp stiehlt sich still davon. Niemand hat bemerkt, dass Tusee nicht dabei ist. Das gedämpfte Getrappel von Ponyhufen wird leiser und leiser. Die zunehmende Stille in der leeren Schlucht summt laut in den Ohren der jungen Frau. Mit angehaltenem Atem lauscht sie, ob Schritte in der Nähe zu vernehmen sind. Ihre rechte Hand ruht auf dem langen Messer in ihrem Gürtel. Sie weiß, wo ihr Pony versteckt ist, aber jetzt braucht sie es noch nicht. Zufrieden darüber, dass keine unmittelbare Gefahr droht, schleicht sie sich aus ihrem Versteck. Ihr Gang gleicht dem eines Panthers, als sie den hohen Bergrücken jenseits der tiefen Schlucht erklimmt. Von hier aus späht sie nach den Lagerfeuern des Feindes.
Wie verwurzelt mit dem kahlen Felsen, steht die schlanke Gestalt der Frau mitten in der Nacht, eine Silhouette vor dem Sternenhimmel. Der kühle Nachtwind trägt Fetzen von Liedern und Getrommel zu ihren brennenden Ohren. Voll verzweifeltem Hass presst sie die Zähne aufeinander.
Tusee hebt die Hände zu den Sternen, auf dass sie ihr Zeuge seien. Mit leidenschaftlicher Stimme und erhobenem Antlitz fleht sie: »Großer Geist, lass mich eilends meinen Liebsten retten! Gib mir eine List ein, damit es mir noch in dieser Nacht gelingt! Allmächtiger Geist, schenke mir das Herz meines Krieger-Vaters, stark genug, um einen Feind zu töten, und mächtig genug, um einen Freund zu retten!«
Mitten im Zeltdorf des Feindes, in einem provisorischen Tanzhaus, sind Männer und Frauen in Festtagskleidung zu sehen. Es ist spät in der Nacht, aber die fröhlichen Krieger biegen ihre nackten, bemalten Körper im Schein eines hellen Feuers im Zentrum des Tanzplatzes. Zu den munteren Stimmen der Männer und im Takt der rhythmisch geschlagenen Trommel hüpfen und springen sie, und sie schwenken ihren Federschmuck.
Frauen mit rotbemalten Wangen und langem, zu Zöpfen geflochtenem Haar sitzen in einem großen Halbkreis an der runden Einfriedung aus Weidenzweigen. Auch sie fallen in den Gesang ein und stehen auf, um mit den siegreichen Kriegern zu tanzen.
Mitten auf diesem runden Tanzplatz steht ein Gefangener, der an einen Pfahl gebunden ist, verstört vor Scham und Kummer. Er lässt sein zerzaustes Haupt hängen.
Mit blicklosen Augen starrt er auf den bloßen Boden zu seinen Füßen. Mit Spottrufen und hämisch grinsenden Gesichtern verhöhnen die Tänzer den gefangenen Dakota. Rauflustige Burschen und kleine Jungen johlen und brüllen dazu.
Am Rande dieser lärmenden Menge blickt eine hochgewachsene Frau schweigend auf die erleuchtete Arena, die Ellbogen auf die runde Umzäunung gestützt. Das tanzende Feuer in der Mitte scheint hell in ihr hübsches Gesicht, doch in ihren schwarzen Augen ist es Nacht. Auf ihrem perlengeschmückten Kleid bricht sich das Licht in zahllose leuchtende Punkte. Ungeachtet des wogenden Getümmels zu ihren Seiten starrt sie zornig auf die hasserfüllten, höhnenden Männer. Plötzlich dreht sie sich um. Sie hört, wie nahe ihren Ohren Mädchen kichernd flüstern: »Dort! Dort! Seht, wie er dem Gefangenen ins Gesicht lacht! Das ist er, der auf den jungen Mann gesprungen ist und ihn an seinem langen Haar bis zu diesem Pfahl geschleift hat. Seht! Wie hübsch er ist! Wie anmutig er tanzt!«
Die stille junge Frau blickt zum gefesselten Gefangenen. Sie sieht einen Krieger, kaum älter als der Gefangene, der einen Tomahawk vor dem Gesicht des Dakota schwenkt. Brennender Hass springt aus ihren Augen und markiert den Mann als Racheopfer. Sie hört ihr Herz in ihrer Brust murmeln: »Komm, ich wünsche dir zu begegnen, du gemeiner Feind, der du meinen Liebsten gefangengenommen hast und ihn nun zu Tode folterst.«
Jetzt verstummen die Stimmen der Sänger, und die Tänzer gehen zu ihren Ruheplätzen entlang des Weidenholzkreises. Widerstrebend lässt der Sieger noch einmal seinen Tomahawk wirbeln, bevor er wie die anderen den Platz in der Mitte verlässt. Kopf und Schultern schwingen von Seite zu Seite, und er trägt das Kinn hoch erhoben, als er zur Einfriedung geht. Mit gekreuzten Beinen lässt er sich nieder. Mit einem ausgebreiteten Truthahnflügel fächelt er sich Luft zu.
Ab und zu unterbricht er sein hochmütiges Blinzeln, um aus den Augenwinkeln zu spähen. Er hört, wie eine Frau sich leise räuspert. Dies ist zweifelsfrei für sein Ohr bestimmt. Der Flügelfächer schwingt unregelmäßig hin und her. Schließlich dreht er sein stolzes Antlitz, so dass er über seine bloße Schulter blicken kann und sieht eine schöne Frau, die lächelt.
»Ah, sie will mit einem Helden sprechen!«, denkt er, und sein Herz springt wild in der Brust.
Die Sänger erheben ihre Stimmen im Einklang. Die Musik ist unwiderstehlich. Der Sieger springt wieder auf den offenen Platz. Von neuem grinst er dem Gefangenen ins Gesicht. Bei der nächsten Pause zwischen den Liedern kehrt er an seinen Ruheplatz zurück. Die junge Frau wartet hier auf ihn. Als er sich nähert, lächelt sie ihn kühn an. Ihm gefällt ihr Gesicht und ihr Lächeln.
Er schwenkt den Flügelfächer krampfartig vor seinem Gesicht hin und her; seine Ohren sind gespitzt. Er vernimmt ein leises Flüstern. Eine Hand tippt ihn leicht auf die Schulter. Die schöne Frau spricht zu ihm in seiner eigenen Sprache: »Komm mit, hinaus in die Nacht. Ich möchte dir sagen, wer ich bin.«
Er musste einfach wissen, welche süßen Worte des Lobes die schöne Frau für ihn haben würde. Mit den Händen schiebt er die Maschen der locker miteinander verflochtenen Weidenzweige auseinander und kriecht unbemerkt hinaus ins Dunkel.
Vor ihm steht die junge Frau. Sie winkt ihm mit ihrer grazilen Hand, sie weicht zurück, weg vom Licht und von der ruhlosen Menge der Zuschauer. Er folgt ihr mit ungeduldigen Schritten. Die Frau wendet sich von ihm ab und beschleunigt ihren Gang. Er vergrößert seine Schritte. Plötzlich schießt sie mit überraschender Schnelligkeit davon. Der junge Mann ballt die Fäuste und beißt sich auf die Unterlippe und rennt der fliehenden Frau hinterher. Auf seiner wilden Verfolgungsjagd vergisst er die Tanzfläche.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.