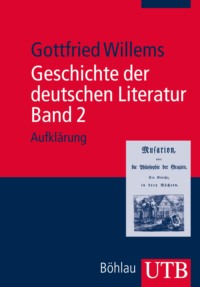Kitabı oku: «Geschichte der deutschen Literatur. Band 2», sayfa 5
Nachdem auch diese zentralen Fragen der Aufklärung und ihrer Literatur berührt worden sind, soll nun endlich Boswell selbst mit seinem Reisetagebuch zu Wort kommen und uns in die Welt des 18. Jahrhunderts führen, mit dem Ziel der Begegnung mit Voltaire und Rousseau.
2.1.4 Aufklärung im Alltag
Der Weg zu Voltaire und Rousseau führt Boswell zunächst nach Basel. Um diese beiden Protagonisten einer aufgeklärt-aufklärerischen Literatur sehen zu können, mußte er sich in die Westschweiz begeben, denn dort hielten beide sich damals, im Jahr 1764, auf; dorthin hatte sich der eine wie der andere vor mancherlei Verfolgung zurückgezogen.
[<< 56]
Boswell reist zusammen mit einem Diener, Jakob, einem ortskundigen Schweizer, sowie einem Mietkutscher.
Reisen im 18. Jahrhundert
Ein Reisender wie Boswell hatte seinerzeit verschiedene Möglichkeiten zu reisen. Die billigste Variante nach der Fußwanderung war die Reise mit der Postkutsche; es gab damals schon einen regelmäßigen Linienverkehr zwischen allen wichtigen Zentren Europas. Wesentlich teurer war es, mit einer eigenen Kutsche zu reisen, und womöglich mit einem eigenen Reisemarschall oder Hofmeister.38 Boswell folgt auch hier dem goldenen Mittelweg und reist auf mittlerem Niveau, lediglich mit einem Lohndiener und indem er sich für bestimmte Abschnitte des Wegs jeweils eine Kutsche mietet. Der Kutscher, der ihn nach Basel bringt, hat übrigens versucht, ihn übers Ohr zu hauen, und, wie Boswell beim Einsteigen empört vermerkt, die Kutsche auch noch an einen zweiten Reisenden vermietet, um die doppelte Taxe zu kassieren (BB 29). Gute alte Zeit! Aber Boswell weiß sich zu wehren.
Die erste Station in der Schweiz ist also Basel. Was macht ein Reisender wie Boswell in einer fremden Stadt? Als erstes sucht er sich natürlich ein Hotel, nicht anders als wir heute (BB 30). Dann allerdings tut er etwas, das heute nicht mehr üblich ist: er macht in Häusern seine Aufwartung, an die er empfohlen ist, gibt dort Empfehlungsschreiben ab, die er von früheren Stationen her mitbringt. Die gesellschaftliche Schicht, in der wir uns mit Boswell bewegen, unterhielt seinerzeit schon ein dichtes Netz von Bekanntschafts- und Freundschaftsbeziehungen kreuz und quer durch Europa, mit Hilfe von Korrespondenzen und wechselseitigen Besuchen. Das gilt zumal für die Aufklärer, die „Philosophen“, die allesamt auf solche Weise schon aufs engste vernetzt waren. Jeder von ihnen hatte Bekannte, die ihrerseits jemanden kannten, der da wohnte, wo er hinreiste, und die gaben ihm Empfehlungsschreiben mit, mit denen er sich dann vor Ort einführen konnte.
Das war natürlich für einen Reisenden äußerst praktisch; da hatte er in der fremden Stadt gleich ein, zwei Menschen, die ihm weiterhalfen. Und da ihn diese dann auch zu ihren eigenen Bekannten brachten, öffneten sich ihm bald alle Türen. Und auch für die Gastgeber waren solche Besuche höchst erfreulich; man hatte Abwechslung
[<< 57]
und hörte mal was Neues. Gäste zu haben und Gast zu sein, Gastfreundschaft zu praktizieren war seinerzeit überhaupt ein wichtiger Teil dessen, was man heute Freizeitgestaltung nennt. Und das war nicht nur unterhaltsam, sondern auch nützlich, konnte man so doch Beziehungen knüpfen, die in allen Belangen des Lebens von Vorteil waren. Die Gastgeber in der fremden Stadt gaben dem Reisenden womöglich selbst auch wieder Empfehlungsschreiben mit, die dann auf den nächsten Stationen der Reise hilfreich waren. So bringt Boswell z. B. von seinem Besuch in Leipzig ein Empfehlungsschreiben von Gottsched an den Stadtschultheißen von Basel, einen Herrn Wolleb, mit (BB 31); der Stadtschultheiß war der Chef der städtischen Justiz. Eine durchaus angenehme Form des Reisens; man war nirgends völlig fremd, wo immer man hinkam, wurde man von Gastfreundschaft aufgefangen.
Aufklärung unter Handwerkern
Der Reisegefährte, mit dem Boswell wegen der Geschäftstüchtigkeit seines Mietkutschers die Kutsche teilen muß, ist ein gewisser Boily; von dem weiß er zu berichten:
Es war ein artiger junger Mann, ein Kupferstecher, der sich drei Jahre in Holland aufgehalten hatte, recht manierlich für einen Franzosen. Die Fahrt (…) verlief angenehm. (…) Wir waren recht aufgeräumt. Boily (…) zog einen treffenden Vergleich zwischen seinen Landsleuten und den Engländern. „Die Engländer fühlen sich über alle Völker erhaben und schauen mit Verachtung auf sie herab. Die Franzosen verachten andere nicht, obwohl sie sich sicher allen anderen Völkern ebenso überlegen fühlen.“ Er brachte mir ein Lied bei. Ein Materialist ist er auch. Er machte kaum einen Unterschied zwischen Herr und Diener und wußte nicht, wann sprechen und wann den Schnabel halten. (BB 29 –30)
Also einem solchen Menschen hat man seinerzeit schon auf Reisen begegnen können: einem materialistischen Kupferstecher mit Auslandserfahrung, einem Handwerker mithin, keinem Mitglied der gebildeten Stände, der weit herumgekommen ist, sich als ein Materialist gibt und keinen Unterschied machen will zwischen Herr und Diener. Die Wendung ins Materialistische, der sogenannte Frühmaterialismus, war seinerzeit die allerneuste Entwicklung in der Philosophie der Aufklärung, kultiviert vor allem in Paris im Kreis der
[<< 58]
Enzyklopädisten, der Herausgeber und Beiträger eines vielbändigen Werks mit dem Titel „Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers“ (1751 –1780), in dem auf der Linie des Dictionnaire von Bayle in lexikalischer Form das gesamte Wissen der Zeit in aufklärerischem Sinne gesichtet und zusammengetragen wurde – das Urbild aller modernen Enzyklopädien. Im Sinne des Frühmaterialismus haben sich hier vor allem Julien Offroy de La Mettrie (1709 –1751) mit seinem berühmt-berüchtigten Buch „L´homme machine“ (1748), der Mensch als Maschine, und Autoren wie Paul Henry Thiry d’Holbach (1723 –1789) und Claude Adrien Helvétius (1715 –1771) hervorgetan. Die Lehren dieses Frühmaterialismus waren damals also schon bis zu den Kupferstechern durchgedrungen.
Die Frage nach dem Status der menschlichen Seele
Boswell hat von ihnen übrigens keine gute Meinung; er schreibt:
Boily (…) legt sich des Nachts schlafen und steht des Morgens wieder auf, in der festen Überzeugung, seine Seele sei etwas Stoffliches. Was für ein Armutszeugnis! (BB 35)
Wir werden der Frage, die hier anklingt, der Frage nach dem Status und der Beschaffenheit der menschlichen Seele, bei Boswell immer wieder begegnen. Sie ist so etwas wie der rote Faden seines Reisetagebuchs; insbesondere kommt ihr in den Gesprächen mit Voltaire und Rousseau große Bedeutung zu. Es handelt sich dabei um eine Frage, die nicht nur Boswell persönlich beschäftigt, sondern viele seiner Zeitgenossen ungemein bewegt hat – ein neuralgischer Punkt in den Diskussionen des 18. Jahrhunderts.
Der Begriff der Seele ist in den Diskursen der Aufklärung gleichsam unterwegs von der Metaphysik zur Psychologie. Die Frage lautet: ist die Seele wirklich der unsterbliche Teil des Menschen, wie es die christliche Tradition lehrt? Ist sie eine Art von zweiter Substanz neben der Materie, die letztlich unabhängig vom Körper ist, die ihn überleben und womöglich in alle Ewigkeit dauern kann? Oder ist sie Teil der menschlichen Natur, auf unauflösliche Weise mit dem Körper verknüpft, und als ein solcher Teil der Natur genauso der Erfahrung, der Beobachtung, Analyse und Manipulation zugänglich wie der Körper, genauso geeignet, den Gegenstand einer Erfahrungswissenschaft abzugeben wie er, eben jener Wissenschaft, die man dann Psychologie,
[<< 59]
„Erfahrungsseelenkunde“ nennen wird? 39 Und wenn die Seele so eng mit dem Körper verknüpft ist, wird sie dann womöglich auch mit ihm zusammen vergehen? Bei Boswell kann man sehen, daß diese Fragen seinerzeit keineswegs nur ein esoterisches Thema für Gebildete gewesen sind, sondern auch Kupferstecher schon haben beschäftigen können.
Das Interesse am Individuum im Alltag
In Basel angekommen, stiegen wir in den „Drei Königen“ ab, einem schön gelegenen Gasthof am Rheinufer. Imhof, der Wirt, ist ein sonderbarer Kauz. Er rühmte sein Basel bis in die Puppen; es verdiene, gründlich besichtigt zu werden, sagte er, damit ich meinen Aufenthalt bei ihm ausdehne. Er begleitete uns auf einen Rundgang, wobei er sich des langen und breiten über alles ausließ, was er sah. Wir speisten an der allgemeinen Mittagstafel, wo er sich über die große Zahl der Gäste verbreitete und die berühmten Gelehrten, die schon in seinem Haus gewohnt hatten. „Voltaire war hier“, erzählte er uns. „Er ging gleich zu Bett. Ich fragte den Diener, ob sein Herr etwas zu essen wünsche. ,Ich weiß nicht. Kommt drauf an. Vielleicht; vielleicht auch nicht.‘ Nun, ich ließ eine gute Suppe bereiten und ein Huhn herrichten. Ich bringe ihm die Suppe. Er nimmt sie. Er weist sie zurück. Dann nimmt er sie doch. ,Eine ausgezeichnete Suppe!‘ Ein Gast war eingetroffen, und ich gab ihm die Hälfte des Huhns. Die andere Hälfte bringe ich Voltaire. Er nimmt sie. Er weist sie zurück. Dann nimmt er sie doch. ,Das Huhn ist ausgezeichnet!‘ Es ärgert ihn, daß er nicht ein ganzes bekommen hat. ,Ein halbes Huhn ist gar kein Huhn!‘ Kurz, er war mit meinem Haus zufrieden.“ Das wäre ein Muster eloquentiae Imhoffianae. Ich hatte meinen Spaß an ihm und kam zu dem Schluß, er sei entweder eine grundehrliche Haut oder ein Erzgauner. (BB 30)
Hier zeigt sich zum einen wieder Boswells Interesse am Individuum, an Originalcharakteren, im vorliegenden Fall eben an einem „sonderbaren Kauz“ von Wirt. Boswell hat Charaktere gesammelt wie andere
[<< 60]
Leute Briefmarken. An anderer Stelle nennt er sich selbst auch stolz einen „Physiognomiker“ (BB 96). Die Physiognomik war damals groß in Mode, so wie heute etwa Bücher über Körpersprache und manch andere Form von Nachhilfeunterricht für menschliche Trampeltiere. Physiognomik: unter diesem Titel ging es darum, aus der äußeren Gestalt des Menschen, der Form des Kopfs, den Gesichtszügen, auf den Charakter zu schließen, also aus dem Äußeren auf das Innere, aus dem Körperlichen auf das Seelische. Ein bekannter Vertreter solcher Physiognomie war Johann Kaspar Lavater, der hier schon einmal als Verfasser eines berühmten Tagebuchs genannt worden ist; von ihm stammen auch „Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe“ (1775 –1778), die seinerzeit nicht weniger Aufmerksamkeit erregten.
Über den Begriff des Charakters wird hier noch ausführlich zu reden sein, denn er hat in der Literatur des 18. Jahrhunderts auf besondere Weise Karriere gemacht. Ein markantes Beispiel für das neue Interesse am Charakter sind die „Anmerkungen übers Theater“ (1774) von Reinhold Michael Lenz (1751 –1792); da wird die Darstellung von Charakteren zur wichtigsten Aufgabe des Dramas erklärt. Auch hier ist wieder zu bemerken: hinter derartigen Entwicklungen in der Literatur stehen außerliterarische Interessen, die das soziokulturelle Leben insgesamt prägen.
„Philosophen“ als Gegenstand des öffentlichen Interesses
Und zum andern zeigt die Stelle in Boswells Reisetagebuch, wie groß die Anteilnahme war, die man seinerzeit den Heroen der Aufklärung entgegengebracht hat, allen voran Voltaire und Rousseau. Sie sind auch mit ihrer Person ein Gegenstand des öffentlichen Interesses, man nimmt Anteil an ihrem Schicksal, man erzählt sich Anekdoten und Witze von ihnen, so wie heute von den „VIPs“, von „Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens“. Auch darin manifestiert sich der Einfluß, den sich die neue Schicht der Intellektuellen erobert hat, die ja bewußt über das neue Instrument der Öffentlichkeit zu wirken versucht. Männer wie Voltaire und Rousseau sind Größen des öffentlichen Interesses wie sonst nur Könige und Kriegsherren. Je näher Boswell dem Wohnsitz Voltaires kommt, desto größer wird die Dichte an Voltaire-Anekdoten.
Das Interesse an ihm ist übrigens keineswegs auf die gebildeten Stände beschränkt.
[<< 61]
Ich hörte von einem Steinmetz hier, der für Voltaire gearbeitet hatte. Auch der größte Dummkopf wird sich an irgendeinen Ausspruch eines bedeutsamen Mannes erinnern, den zu sehen er Gelegenheit hatte. Dieser Steinmetz erzählte mir von einem Karrengaul in Ferney, bei dessen Anblick Voltaire immer gesagt habe: „Armer Klepper, du bist fast so dürr wie ich.“ Bei einem solchen Mann hat jede Kleinigkeit ihren Wert. (BB 45)
Zurück nach Basel!
Interesse an Kunstwerken
Ich vertiefte mich in Rousseaus „Glaubensbekenntnis eines Savoyarden“, dessen Klarheit, Einfachheit und Frömmigkeit mich angenehm berührte. Dann sah ich mir den berühmten Totentanz an, der als ein Werk Holbeins galt, da dieser aus Basel stammte; in Wirklichkeit hieß der Maler aber Jean Klauber. Allerdings ist von der ursprünglichen Arbeit nicht mehr viel vorhanden. Ich erstand ein Heft mit Angaben über Bilder und Beschriftung. Man hat den Totentanz in einer überdachten Galerie untergebracht, mit einem Geländer davor. Von Zeit zu Zeit wird es von Lausbuben beworfen und beschädigt. (BB 31)
Boswell besichtigt also die berühmten Kunstwerke vor Ort. Als Gebildeter hatte man damals im allgemeinen eine gewisse Kenntnis der großen Kunstwerke in Europa. Man kannte sie vor allem durch Kupferstiche. Es war üblich, bedeutende Gemälde und Plastiken und die Ansicht berühmter Bauwerke und städtischer Ensembles „abzukupfern“, in Kupferstichen festzuhalten, und diese Stiche wurden dann durch ganz Europa vertrieben. Wer es sich leisten konnte, legte sich eine Sammlung solcher Stiche zu, sei es um sie für sich allein zu betrachten oder um sie bei Gelegenheit seinen Gästen vorzulegen und mit ihnen gemeinsam zu diskutieren. Goethe zum Beispiel hat eine große Sammlung von Kupferstichen besessen, die bis heute erhalten ist. Wenn man als ein solcher „Kenner und Liebhaber“ auf Reisen an einen Ort kam, der ein bekanntes Kunstwerk wie den Basler Totentanz beherbergte, dann hat man es sich natürlich im Original ansehen wollen.
Wir erfahren hier bei Boswell auch, in welchem Maße seinerzeit die Kunstkritik schon in Blüte stand und daß sie damals schon die gleichen Fragen beschäftigten wie heute: wer ist der Autor, wem ist das Kunstwerk zuzuschreiben? Und ist das Ganze wirklich echt? Es
[<< 62]
waren seinerzeit schon so viele Reisende unterwegs, die nach Informationen über ein Kunstwerk wie den Basler Totentanz verlangten, daß es sich offenbar lohnte, einen entsprechenden Führer zu drucken.
Interesse an Anakreon, Anakreontik
Nach dem Totentanz besichtigt Boswell noch das Zeughaus der Stadt, wo alte Waffen ausgestellt sind (BB 31), eine private Gemäldesammlung, das Rathaus, das Münster und schließlich auch die Universitätsbibliothek (BB 33 –34). Hier läßt er sich alte Bücher und Stiche vorlegen; besonders nachdrücklich erkundigt er sich – wie an anderen Orten und in anderen Bibliotheken auch – nach Handschriften von Anakreon; die interessieren ihn besonders.
Anakreon: ein altgriechischer Lyriker des 6. Jahrhunderts v. Chr., der in der Mitte des 18. Jahrhunderts groß in Mode gekommen war. Man liebte Gedichte im Stil Anakreons; aus ihrer Nachahmung ist die sogenannte Anakreontik erwachsen, eine Sonderentwicklung der Lyrik, die ein Gutteil dessen ausmacht, was man später im Rückblick das literarische Rokoko genannt hat. Die Dichtung Anakreons kreist um die Themen Wein, Weib und Gesang; so auch die Anakreontik. In heiterer, unbeschwerter Stimmung werden das Leben und die Liebe, ein Leben in der Natur, Lebensfreude und Genuß gefeiert, im Geist der Philosophie Epikurs, die seinerzeit ebenfalls in Mode gekommen war, nachdem sie bis weit ins 17. Jahrhundert hinein von der christlichen Theologie im wahrsten Sinne des Wortes verteufelt worden war. Epikur hat eine Philosophie formuliert, die als Antwort auf die Grundfrage der griechischen Philosophie, die Frage nach einem glücklichen, gelingenden Dasein, ein Leben nach dem Lustprinzip anempfiehlt, den sogenannten „Hedonismus“. Genauer gesagt, empfiehlt Epikur nur ein maßvolles Genießen; maßvoll soll es sein, damit man sich nicht ruiniert und möglichst lange genießen kann. In Deutschland hat vor allem der Hamburger Autor Friedrich v. Hagedorn eine anakreontische Dichtung in epikuräischer Haltung in Schwung gebracht;40 dem sind dann andere Autoren gefolgt, so z. B. Gleim, der Autor der „Freundschaftlichen Briefe“, Johann Peter Uz (1720 –1796) und Johann Nikolaus Götz (1721 –1781), bis hin zu Lessing und zum jungen
[<< 63]
Goethe, dem Leipziger Goethe. Diesem zeitgenössischen Interesse an Anakreon entspricht es, daß sich Boswell in allen Bibliotheken nach Handschriften und Drucken seiner Werke erkundigt.
Politische Aufklärung im Alltag
Bei diesen Bibliotheksbesuchen macht Boswell eine Beobachtung, die noch ein anderes charakteristisches Interesse der Zeit in den Blick rückt. Damit man sein Zeugnis recht einschätzen kann, muß man sich zunächst klarmachen, daß England zu Beginn des 18. Jahrhunderts in den meisten Belangen des gesellschaftlich-kulturellen Lebens das fortschrittlichste Land in Europa war; nicht umsonst hat die Bewegung der Aufklärung von hier ihren Ausgang genommen. Was die politischen Verhältnisse anbelangt, so hat sich das gehobene Bürgertum in England schon im 17. Jahrhundert eine starke Stellung erobert gehabt, vor allem in Gestalt des Parlaments. Das war ein Prozeß, der mit zwei großen Revolutionen verbunden war, deren eine 1649 schon einen König, Karl I., den Kopf gekostet hatte. Während sich in Kontinentaleuropa die politische Entwicklung in Richtung Absolutismus bewegt hatte – das große Muster war hier Ludwig XIV. von Frankreich, „le roi soleil“, der Sonnenkönig, dem der Satz zugeschrieben wird „l’état, c’est moi“, der Staat bin ich – hatten sich die Verhältnisse in England in Richtung Parlamentarismus, Verfassungsstaat und Gewaltenteilung entwickelt. Damit wurde England zu einem Modell für das aufgeklärte Europa,41 propagiert unter anderem von Voltaire, zum Beispiel in dessen „Englischen Briefen“ von 1733.
Und nun also Boswell:
Ich muß hier einschalten, daß mir in dieser wie auch in allen größeren Bibliotheken, die ich gesehen habe, eine Schenkung von Büchern gezeigt worden ist, die von einem gewissen namenlosen englischen Sonderling stammt, der offenbar ein ausgepichter Freigeist ist, hat er doch seine Sendungen zusammengestellt aus Miltons Prosawerken (die er wohl seinen Dichtungen vorzieht), Tolands Milton-Biographie, Algernon Sidneys Werken und noch mehreren solchen Kosthappen britisch-republikanischen Schrifttums. Die Bücher sind in rotes Saffianleder gebunden und verziert
[<< 64]
mit Jakobinermütze, Heugabeln, Dolchen und anderen Instrumenten des Volkszorns, alles in Prägedruck, hübsch vergoldet. Mich wundert nur, daß er nicht auch noch Schafott, Richtblock und Beil mit draufgenommen hat. Er hätte ein ganzes Bücherbrett mit der Darstellung des Mordes an Karl dem Ersten ausschmücken können. (…) Falls Sidney, Milton und Toland die gute Sache nicht wirksam genug vertreten sollten, hat er noch eigene Fußnoten beigefügt und Zitate von seinesgleichen. (BB 41 –42)
Da gibt es also offenbar einen reichen Engländer, der die politische Aufklärung zu fördern sucht, indem er die Bibliotheken des Kontinents mit republikanischem Schrifttum aus Großbritannien beschenkt. Auch das ist Aufklärung gewesen. Und gerade die Schweiz scheint für solches Schrifttum besonders empfänglich gewesen zu sein. Denn da kann Boswell beobachten:
Die Schweizer sind auf Frankreich nicht mehr gut zu sprechen. Das Volk wird gelehrt, die große Monarchie zu verachten, so daß es nichts Ungewöhnliches ist, wenn „ein Bauer auf seinem klotzigen Berg sagt, der König könne ihn am Arsch lecken“. (BB 37)
Aufklärung und Aberglauben
Ein letztes Beispiel dafür, wie ein Mensch, der „als Philosoph unterwegs“ ist, in die Welt blickt und wie er das, was er da zu sehen bekommt, verarbeitet.
Die Uhren von Basel gehen ungefähr eine Stunde vor, verglichen mit allen anderen Uhren im Land, ja verglichen mit der Sonne selber, nach der sie gerichtet werden. Wenn also ein Fremder um die Mittagszeit von Basel abreist, kann er meilenweit fahren, und wenn er dann nach der Uhr sieht, ist es immer noch Mittag. Verschiedene Gründe werden für diese Eigenheit der Basler Uhren angeführt. Die einen behaupten, es habe einst eine Verschwörung unter den Bürgern gegeben, die zu einer bestimmten Stunde losschlagen wollten, und die Obrigkeit, davon in Kenntnis gesetzt, habe die Uhr eine Stunde vorgestellt, so daß die Aufrührer sich teils zu früh, teils zu spät einfanden und eine heillose Verwirrung entstand. Andere meinen, bei einer Belagerung hätten einst Mißvergnügte zu einer vereinbarten Zeit dem Feind die Tore aufmachen wollen, und nur durch ein Wunder sei die Stadt gerettet worden, indem die Uhr plötzlich eine Stunde vorging. Ein
[<< 65]
solcher Aberglaube ist höchst natürlich. Es erhöht das Selbstgefühl, an ein Eingreifen der Vorsehung zu glauben. Kein geringerer als der berühmte Mathematiker Bernoulli hat sich mit dieser Frage befaßt. Er vermutete, man habe die Uhr des Münsters nach einer ungenauen Sonnenuhr gerichtet und die anderen Uhren seien gefolgt; aber diese Erklärung befriedigt nicht, denn wenn auch die eine Sonnenuhr fehlerhaft gewesen wäre, hätten doch die andern den Fehler berichtigt. Wolleb meinte, höchstwahrscheinlich sei die Uhr während des Basler Konzils vorgestellt worden, damit die kirchlichen Würdenträger eine Stunde früher zusammenkommen konnten, wohl um auf diese Art eine Stunde früher bei ihren Weibern zu sein. Da das Konzil zehn Jahre dauerte, habe sich die abweichende Uhrzeit eingebürgert. Ich fragte, ob denn dieser Mißstand nicht abgestellt werde. Ein gewichtiger Patrizier gab gewichtig zur Antwort, es sei noch kein Jahr her, daß die Frage im Rat behandelt worden sei, und ein Teil der Ratsherren habe gefunden, die Uhr dürfe nicht geändert werden, da der Stadt sonst Unheil drohe. Ist es die Möglichkeit, daß in einem so aufgeklärten Zeitalter sich noch solch finsterer Wahn erhält? (BB 31 –32)
Es ist höchst aufschlußreich, auf welche Weise sich ein aufgeklärter Kopf wie Boswell hier mit dem Phänomen des Aberglaubens auseinandersetzt. Bei der Kritik an abergläubischen Vorstellungen kommt es nicht nur darauf an, den Gegenstand des Aberglaubens rational, mit wissenschaftlichen Mitteln zu erklären, ihn auf „natürliche“ Ursachen zurückzuführen und damit aus der Welt zu schaffen. Es gilt auch zu verstehen, wie es überhaupt zu ihm hat kommen können, und das heißt: seine Entstehung psychologisch aufzuklären, aus der „allgemeinen Menschennatur“ herzuleiten, was hier im Rekurs auf den Trieb der Eigenliebe geschieht: „Ein solcher Aberglaube ist höchst natürlich. Es erhöht das Selbstgefühl, an ein Eingreifen der Vorsehung zu glauben“. Auf die gleiche Weise sucht etwa auch Nathan in den ersten beiden Szenen von Lessings Schauspiel „Nathan der Weise“ dem Aberglauben seiner Tochter Recha, dem Glauben an ihre Rettung durch einen Engel, beizukommen.
Damit nähert sich Boswell dem Höhepunkt seiner Reise durch die Schweiz, den Besuchen bei Voltaire und Rousseau.
[<< 66]