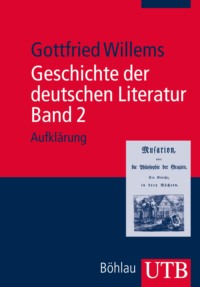Kitabı oku: «Geschichte der deutschen Literatur. Band 2», sayfa 6
2.2 Voltaire, Rousseau und die Entwicklung der Literatur im 18. Jahrhundert
Voltaire und Rousseau als Protagonisten und Kontrahenten der Aufklärung
Boswell hat sich mit dem Gedanken, bei seiner „Grand Tour“ auch Voltaire und Rousseau aufzusuchen, ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Denn die beiden Autoren sind 1764, als Boswell sich zu ihnen aufmacht, die am meisten gelesenen zeitgenössischen Schriftsteller in Europa. Es sind die Helden der Aufklärungsbewegung, die großen Stars, an deren Arbeit und Schicksal eine europaweite Öffentlichkeit Anteil nimmt.
Freilich begegnet man der Aufklärung in ihnen auf verschiedene Weise. Denn es sind zwei durchaus unterschiedliche Autoren, verschieden nach Herkunft, Naturell, Temperament, Bildungs- und Lebensgang, und von daher dann auch in dem verschieden, was sie denken und schreiben. Diese Unterschiede haben sie schließlich in öffentliche Kontroversen hineingetrieben, mit allerlei bösen Polemiken, denen ein Widerhall in Europa gewiß war. Gerade als Boswell zu ihnen aufbricht, nähert sich der Konflikt seinem Höhepunkt, so daß er seine Müh und Not hat, sich zwischen den beiden zurechtzufinden. Es war das Schicksal von Voltaire und Rousseau, daß eben die Stärken des einen die Schwächen des anderen waren, so daß sie schließlich dahin gekommen sind, einander wechselseitig ihre Mängel vorzurechnen und diese vor die Öffentlichkeit zu zerren. Mit dem Phänomen des modernen Intellektuellen erblickt eben zugleich auch das Intellektuellengezänk das Licht der Welt.
So stehen Voltaire und Rousseau in unseren Augen für zwei verschiedene Möglichkeiten von Aufklärung ein, auch für zwei verschiedene Entwicklungsphasen der Aufklärung, denn Rousseau gehört ja schon einer anderen, jüngeren Generation an als Voltaire, einer Generation, der vieles schon selbstverständlich geworden ist, wofür ein Voltaire noch hat kämpfen müssen. Immerhin, wenn man die beiden Autoren zusammennimmt, bekommt man ein recht umfassendes Bild von den Bestrebungen der Aufklärung in der Mitte des 18. Jahrhunderts.
[<< 67]
2.2.1 Voltaire und der Weg zur Autonomie der Literatur
Voltaire als Muster des „freien Schriftstellers“
Voltaire 42 war 1764 schon längst eine Institution geworden. Er ist 1694 geboren, war damals also schon 70 Jahre alt, hatte bereits seit 50 Jahren publiziert – und zwar ununterbrochen publiziert – publizierte immer noch und würde weiter publizieren bis zu seinem Tod 1778. Die Geschichte Voltaires war seinerzeit bereits Legende, und in gewisser Weise ist sie es bis heute. Voltaire figuriert im kulturellen Gedächtnis als der Aufklärungsschriftsteller schlechthin, und damit zugleich als Prototyp des modernen Intellektuellen, vor allem aus zwei Gründen.
Zum einen hat Voltaire ein Werk geschaffen, das fast die gesamte Themenpalette der Aufklärung abdeckt. Was immer das aufgeklärte Europa interessierte – Voltaire hatte schon etwas dazu gesagt. Und zum andern ist Voltaire das erste große, weithin sichtbare Beispiel für die autonome Schriftstellerexistenz, für den sowohl institutionell unabhängigen als auch weltanschaulich autarken modernen Autor, wie er sich durch nichts als diese seine Autarkie legitimiert, allein durch sie für sein Publikum interessant und glaubwürdig zu werden sucht. Voltaire ist zwar keineswegs der erste gewesen, der vom Schreiben hat leben können, aber er ist das erste große Beispiel dafür, daß man durch den Erfolg und Ertrag des Schreibens unabhängig werden kann. Er ist zumindest derjenige Autor, an dem das neue Phänomen der unabhängigen Schriftstellerexistenz erstmals öffentlich wahrgenommen und diskutiert und so einem breiteren Publikum bewußt geworden ist.
Was man an Voltaire sah, war, daß da einer schreiben und veröffentlichen konnte, was immer er für wichtig und richtig hielt, wenn vielfach auch nur mit List und Tücke. Denn es gab ja weithin noch immer eine Zensur, die irgendwie umgangen werden mußte; und es gab allerlei geistliche und weltliche Autoritäten, die schnell beleidigt waren und dann zu Mitteln der Repression griffen. Eben um ihnen ein- für allemal zu entgehen, hatte sich Voltaire in der Schweiz angesiedelt. Und so konnte man nun an ihm beobachten: was einem Autor den Erfolg beim Publikum bringt, ist, daß er schreibt, was ihm persönlich wichtig ist und was er persönlich für richtig hält, weil ihn allein dies
[<< 68]
bei seinen Lesern glaubwürdig macht. Der Erfolg beim Lesepublikum wiederum verschafft ihm Unabhängigkeit, gibt ihm die Möglichkeit zu schreiben, was er will. Unabhängigkeit durch öffentliche Wirkung, öffentliche Wirkung durch Unabhängigkeit – eben dieser Regelkreis setzt sich erstmals in einer weithin sichtbaren Weise mit dem Phänomen Voltaire in Bewegung
Autorschaft in der frühen Neuzeit: institutionelle und dogmatische Bindungen
Sicherlich haben auch vor Voltaire schon einige Autoren vom Schreiben leben können. In Deutschland etwa gab es schon im 17. Jahrhundert im Umkreis der großen Nürnberger Buchdrucker einige Autoren von populärem Lesefutter, die vom Schreiben, von den Honoraren für ihre Publikationen lebten – mehr schlecht als recht, denn reich konnte man dabei nicht werden. Das Gros der Autoren, auch der bekannten Autoren, hatte aber einen Beruf als Basis der materiellen Existenz, ein kirchliches Amt, ein Amt bei Hofe, ein städtisches Amt oder eine Professur an einer Universität oder einem Gymnasium, und schrieb nur nebenher. Wer besonders großes Glück hatte, bekam irgendwann eine fürstliche Pension, eine Art Ehren-Gehalt, das ihn finanziell unabhängig machte. Das gilt weithin auch noch für das 18. Jahrhundert, bis hin zu Goethe, der zwar durchaus schon vom Schreiben hätte leben können, der es aber vorzog, seine Existenz durch ein Amt am Weimarer Hof abzusichern.
Natürlich bedeutete die berufliche Bindung an eine Institution – an die Kirche, den Hof, an bestimmte Stände, die Stadt, die Universität – daß man nicht völlig frei war in dem, was man schrieb, daß man auf die weltanschaulichen, ideologischen Grundlagen dieser Institutionen Rücksicht nehmen mußte. Die institutionelle Bindung ging mit einer normativ-dogmatischen Bindung einher. Das war allerdings solange kein Problem, als die Autoren keinen Anstoß an den betreffenden Dogmen und Normen nahmen, als sie selbst kirchlich fromm waren, selbst an die Prinzipien der Monarchie und der ständischen Ordnung glaubten, selbst der universitären Gelehrsamkeit verpflichtet waren, und das galt bis ins 18. Jahrhundert hinein für die meisten von ihnen.
Nun finden sich zwar schon im 16. und 17. Jahrhundert einige spektakuläre Beispiele dafür, daß einzelne Wissenschaftler und Literaten durch ihre Schriften in Konflikt mit den geistlichen und weltlichen Autoritäten gerieten, prominente Fälle wie die von Galileo Galilei und Torquato Tasso, deren Gedächtnis nicht zuletzt durch die Dramen von
[<< 69]
Brecht und Goethe bewahrt worden ist. Aber diese Konflikte endeten im allgemeinen damit, daß die Autoren zu Kreuze krochen und widerriefen, sich den Autoritäten unterwarfen. Auch wenn sie den einen oder anderen potenten Fürsprecher haben mochten, konnten sie sich mit ihrem eigenen Standpunkt letztlich doch nicht behaupten – warum? Weil eine Öffentlichkeit fehlte, wie wir sie kennen, die ihnen den Rücken hätte stärken können.
Autorschaft im Jahrhundert der Aufklärung
Konflikte mit den Autoritäten, wie Galilei und Tasso sie provozierten, waren in der frühen Neuzeit allerdings Einzelfälle. Erst im 18. Jahrhundert werden solche Konflikte zum Problem ganzer Generationen von Schriftstellern, erst jetzt, in der Zeit der Aufklärung und infolge der Aufklärung, wo das Denken und Schreiben gleichbedeutend wird mit der Emanzipation von der Autorität der Tradition, mit der Überprüfung jedweden überlieferten Dogmas, jedweder altehrwürdigen Norm in der Erfahrung. Hier wird die Emanzipation von den Institutionen der Kirche, des Hofs, der Stände, der Universität zu einer unabdingbaren Voraussetzung für die Autorschaft; um die normativ-dogmatische Bindung abschütteln zu können, muß man die institutionelle Bindung loswerden. Hier erst haben deshalb die Autoren begonnen, den Weg in eine autonome Schriftstellerexistenz zu suchen, und einige wenige haben ihn dann in der Tat auch gefunden, allen voran Voltaire.
Allerdings wurde ein solcher Weg auch hier nur möglich, weil das Buch- und Zeitschriftenwesen nun erst die Formen annahm, die wir als moderne Öffentlichkeit bezeichnen. Die Voraussetzung dafür war, daß im 18. Jahrhundert immer mehr Menschen, immer breitere Schichten der Gesellschaft lesen konnten und über die Mittel verfügten, um sich Bücher und Zeitschriften zu leisten. Das 18. Jahrhundert ist die Zeit einer sich ständig beschleunigenden Alphabetisierung der Massen. Für Frankreich will man herausgefunden haben, daß um 1700 allenfalls ein Viertel, um 1800 hingegen schon die Hälfte der erwachsenen Männer lesen konnte43 – eine Verdoppelung des Anteils der Leserschaft an der
[<< 70]
Bevölkerung. In Deutschland dürfte es ähnlich gewesen sein. Der Hintergrund war hier die Einführung der allgemeinen Schulpflicht durch die aufgeklärten Fürstenstaaten.
Und was das Geld anbelangt, und damit die Möglichkeit, sich Bücher und Zeitschriften zu kaufen, so ist das 18. Jahrhundert die Zeit eines kontinuierlichen wirtschaftlichen Wachstums und einer kontinuierlichen Intensivierung der Geldwirtschaft gewesen. In Frankreich z. B. soll die landwirtschaftliche Produktion im 18. Jahrhundert um 50 % zugenommen haben, die Produktion der verarbeitenden Gewerbe um 100 % und das Handelsvolumen gar um 400 %,44 was nichts anderes bedeutet, als daß die Menschen nun Geld in die Finger bekamen, Geld, das sie eben auch für Bücher und Zeitschriften ausgeben konnten. So daß der Buch- und Zeitschriftenmarkt nun in eine Dimension hineinwachsen konnte, die es Autoren ermöglichte, vom Absatz ihrer Schriften zu leben, ökonomisch von institutionellen Bindungen unabhängig zu werden.45
Voltaire entdeckt Öffentlichkeit und Buchmarkt
Voltaire ist einer der ersten gewesen, der sich diese Zusammenhänge systematisch klarmachte, der erkannte, daß das literarische Leben damit auf eine neue Grundlage gestellt wurde, und der daraus für sich die Konsequenzen zog. So gibt es z. B. in den „Englischen Briefen“ ein Kapitel – den 23. Brief, überschrieben „Von der Hochachtung, welche man den Gelehrten schuldig ist“ – in dem er die soziale, ökonomische und politische Stellung von Wissenschaftlern und Literaten ausführlich reflektiert. Was Voltaires zeitgenössischer deutscher Übersetzer mit dem Begriff „Hochachtung“ auf eine etwas altmodisch und unbeholfen wirkende Weise umschreibt, würden wir wohl öffentliche Aufmerksamkeit nennen und als Zeichen der allmählich sich formierenden modernen Öffentlichkeit bewerten; die Sache ist so neu, daß Voltaire und seinen Übersetzern noch die adäquaten Begriffe fehlen.
[<< 71]
Man trifft weder in England noch in irgendeinem anderen Lande so für die schönen Künste zuträgliche Einrichtungen an wie in Frankreich. Man hat fast überall Universitäten, nur in Frankreich findet man diese nützlichen Ermunterungen zur Sternenkunde, zu allen Teilen der Mathematik, zu allen Teilen der Medizin, zu den Untersuchungen der Altertümer, zur Mal- und Bildhauerkunst und zur Baukunst. Ludwig der Vierzehnte hat durch alle diese Stiftungen sein Andenken verewigt, und diese Unsterblichkeit kostete ihn jährlich keine zweihunderttausend Franken.
Ich gestehe, dieses ist eines von denjenigen Dingen, welche in mir die größte Verwunderung hervorrufen, daß nämlich das Parlament in England, welches beschlossen hat, demjenigen, der die unmögliche Entdeckung, die geographischen Längen zu messen, zustande bringt, zwanzigtausend Guineen zu versprechen, niemals darauf verfallen ist, Ludwig den Vierzehnten in seiner Freigebigkeit gegenüber den Künsten nachzuahmen. Dennoch finden die Verdienste bei den Engländern andere und für die Nation rühmlichere Belohnungen, so die Hochachtung, welche das Volk für die natürlichen Talente hat, so daß ein Mensch, der sich Verdienste erwirbt, daselbst auch immer sein Glück macht. Herr Addison hätte in Frankreich das Mitglied einer Akademie werden und durch das Vorsprechen einiger Frauenpersonen ein jährliches Gehalt von tausendzweihundert Livres erhalten können; er hätte aber auch sehr leicht unter dem Vorwand, in seinem Trauerspiel „Cato“ einige Anzüglichkeiten wider den Türhüter eines angesehenen Mannes mit einfließen gelassen zu haben, in die Bastille gesetzt werden können. In England war er Staatssekretär. (…) Wenn die Religion des Herrn Pope es nicht erlaubt, eine gebührende Stellung einzunehmen, so verwehrt sie ihm auch nicht, daß ihm seine schöne Übersetzung des Homer zweihunderttausend Livres eingetragen hat. In Frankreich habe ich lange Zeit den Verfasser des „Rhadamist“ fast Hungers sterben sehen (…). Was aber in England die Männer der schönen Wissenschaften am meisten befördert, ist die Hochachtung, die man vor ihnen hat: das Bildnis des Ersten Ministers befindet sich über dem Kamin seines Kabinetts, aber das des Herrn Pope habe ich wohl in zwanzig Häusern gesehen. (VB 110 –112)
Zweihunderttausend Livres für eine Übersetzung Homers – ein Voltaire ließ sich das nicht zweimal sagen; er wußte, was er zu tun hatte, und er ist als Autor ein reicher Mann geworden, Besitzer mehrerer Landgüter, unter anderem des Landguts Ferney am Genfer See, wo ihn
[<< 72]
Boswell besuchte, und Inhaber einer Fabrik für Schweizer Uhren, die ihre Produkte bis nach Rußland vertrieb. Voltaire ist auch einer der ersten gewesen, die sich für das Urheberrecht eingesetzt und so etwas wie Urheberrechtsprozesse geführt haben. Natürlich gab es seinerzeit noch kein modernes Urheberrecht, die Werke der Autoren waren noch nicht gegen unberechtigte Nachdrucke, sogenannte „Raubdrucke“ geschützt, bei denen für sie kein Honorar abfiel. Dagegen hat sich Voltaire als einer der ersten zu wehren versucht, nicht ganz ohne Erfolg. Wenn man vom Schreiben leben will, sind Raubdrucke, für die man nichts bekommt, eine existentielle Gefahr.
Die Kritiker Voltaires – und Voltaire hatte viele Kritiker, oft genug bösartige Kritiker, vor allem aus kirchlichen Kreisen, die ihm alles mögliche andichteten und aus ihm geradezu eine Art Teufel machten – haben ihn deshalb als geldgierig und geizig verunglimpft. Was Boswell zu berichten hat, ist etwas ganz anderes; da erlebt man einen äußerst großzügigen Gastgeber, der auf seinem Landgut ein ganzes Sortiment von Sozialfällen mit durchfüttert – von geiziger Enge keine Spur. Man muß sehen, daß Voltaire die Erfahrung gemacht hatte, daß es ohne finanzielle Unabhängigkeit auch mit der geistigen Unabhängigkeit, mit der Fähigkeit zu schreiben, was man will und für richtig hält, nicht weit her war; deshalb mußte ihm der Schutz geistigen Eigentums ein Anliegen sein.
Autonomie durch Kapitalismus
Am Beispiel Voltaires wird deutlich, daß jene Autonomie, ohne die die moderne Kunst nicht zu denken ist, die institutionelle und dogmatische Autonomie, ein Kind des modernen kapitalistischen Wirtschaftens ist wie so manches andere auch in der Moderne. Es ist der Kapitalismus, der den Autoren mit dem modernen Buchmarkt die Möglichkeit zu einem Schreiben gibt, das sich von den geistlichen und weltlichen Autoritäten löst und sich nicht mehr von vorgegebenen Dogmen und Normen, sondern allein von der ureigensten Wahrheitssuche des Autors her legitimiert; das ist es ja, was mit Autonomie gemeint ist. Und ohne solche Autonomie hätte es keine Aufklärung geben können, wie sie die eigene Erfahrung zu einer Quelle der Wahrheit macht.
Die Anfänge Voltaires
Voltaire als Prototyp des modernen, institutionell autarken und weltanschaulich autonomen Schriftstellers. In diesem Sinne ist der Weg Voltaires schon zu seinen Lebzeiten Legende geworden. Denn der Weg in die autarke Schriftstellerexistenz war für ihn wie für alle
[<< 73]
seine zeitgenössischen Kollegen ein beschwerlicher Weg, ein Weg voller Hindernisse und Gefahren. Daß er die Widerstände hat meistern können, und wie er sie gemeistert hat, hat ihn für seine Zeitgenossen zu einer Art Helden der Aufklärung, ihrer Literatur und des kulturellen Lebens überhaupt gemacht.
Es war ein Weg der Emanzipation von eben den Autoritäten und Institutionen, die zuvor die Kultur zugleich getragen und an sich gebunden hatten, von der Kirche, den Höfen, den ständischen Autoritäten und den Universitäten. Die ersten Jahre des Schriftstellers Voltaire sind zunächst geprägt von der engen Bindung an den französischen Königshof und an adlige Mäzene. Allerdings haben diese Bindungen sehr schnell und dann immer wieder zu Konflikten geführt die erst an ihr Ende kamen, als Voltaire sich ökonomisch völlig auf eigene Füße gestellt hatte. Ganz am Anfang gibt es sogar eine Bindung an die Kirche; Voltaire hat nämlich seine Schulbildung in einem Pariser Jesuiten-Gymnasium erhalten. Er stammte ja aus Paris; er war der Sohn eines Pariser Notars, also von gutbürgerlicher Abkunft. Er hieß eigentlich François-Marie Arouet, Voltaire ist sein literarisches Pseudonym, sein Künstlername.
Die ersten Schritte als Autor sind nun eben durch geistliche und adlige Mäzene ermöglicht worden, durch den Großprior von Frankreich und den Herzog von Sully. Das waren allerdings schon recht aufgeklärte Herren. Es gibt ja damals in Frankreich den Typus des aufgeklärten Prälaten und des aufgeklärten großen Herrn. Deren Aufgeklärtheit hatte freilich vielfach dort ihre Grenze, wo die Grundlagen ihrer gesellschaftlichen Stellung in den Blick kamen; das hat Voltaire immer wieder schmerzlich erfahren müssen.
Ein Profil der Frühaufklärung
Einer dieser aufgeklärten Geistlichen wird übrigens von Boswell ausführlich porträtiert, der Abbé de Saint-Pierre (1658 –1743), ein Wegbereiter des modernen Menschenrechts-Diskurses und als solcher wichtig auch für Rousseau als Denker des Naturrechts. Das Bild, das Boswell von ihm zeichnet, mag hier als ein typisches Profil der Frühaufklärung stehen. Für Boswell ist es vor allem ein weiteres kostbares Stück in seiner Sammlung von Originalcharakteren.
(Rousseau) gab mir eine Beschreibung des Abbé de Saint-Pierre: „Ein Mann, der Gutes tat, weil er nun einmal Gutes tun wollte – nicht aus
[<< 74]
Schwärmerei. Man könnte sagen, er sei leidenschaftlich vernünftig gewesen. Zu einer Besprechung kam er immer wohlversehen mit Notizen und pflegte zu sagen: ,Für dieses werde ich Hohn und für das Spott ernten.‘ Es war ihm ganz einerlei. Alles, bis zur lächerlichsten Lappalie, mußte bei ihm durchdacht sein. So trug er zum Beispiel seine Uhr an einem Rockknopf aufgehängt, weil das bequemer sei. Da ihm die Ehe verschlossen war, hielt er sich Buhlweiber und machte keinen Hehl daraus. Er hatte mehrere Söhne, die nur einen streng nützlichen Beruf ergreifen durften: so gestattete er es keinem, Perückenmacher zu werden. ,Solange nämlich die Natur uns mit Haar versorgt‘, meinte er, ,bleibt die Perückenmacherei etwas höchst Unsicheres‘. An die Meinung der Leute kehrte er sich gar nicht, er behauptete, sie seien doch nur übergroß geratene Kinder. Nachdem er einen Besuch bei einer Dame lang ausgedehnt hatte, sagte er zu ihr: ,Gnädige Frau, ich sehe, ich falle Ihnen beschwerlich, aber das ist für mich unwesentlich: Ich finde Sie unterhaltsam.‘ Eine der Kreaturen Ludwigs XIV. veranlaßte, daß er aus der Akademie ausgestoßen wurde, einer Rede wegen, die er dort gehalten hatte. Trotzdem war er ständig bei dem Mann auf Besuch. ,Er hat nur seinen eigenen Vorteil wahrgenommen‘, meinte er, ,das kann ich ihm nicht verübeln. Ich finde ihn unterhaltsam. Er hat keinen Grund, mir etwas nachzutragen. Ich hätte ihm etwas nachzutragen, aber ich bin nicht nachträgerisch.‘ Kurz, er machte dem betreffenden Mitglied der Akademie weiterhin seine Besuche, bis dieser dem ein Ende setzte, weil es ihm peinlich war, einen Mann bei sich begrüßen zu müssen, den er geschädigt hatte. Er war ein kluger Kopf, schrieb aber schlecht: langatmig und unklar, wenn er gleich den Beweis für seine Behauptungen nie schuldig blieb. Er ging seinen eigenen Weg und verschaffte sich Ansehen.“ (BB 60 –61)
Voltaire als „Hofkünstler“
Zurück zu Voltaire! Seine ersten Jahre als Autor sind, wie angedeutet, durch eine enge Bindung an den französischen Königshof und zu einigen großen adligen Mäzenen gekennzeichnet; er beginnt mithin als eine Art „Hofkünstler“, wie ihn der Kunsthistoriker Martin Warnke beschrieben hat.46 Demgemäß ist er wie so viele andere Künstler der
[<< 75]
Zeit ein Spielball zwischen den verschiedenen Kräften bei Hofe, ist er einem ständigen Wechselbad von Förderung und Unterdrückung ausgesetzt. Wegen einiger satirischer Gedichte, die selbst den Regenten Philipp von Orléans nicht verschonen (solange der König Ludwig XV. minderjährig war, wurde Frankreich von dessen Vormund, eben jenem Herzog von Orléans, regiert), wird er 1716 zunächst aus Paris verbannt und 1717 in der Bastille eingesperrt, aber das Drama, mit dessen Abfassung er sich in der Gefangenschaft die Zeit vertreibt, dem „Oedipe“ (Ödipus), wird dann doch bei Hofe zur Aufführung gebracht, wird da sogar zu einem großen Erfolg, mit dem Ergebnis, daß Voltaire aus der Haft entlassen und rehabilitiert wird.
Nach der Aufführung des „Ödipus“ soll er zu dem Regenten gesagt haben: „Monseigneur, ich bin ungemein dankbar, daß Eure königliche Hoheit für meine Kost sorgen. Aber ich flehe Eure königliche Hoheit an, sich um mein Logis nicht mehr bekümmern zu wollen“ (VB 120 –121). Das ist eben die Art von geistreich-subversivem Witz, die mit dem Namen Voltaires verbunden wird. Man muß sich die Situation klarmachen: Voltaire steht vor dem Fürsten, der ihn wieder ins Gefängnis bringen kann, es geht um Kopf und Kragen, und da stellt er nun mit einem solchen witzigen Einfall seine Geistesgegenwart unter Beweis. Ein geistreicher Witz, der einerseits der höfischen Form Genüge tut – denn bei Hofe kann man nicht einfach sagen: mein lieber Philipp, wenn Du Dir schon mit meinen Dramen eine angenehme Zeit machst, dann laß mich wenigstens frei herumlaufen; jede Adresse an den Monarchen muß in irgendeiner Form Ergebenheit zum Ausdruck bringen, und dem trägt Voltaire Rechnung, indem er von Dankbarkeit spricht – ein Witzwort, das andererseits aber eben mit den höfischen Gesten des dankbaren Untertanen auf geistreiche Weise sein Spiel treibt und das insofern, mit einer solchen Demonstration geistiger Überlegenheit inmitten einer Zwangslage, durchaus etwas Subversives hat, nach dem Motto: Du magst zwar die Macht haben, aber ich habe den Geist, und der läßt sich nicht so leicht kleinkriegen.
Voltaire im Konflikt mit den Standesgrenzen
Voltaire erreicht zunächst sein Ziel, er kommt frei, aber nach einer Phase großer Erfolge bei Hofe – so wird ein Drama Voltaires 1725 bei der Hochzeit Ludwigs XV. zur Aufführung gebracht, mit einem Erfolg, der ihm eine königliche Pension einbringt – kommt es erneut
[<< 76]
zum Konflikt. Wiederum hat der Konflikt die Gestalt einer berühmten Anekdote angenommen, wie sich das bei einer Vita gehört, die Legende geworden ist. Eines Abends wird Voltaire in der Pariser Oper von einem Sproß der altadligen Familie Rohan vor allen Leuten mit der Frage provoziert, wie er wirklich heiße, de Voltaire oder Arouet, will sagen: sind Sie nicht von bürgerlicher Abkunft? Wie können Sie es dann wagen, unter dem Namen de Voltaire zu publizieren? Darauf entgegnet Voltaire: „Mein Name beginnt mit mir, der Ihre endet mit Ihnen“ (VB 121). Das heißt: Sie sind ja bloß der Erbe eines großen Namens, und zwar einer von der unwürdigen Sorte, ich hingegen bin in der Lage, mir mit meinen persönlichen Leistungen selbst einen Namen zu machen.
Das ist nun eine der Geschichten, bei denen in der Tat einmal die Konfliktpotentiale greifbar werden, die sich im 18. Jahrhundert im Verhältnis zwischen den Ständen zusammenbrauen. Adliges Selbstbewußtsein prallt auf bürgerliches Selbstbewußtsein; ein Selbstbewußtsein, das sich auf die Herkunft, auf das blaue Blut, also auf die Autorität der Tradition gründet, gerät mit einem Selbstbewußtsein aneinander, das sich mit persönlicher Leistung und innovativer Kraft rechtfertigt.
Und die Geschichte geht weiter. Der Chevalier von Rohan ist beleidigt und läßt Voltaire vor dem Haus seines Gönners, des Herzogs von Sully, auflauern und verprügeln. Und nun kommt die Stunde der Wahrheit: Voltaire beschwert sich bei Sully, aber der will durchaus nichts für ihn tun – die Solidarität des Adels geht über das mäzenatische Verhältnis zu Voltaire. Voltaire rast, er will sich mit dem Chevalier duellieren, aber ein Rohan lehnt es natürlich ab, sich mit einem Arouet zu schlagen. Am Ende landet Voltaire wieder in der Bastille, und nach der Entlassung geht er nach England ins Exil (VB 121 –122).
Die literarische Frucht dieses Exils sind die schon mehrfach berührten „Lettres philosophiques ou Lettres anglaises (1734), die „Philosophischen Briefe“ oder „Englischen Briefe“, in denen er die französischen Verhältnisse von den englischen Verhältnissen aus kritisiert. Damit geht der Konflikt in eine neue Runde. Die „Briefe“ werden von der Zensur verboten, und das bedeutet: sie werden in aller Öffentlichkeit vom Henker von Paris verbrannt. Voltaire, der inzwischen wieder in Frankreich ist, entzieht sich dem damit verbundenen Haftbefehl erneut durch Flucht. Und so geht es nun immer weiter. 1745 bekommt
[<< 77]
Voltaire wieder ein Amt bei Hofe, er wird Historiograph des Königs, 1747 muß er schon wieder fliehen.
Die Höfe und ihre Künstler
Für uns heute ist es gar nicht so leicht, eine Haltung wie die des französischen Hofs nachzuvollziehen, der einen Voltaire abwechselnd heranzieht und verjagt, fördert und verstößt. Wie ist das zu erklären? Wahrscheinlich damit, daß die Höfe Männer wie Voltaire nicht ganz für voll genommen, Konflikte wie die mit Voltaire nicht wirklich ernstgenommen haben. Wenn er sich benahm, war er willkommen, weil er den Hof unterhielt und schmückte, wenn nicht, wurde er geduckt, wurde an ihm demonstriert, wie man Unbotmäßigkeit zu traktieren wußte. Im Grunde behandelten die Höfe Künstler im 18. Jahrhundert noch immer als Domestiken.
Ein gutes Beispiel dafür ist Joseph Haydn, der Komponist der Wiener Klassik, der Hofkapellmeister beim Fürsten Esterhazy in Ungarn war. Haydn soll die meiste Zeit seines Lebens in der Livree der Bedienten der Esterhazy herumgelaufen sein. Bekannt ist auch die Geschichte, wie der junge Mozart von einem Beamten des Salzburger Hofs, bei dem er eine zeitlang in Diensten stand, mit einem Fußtritt vor die Tür befördert wurde, als er mal wieder nicht so wollte, wie es von ihm erwartet wurde. An der Tafel rangierte er als Hoforganist zwischen Kammerdienern und Köchen.47 Natürlich war man sich bei Hofe des Werts solcher Männer durchaus bewußt. Aber man hielt sie sich so wie teure Rennpferde, an denen man seinen Spaß hat und mit denen man Eindruck schinden kann. Man ging schon pfleglich mit ihnen um, aber natürlich nicht von gleich zu gleich.
Im Fall von Voltaire war das freilich eine krasse und fatale Fehleinschätzung. Denn letztlich hat kaum jemand mehr für die Unterhöhlung der Fundamente des Ancien régime getan als Voltaire. Er war der Ausgangs- und Bezugspunkt für viele der kritischen Köpfe, die geistig an der Wiege der Französischen Revolution standen. Eine solche Entwicklung konnte man sich offenbar damals bei Hofe durchaus nicht vorstellen, obwohl in England schon einmal ein König, Karl I., auf dem Schafott geendet war. Und so hat man Voltaire eben in der geschilderten Weise behandelt.
[<< 78]
Voltaire und Friedrich II.
Mit Friedrich II. von Preußen ist es Voltaire übrigens nicht viel besser gegangen als mit dem französischen Hof. Friedrich war ein großer Verehrer Voltaires und hat ihn 1750, nach einem der vielen Konflikte in Frankreich, zu sich nach Berlin bzw. nach Potsdam geholt. Aber auch das ging auf die Dauer nicht gut. In die Berliner Querelen war übrigens auch der junge Lessing verstrickt. Lessing hat Manuskripte Voltaires ins Deutsche übersetzt, und Voltaire hat ihn verdächtigt, er wolle hinter seinem Rücken Geld damit machen – also wieder das Urheberrechts-Problem. Das preußische Abenteuer endete 1753 für Voltaire damit, daß er von Agenten Friedrichs in Frankfurt am Main festgesetzt wurde.
Voltaire in Ferney
All diesen Problemen ist Voltaire erst entkommen, als er sich 1758 das Gut Ferney in der Schweiz kaufen kann. Da ist er endlich sein eigener Herr, kann schreiben und publizieren, was er für richtig hält, ohne daß ihm jemand dazwischenfährt, und kann überhaupt machen, was er will. Er hat dann immer wieder von außen publizistisch in die öffentlichen Angelegenheiten Frankreichs eingegriffen, mit großer Wirkung. Gedruckt wurden seine Schriften meistens in Holland, und dann nach Frankreich eingeschmuggelt, was bei dem damaligen Grenzregime nicht allzu schwierig war.
Deutsche Autoren auf der Suche nach Autonomie
So viel zum Weg Voltaires in die autarke Existenz des modernen Schriftstellers, wie er schon für die Zeitgenossen zur Legende wurde, und als Legende zum Vorbild für die aufgeklärten Autoren in Europa. In ihm erblickte man das Modell für das, was man heute einen freien Schriftsteller nennt. Auch in Deutschland haben viele versucht, einen solchen Weg zu gehen, aber meist ohne Erfolg; die Verhältnisse waren noch nicht danach. So hat sich z. B. Lessing als freier Autor auf die Dauer nicht halten können und ist am Ende wieder in fürstliche Dienste getreten, als Bibliothekar des Herzogs Karl von Braunschweig-Wolfenbüttel, mit dem Ergebnis, daß auch er neuerliche Einschränkungen beim Publizieren hinnehmen mußte. Und so ähnlich erging es den meisten. Bodmer, Breitinger, Gottsched, Haller, Gellert lebten von ihren Professorengehältern, waren institutionell also an Universitäten und Gymnasien gebunden. Wieland war erst Chef der Stadtverwaltung seiner Heimatstadt Biberach, dann kurze Zeit Professor in Erfurt, dann Prinzenerzieher in Weimar, und erst danach war er dank einer fürstlichen Pension und der Einkünfte aus der Zeitschrift
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.