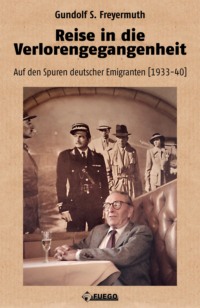Kitabı oku: «Reise in die Verlorengegangenheit», sayfa 4
8
Bildungsreise • Die Flucht aus Deutschland, quer durch die Alte und in die Neue Welt - das war doch keine Bildungsreise! Was denn? Bürgerliche Bildungsreisen führten nicht in exotische Gebiete; darin blieben sie der adligen Kavalierstour gleich,78 von deren Nachahmung sie ausgingen. Neues zu erforschen, war den staatlich geförderten Eroberungs- und Entdeckungsfahrten reserviert, mit denen sich Europa den Rest der Welt unterwarf. Auf der Bildungsreise hingegen, wie sie im deutschen Sprachraum während des 18. Jahrhunderts zur Institution wurde, sollte vom jugendlichen Individuum lange Bekanntes »erfahren« werden: Italien oder weitestenfalls Griechenland. Und auch in diesen Zielländern galt das Interesse kaum dem, was sie vom Herkunftsland unterschied, dem Volksleben und der Folklore. Die Ablenkung vom eigenen Alltag, die als Motiv hinter dem Massentourismus von heute steht, vermerkte das Konzept der Bildungsreise - gewiss nicht selten im Gegensatz zu ihrem realen Verlauf - als unerwünschte Begleiterscheinung.
Die weitgehende Missachtung, die der lokalen Gegenwart der besuchten Gebiete entgegengebracht wurde, bedeutete jedoch keineswegs, dass die Bildungsreisenden archäologische Studienfahrten angetreten hätten. Ihr Interesse war nur begrenzt historisch. Vorrangig sollte nicht einem Mangel an geschichtlichem Wissen, sondern einem höchst aktuellen Bedürfnis nach Orientierung abgeholfen werden.
Die Reisenden, Pilger eines aufgeklärten Kultes, beziehungsweise ihre zahlenden Eltern erhofften nicht allein den Zuwachs an Kenntnissen. Angestrebt war eine Art weltlicher Erleuchtung, eine drastische Vollendung der bürgerlichen Persönlichkeit.79 Die Wallfahrt zu den steinernen Überresten der Antike beabsichtigte das Nach-Erlebnis von Bildung. Idealiter strebte man ein besseres Verständnis der eigenen Standards an. Einer Initiation gleich, sollte die Bildungsreise die Einpassung des Nachwuchses in die gesellschaftlichen Verhältnisse vollenden. An ihrem Ziel wurden daher die historischen Orte jener Kultur aufgesucht, als deren legitime Nachfahren sich die Bürger wähnten und in deren Tradition sie die Nachkommen einführen wollten. Die Ruinen der vergangenen Epoche dienten lediglich als Kulisse, in der die gewünschte Vergegenwärtigung klassischer Kultur stattfinden konnte - wie man diese selbst für den geistigen Hintergrund nahm, vor dem sich das Drama der Gegenwart abspielte. Das Konzept der Bildungsreise zielte so letztlich weniger auf die Überwindung einer räumlichen als einer zeitlichen Entfernung. Das Moment der Rückübersetzung, der Regression auf eine aufklärerisch bereits überwundene Raum-Zeit-Konstellation, ist darin zu erkennen. »Mühselig und widerruflich«, schreiben Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in ihrer Interpretation der frühesten aller beschriebenen Selbst-Festigungsfahrten, der Abenteuer des Odysseus, »löst sich im Bild der Reise historische Zeit ab aus dem Raum, dem unwiderruflichen Schema aller mythischen Zeit.«80
Diesen Prozess machten die Bildungsreisen gewissermaßen rückgängig, indem ihr Konzept epochale Distanz, da prinzipiell unaufhebbar, in den Raum als geographische, also überwindbare Entfernung projizierte: An den Entstehungsorten der klassischen Kultur sollte dem Nachwuchs-Subjekt, das in ihrem Geiste erzogen wurde, die gegenwärtige Erfahrung des vergangenen Ursprungs gelingen.
In dem existentiellen Sinn, den sie so stiftet, erweist sich die Institution der bürgerlichen Bildungsreise als ein Spezialfall der grundsätzlich engen Verschlingung von Erkenntnis und Mobilität. Denn in der Reise hat das moderne Individuum die zentrale Metapher für seinen Weg durch die Welt gefunden, einen Weg, der mit jedem Schritt vorwärts näher heranführt an die verschütteten Möglichkeiten der eigenen Herkunft.
Die Flucht aus Deutschland, den Irrweg quer durch Europa, der schließlich in den USA endete, als die moderne Variante einer Bildungsreise zu behaupten, mutet zynisch an. Und doch legen Hunderte von Autobiographien Zeugnis ab von der Nachhaltigkeit der »negativen Bildungserlebnisse«, die Vertreibung und Flucht erzeugten, aber auch von den »positiven«, die bisweilen der erzwungene Kontakt mit fremden Lebens- und Denkweisen mit sich brachte.
»Eine Welt, die Welt meiner Kindheit, meiner Jugendjahre, die Welt des Rechts, der Moral, der Achtung vor dem Nächsten war zusammengebrochen«, schrieb Gottfried Bermann Fischer.81 Bei Elsbeth Weichmann, der Frau des sozialdemokratischen Politikers und späteren Hamburger Bürgermeisters Herbert Weichmann, heißt es: »Mit der Emigration war auch ein Weltbild zusammengebrochen ... Das Menschenbild, an das wir geglaubt hatten, war zerstört.«82 Und Adorno resümierte in seinen Exil-»Reflexionen aus dem beschädigten Leben«: »Jeder Intellektuelle in der Emigration, ohne alle Ausnahme, ist beschädigt und tut gut daran, es selber zu erkennen ... Enteignet ist seine Sprache und abgegraben seine geschichtliche Dimension, aus der seine Erkenntnis die Kräfte zog.«83
Ebenso viele autobiographische Zeugnisse - und nicht selten dieselben - schildern das »positive Bildungserlebnis« des Exils, das wesentlich in einer Kosmopolitisierung des national eingeengten Bewusstseins bestand: »Die Welt, in der wir lebten, wurde immer größer«, erinnerte Elsbeth Weichmann: »Die Emigrantennotgemeinschaft wuchs auf diese Weise mit den Jahren zu einer Weltgemeinschaft und entwickelte ein Weltwissen, das aus vielen von uns Weltbürger machte«84. Auch der Sozialwissenschaftler Leo Löwenthal beobachtete an sich selbst die »Ausweitung meines Horizonts«: »... ich fühle mich viel kosmopolitischer, vielmehr ein Mann der Welt, als ich das je in Deutschland gefühlt habe oder vielleicht fühlen würde.«85 Sein Freund Adorno reflektierte die amerikanische Zeit: »Kaum ist es übertrieben, dass ein jegliches Bewusstsein heute etwas Reaktionäres hat, das nicht, sei es auch mit Widerstand, jene Erfahrung sich wahrhaft zugeeignet hätte.«86 Und der Sozialwissenschaftler Adolph Lowe stellte schlichtweg fest, erst in den USA habe er erkannt, »wie provinziell mein Gesichtskreis war in den ersten vierzig Jahren meines Lebens, in denen ich auf meine Weise auch überzeugt war, dass am deutschen Wesen die Welt genesen müsse«87.
9
Reisekostenabrechnung • Auch diese Reise auf den Spuren des deutschen Exils ist eine Bildungsreise. Sie folgt dem historischen Muster: Ihr Ziel sind nicht exotische Orte, sondern das bessere Verständnis des eigenen Alltags; als Fahrt durch die Zeit führt sie vorrangig an Orte der Geschichte, um an ihnen zu besichtigen, was in unserer Zukunft wichtig werden sollte; und wie bei Bildungsreisen üblich, begannen die Vorbereitungen früh.
Stück für Stück sammelte ich, wohl schon während der Schulzeit in den sechziger Jahren, als ich das Reiseziel noch gar nicht kannte, mein Gepäck, aus zunächst unverständlichen Beobachtungen, aus zufälligen Erlebnissen und hingeworfenen Bemerkungen, die Verdacht weckten, aus der Wattemauer des Schweigens, mit der die Älteren fast alles umgaben, was ihre Vergangenheit vor 1945 betraf, und aus der Redseligkeit, mit der Nachfragen nicht beantwortet wurden.
Den entscheidenden Anstoß allerdings, der mich den Plan zu der Reise fassen ließ, gab eine eigene »Entdeckung« zu Beginn meines Studiums. Allein schon, dass ich sie machen konnte - dass mir also dreizehn Schuljahre zuvor diese simple Tatsache nicht vermittelt hatten -, beweist die Verlorengegangenheit als Teil einer ungeheuren Verlogenheit.
Zwei neue Leidenschaften veränderten damals, in den frühen siebziger Jahren, mein Leben. Ich begann - darin als verspäteter einzelner nachholend, was die kritische bundesdeutsche Intelligenz in den anderthalb Jahrzehnten zuvor als Gruppe absolviert hatte - meinen Weg durch die »Frankfurter Schule«; das heißt durch ein kulturelles Klima, welches von den Theorien in ihrem Umkreis, dem Denken von Horkheimer und Adorno, aber auch von Marcuse, Löwenthal und dem frühen Kracauer getragen wurde. Genauer trifft vielleicht die Rede von der »Suhrkamp Kultur«, da sie Brecht, Benjamin und Bloch mit einbegreift. Besonders faszinierten mich die frühen Analysen der Massenkultur, Kracauers filmtheoretische Schriften, Benjamins »Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«, die »Dialektik der Aufklärung« von Horkheimer und Adorno.
Dieses Interesse hatte seinen Grund in der Affinität zur zweiten neuen Leidenschaft. Viel Zeit verlebte ich in den sich gerade wie die Kneipen vermehrenden Filmkunstkinos. Sie bestritten ihr Programm zu einem nicht unwesentlichen Teil mit Erst- und Wiederaufführungen von Filmen, die in den dreißiger und vierziger Jahren in Hollywood entstanden und ein Vierteljahrhundert nach dem Ende der Diktatur im Fernsehen noch nicht oder nur verstümmelt gelaufen waren, Werke des film noir, screwball comedies, Anti-Nazi-Klassiker.
Gehörte der Studientag daher der Kritischen Theorie und ihrem Verdikt über Kulturindustrie, so verbrachte ich, als zeige der Abwehrkampf gegen die Versuchungen mit hereinbrechender Dunkelheit gewisse Ermüdungserscheinungen, die »Night in Casablanca«. Es mag unglaublich klingen, aber es vergingen lange Monate, bis ich endlich realisierte, dass die kanonischen Texte zur Massenkultur, an denen ich mich abarbeitete, zum überwiegenden Teil zur selben Zeit und am selben Ort entstanden waren wie die Werke der Traumfabrik, die sie - neben vielem anderen, versteht sich - verdammten; dass für die Analysen also gewissermaßen Erfahrungen mit Hollywood aus erster Hand verantwortlich waren, die die Autoren während der dreißiger und vierziger Jahre in Amerika gesammelt hatten.
Kurzum: auf diesem Weg erfuhr ich, ein zwanzigjähriger Nachkriegsdeutscher, allererst von der historischen Tatsache des großen Exodus nach 1933, ich »entdeckte« das Exil. (Das Schimpfwort Emigrant in Zusammenhang mit der »unbewältigten Vergangenheit« hatte ich bis dato nur aus dem tagespolitischen Kontext gekannt, wo es Willy Brandt traf, der, wie die üble Nachrede wollte, es »gewagt hatte, in einer norwegischen Uniform deutschen Boden zu betreten«.)
Noch einmal brauchte es dann einige Zeit, bis ich, wieder sehr überrascht, in Erfahrung brachte, dass auch die nächtlich genossenen Filme zu einem großen Teil das Werk von Flüchtlingen aus dem deutschen Kulturraum waren, dass etwa zum Entstehen des düsteren Stils der bewunderten »Schwarzen Serie«, die sichtlich dem deutschen Stummfilmexpressionismus viel verdankt, Hunderte von Emigranten beigetragen haben, als Autoren und Regisseure, Techniker und Produzenten, Kameramänner und Cutter, als Set-Designer, Beleuchter und auch als Schauspieler in unzähligen Nebenrollen.
Ein seltsam doppelter Umweg ließ mich so - am Beispiel meiner eigenen »Bildung« durch Kritische Theorie und Hollywood - die öffentlich kaum diskutierte Nachwirkung des Exils auf die bundesrepublikanische Gegenwart erkennen. Und auf einem weiteren Umweg über die Weimarer Kultur, die 1933 fast geschlossen Deutschland verlassen musste, stieß ich schließlich auf die literarische Form, in der ich die »Reise in die Verlorengegangenheit« erzählen konnte.
Nachhaltiger als jede andere Sparte der Literaturproduktion wurde die Reportage, wie sie in den zwanziger Jahren ihre Blüte erlebte, durch das Exil betroffen. Denn diese Art des Schreibens ist eine soziale Kunst. Reportagen verfasst man nicht im kleinen Kämmerlein und für die Schublade. Ihr Autor, will er sein Schreibziel erreichen, ist in höherem Maße als etwa ein Lyriker auf unmittelbare Publikation angewiesen. Seine Texte zehren von der Gegenwart und sind, wie hoch auch ihre aktuellen Ewigkeitswerte steigen mögen, der zeitgenössischen Wirkung verfallen. Für die Entfaltung einer lebendigen Reportagetradition ist conditio sine qua non daher erstens das Vorhandensein publizistischer Organe, welche die Reportage pflegen.88
Zweitens notwendig ist ein zahlenstarkes Lesepublikum, das sich nicht nur für das interessiert, was die große Reportage gegenüber anderen literarischen und journalistischen Erzählweisen leistet, sondern das auch in der intellektuellen Lage ist, mit der nicht unkomplizierten Form zu Rande zu kommen: der tendenziellen Offenheit des Mischgenres, der Freiheit zu Reflexionen und Abschweifungen, der schnellen Montage heterogener Elemente, dem Gebrauch »fiktionaler« Techniken bei der Darstellung von »wirklichen« Ereignissen.89
Diese Abhängigkeit von demokratischen Verhältnissen und einer entwickelten publizistischen Landschaft machte die Kunst der Reportage im Exil, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, kaum lebensfähig.90 Exilliteratur hat Hans Magnus Enzensberger einmal als Beispiel einer »Literatur auf Verdacht« beschrieben.91 Reportagen aber entstehen selten auf Verdacht. Die Tradition kritischer Publizistik brach mit der nationalsozialistischen Machtübernahme abrupt ab. Ihr Ausfall hat sowohl die Kultur des Exils als auch später die der Nachkriegszeit negativ geprägt. Denn die Form ist wie kein anderes Genre geeignet, historische Umbruchsituationen zu erfassen: Entstanden »aus dem Ungenügen der Literatur an sich selbst«, so Erhardt Schütz, stellt die Reportage einen »vorgeschobenen Punkt« in der Formulierung des literarisch noch nicht Fixierten dar. Was sie nicht zur Sprache bringt, bleibt lange von Schweigen betroffen.
Die Begegnungen mit deutschen Emigranten konfrontiert der Verlauf meiner Reportagereise auf den Spuren des Exils mit Interviews aus dem Berlin der Gegenwart, dem exponierten Außenposten des »untergehenden« Westdeutschland. Dieses Stimmen- und Stimmungskonzert Berliner Schnauzen begleitet, gewissermaßen als intellektueller »Chor«, die Reise in die Verlorengegangenheit. In dem knappen Dutzend Gesprächen, die ich mit West- und Ostberliner Künstlern, Kulturpolitikern und Wissenschaftlern über die Vergangenheit von Exil und Kulturvernichtung sowie die Chancen und Gefahren einer »vereinigten« Zukunft geführt habe, verschränken sich die Umwälzungen der Jahreswende 1932/33, als die deutsche Teilung begann, mit der »Revolution« von 1989/90, die diese Teilung zu beenden scheint.
Von einer eigentümlich kribbeligen Atmosphäre zeugen die meisten Interviews. Durch die Stadt wehte im Winter und Frühjahr 1990 ein frischer Wind, der den Mief der Mauerjahre zu verscheuchen schien: als habe das Leben einen Tritt bekommen und laufe nun schneller. Insofern sind die Gespräche auch Dokumente eines historischen Zustands, der nicht anhielt und nicht anhalten konnte. Unverändert gegenwärtig - da von der Geschichte nicht entschieden - sind jedoch die Themen der Interviews. In seiner Gesamtheit, für die der Berichterstatter nur begrenzt verantwortlich zeichnet, stellt der Chor Berliner Schnauzen eine kollektive Reflexion auf den gegenwärtigen Stand des Bewusstseins dar.
Von ihm nimmt die Bildungsreise in die Geschichte der eigenen Kultur ihren Ausgang.
10
Novemberverbrechen • »Ich bin abends zu einer CDU-Freundin gegangen, und wir haben das bewusste Interview mit dem Schabowski im Fernsehen gesehen«, sagt Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Präsidentin der Volkskammer und amtierendes Staatsoberhaupt der DDR. Wir sitzen in ihrem Arbeitszimmer im Ostberliner Palast der Republik. Frau Bergmann-Pohl verstand Günther Schabowski so, wie er seine Auskünfte meinte: als relativ unverbindliche Absichtserklärung, als Wechsel auf zukünftige Erleichterungen: »Privatreisen nach dem Ausland können«, sagte der SED-Sprecher und Krenz-Vertraute um 19 Uhr wörtlich, »beantragt werden. Reiseerlaubnisse werden kurzfristig erteilt.« Nicht mehr und nicht weniger.
»Ich bin ziemlich spät nach Hause gekommen«, erzählt die Präsidentin weiter, »mein Mann hat Fußball gesehen. Im Schlafzimmer steht auch ein Apparat, und ich bin davor eingeschlafen. Irgendwann wurde ich wach und habe gedacht: Was ist denn da im Fernsehen los? Ein Theater! Aber ich war im ersten Schlaf und hab‹ ausgeschaltet. Am nächsten Morgen sagt mein Sohn zu mir: ›Oma hat in der Nacht angerufen, aber ich hatte keene Lust euch zu wecken.‹ Halb sieben morgens rufe ich sie also an. Sagt sie: ›Die Mauer ist auf.‹ Ich: ›Du spinnst!‹ Sie: ›Ich war selbst da.‹ Meine Schwiegermutter ist fünfundsiebzig! Die war spontan losgefahren. Erst langsam wurde mir klar, das ist eine Sache, die kein Mensch vorausgesehen hat. Die Leute haben diese Pressemitteilung missverstanden, sind losgerannt, und die an der Grenze wussten sich keine andere Wahl mehr und haben gesagt: ›Na, nun machen wir das Ding auf.‹«
An diesem verhangenen, fast milden Novembertag waren die Straßen schwarz von Menschen, ein wogender Ozean von Leibern. Niemand hat die Demonstranten gezählt, aber die Augenzeugen sprechen von Hunderttausenden. Alle waren darauf gefasst, in die Maschinengewehrsalven der Armee zu marschieren. Die Männer in den vorderen Reihen trugen an langen Stangen befestigte Pappschilder: »Brüder, nicht schießen!« - »Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Monarchie!« - »Wir wollen Frieden und Brot!« Rote Papiernelken, Rosetten und Bänder, die von fliegenden Händlern angeboten wurden, fanden reißenden Absatz. In den hinteren Reihen aber gingen auch viele Bewaffnete mit.
Und dann geschah - nichts. Die Soldaten öffneten die Kasernentore und liefen zu den Aufständischen über, die Polizisten im Alexanderplatz-Präsidium schnallten ihre Waffen ab. Verblüfft bildeten die Demonstranten Gassen, damit die Ordnungshüter unbehelligt nach Hause gehen konnten.
Am frühen Nachmittag rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann, den die Menge bei einer wässrigen Kartoffelsuppe störte, von einem Fenster des Reichstags: »Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Das alte Morsche ist zusammengebrochen; der Militarismus ist erledigt! Die Hohenzollern haben abgedankt! Es lebe die deutsche Republik!«
Als SPD-Chef Friedrich Ebert, der seine Suppe derweil weitergelöffelt hatte, von Scheidemanns Tat hörte, reagierte er äußerst wütend auf die unvorschriftsmäßige Eigenmächtigkeit. Fast zufällig und gleichsam um Entschuldigung bittend war die Republik ins Leben getreten - beim ersten Mal jedenfalls.
Denn um halb fünf unternahm um die Ecke vom Reichstag Karl Liebknecht, der Führer der Kommunisten, eine Reprise: »Der Tag der Revolution ist gekommen. Wir haben den Frieden erzwungen. Das Alte ist nicht mehr. In dieser Stunde proklamieren wir die freie sozialistische Republik Deutschland.« Liebknecht wies auf das Hauptportal des Berliner Schlosses und rief mit erhobener Stimme: »Wir wollen an der Stelle, wo die Kaiserstandarte wehte, die rote Fahne der freien Republik Deutschland hissen!«
Im Nachmittagswind flatterte sie dann von zahllosen Dächern der Reichshauptstadt: vom Brandenburger Tor, vom Marstall und vom Kronprinzenpalais. Diese Gebäude hatte das Volk dem Schutze der Revolution unterstellt. Bewaffnete Arbeiter hielten Wache.
Zugleich aber machte sich so etwas wie Ratlosigkeit breit. Was war nun noch zu tun? Zielloses Gedränge bestimmte den Abend, Verbrüderung, gedämpfte Volksfeststimmung. 92
»Da«, sagt Sabine Bergmann-Pohl und deutet auf ein links gelegenes Stück Fassade, das beim Abriss des Schlosses durch die SED-Regierung verschont wurde: »Von dem Balkon aus hat am 9. November 1918 Karl Liebknecht die Republik ausgerufen. Dort ist jetzt mein Amtssitz als amtierender Ministerpräsident.«
Kurz nach elf Uhr am Vormittag des 9. November - es war der Jahrestag von Napoleons Staatsstreich im Brumaire des Jahres 1799 - zogen zwei- bis dreitausend Mann vom Bürgerbräukeller am Südufer der Isar in Richtung Stadtmitte. Adolf Hitler marschierte in der ersten Reihe, mit ihm General Ludendorff und Hermann Göring. Die meisten Männer waren bewaffnet, Hitler selbst hielt eine Pistole in der Hand. Nur die Anführer wussten, dass damit ein letzter verzweifelter Versuch unternommen wurde, durch Bluff den schon fehlgeschlagenen Putsch doch noch in einen Sieg zu verwandeln.
In den Straßen drängten sich die Menschenmassen. Als der Zug die Ludwigbrücke erreicht hatte, lief einer der Nationalsozialisten voraus und rief dem Polizeioffizier zu: »Nicht schießen! Ludendorff und Hitler kommen!« Gleichzeitig schrie Hitler: »Ergebt euch!«
In diesem Augenblick fiel ein Schuss, und gleich darauf fegte ein Hagel von Geschossen über die Straße. Als erster wurde ein Mann getroffen, der mit Adolf Hitler Arm in Arm gegangen war. Hitler fiel, entweder von seinem Begleiter mit herabgezogen oder Deckung suchend.
Alles war in Verwirrung, ein Nazi-Führer lehnte sich gegen eine Hauswand und weinte hysterisch. Die Mehrheit der Prominenz, Hitler vorneweg, floh im Feuer. Nur Göring und ein anderer Nazi-Führer wurden verletzt. Die übrigen Verwundeten und auch die sechzehn toten Putschisten hatten sich auf dem Marsch in den hinteren Reihen befunden. Sie waren den Schüssen der Polizei ausgesetzt gewesen, weil ihre Führer sofort Deckung gesucht hatten. 93
Es ist kurz nach elf, Donnerstagabend. Ich liege im Bett und vergnüge mich damit, durch die Fernsehkanäle zu flippen. Eine Sondermeldung unterbricht das Programm von AFN, dem amerikanischen Militärsender: Die Mauer sei gefallen. In den ZDF-Nachrichten ist davon keineswegs die Rede gewesen. Die Amis haben mal wieder alles falsch verstanden. Außenpolitik fünf. Fleißig, aber untalentiert, man kennt das.
Im Dritten läuft eine Talkshow, die meine Programmzeitschrift nicht verzeichnet. Der Moderator scheint leicht angeshakert. Einer der Gäste ist der Berliner Bürgermeister Momper, und der erhebt sich jetzt, beim x-ten Drüberflippen, gerade von seinem Stuhl. Ein Skandal!? Ich flippe zurück.
Der Gesprächsleiter nuschelt irgend etwas von Verständnis für die Situation. Momper sagt, er müsse zu den Übergängen, da sei die Hölle los.
Ich stehe auf, ziehe mich an und mache mich auf den Weg. Die nächstgelegene Kontrollstelle ist die Invalidenstraße.
»Berlin Nr. 234404 9.11.2355 - An alle Stapo-Stellen und Stapo-Leitstellen / An Leiter oder Stellvertreter ... Es ist vorzubereiten die Festnahme von etwa 20000-30000 Juden im Reiche. Es sind auszuwählen vor allem vermögende Juden. Nähere Anordnungen ergehen noch im Laufe dieser Nacht. ... Gestapo II Müller.« 94
Stunden später, am Abend des 9. November 1938, polterte ein SA-Scharführer in das Schlafzimmer einer jüdischen Familie. Dr. Goldstein und seine Frau standen, aufgeschreckt durch den Lärm und die Auseinandersetzung vor der Tür, schon neben ihren Betten.
»Ich bin angewiesen«, sagte der Scharführer zögernd, die Pistole in der Hand, »einen schweren Auftrag durchzuführen.«
Ruhig antwortete Frau Goldstein: »Mein Herr, schießen Sie, bitte, gut!« und da schoss er. 95
Kurz vor Mitternacht trete ich aus der Haustür. Auf Alt-Moabit kommen mir zahllose Fußgänger entgegen. Nicht nur ihre Menge um diese Uhrzeit ist ungewöhnlich. Auch in ihrer Kleidung und in ihren Bewegungen irritiert mich etwas, das ich nicht auf Anhieb einordnen kann. Die Menschen strömen aus der Richtung des Gefängnisses in der Lehrter Straße, und ich habe plötzlich den unsinnigen Gedanken, ein Massenausbruch könnte stattgefunden haben. Vor dem ersten Trupp wechsele ich spontan vom Bürgersteig auf die Fahrbahn und bleibe dort, bis ich meinen wenige Meter weiter geparkten Wagen erreiche.
Trotz der Fernsehszenen, die mich aus dem Bett gelockt haben, verfalle ich erst im Stau vor dem Übergang Invalidenstraße auf den Gedanken, dass es sich bei den Menschen, die die Straßen bevölkern und von denen viele mit schnellen Schritten in Richtung City marschieren, nicht nur um West-, sondern bereits auch um Ostberliner handeln könnte. Die Vorstellung allein scheint mir - aufgewachsen in der Zeit nach dem Mauerbau - vollständig verrückt.
In Berlin beginnt der Pogrom gegen 1 Uhr nachts. Fachgerecht hat man zuvor die jüdischen Hauptgebäude isoliert, die Telefonleitungen abgeschnitten, die Strom- und Heizanlagen abgestellt. Die Polizei leitet den Verkehr um. Ordnung herrscht, als sieben große Synagogen der Hauptstadt in Brand gesetzt werden, darunter die in der Fasanenstraße.
»Warum spritzen Sie nicht«, ruft der herbeigeeilte Oberkantor Davidsohn den Feuerwehrleuten zu, die mit leeren Schläuchen dastehen.
»Was wollen Sie denn hier?« erwidert der Feuerwehrhauptmann. »Sie werden hier nur totgeschlagen.«
»Ich war an dieser Synagoge 27 Jahre tätig.«
»Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen, wir sind nur hier, um die Nachbarhäuser zu schützen.«
»Um Gottes Willen, ich möchte wenigstens noch das Nötigste heraussuchen.«
Doch plötzlich sieht der Kantor den Synagogenpförtner Wolfsohn blutüberströmt im Hemd in den Hof laufen. Da der Pförtner sich weigert, die Schlüssel auszuhändigen, wird er bis aufs Blut geprügelt.
SA- und SS-Männer gießen aus großen Kanistern Benzin in die Flammen. Bald brennt auch das Innere der Synagoge lichterloh.
»Bis fünf Uhr früh«, erinnert sich Davidsohn, »stand ich dabei, dann rückte die Feuerwehr ab, das Feuer verglimmte, und ich sagte ›Kaddisch‹.« 96
Jedes dritte Fahrzeug auf den nächtlichen Straßen ist ein Wartburg oder Trabbi. Man traut seinen Augen nicht. »Die Grenzen sind offen, die Ostberliner sind in der Stadt«, meldet der RIAS.
An die Invalidenstraße führt kein freier Weg mehr. Im Radio heißt es, dort fänden Freudenfeiern statt. Wer mir entgegenkommt, ist in euphorischer Eile.
»Wo wollen Sie hin?«
»Zum Ku'damm«, sagt die Frau.
»Immer geradeaus«, sagt ihr Mann.
»Hauptsache drüben«, brüllt einer, der im Laufschritt vorbeizischt.
Auf der Entlastungsstraße und der Straße des 17. Juni staut sich der Verkehr. Tausende wollen zum Brandenburger Tor. Kolonnen von Fußgängern ziehen durch den Tiergarten. Eine eigentümliche Hysterie liegt in der Luft. Vier dunkelblaue S-Klasse-Mercedesse zischen mit Polizeibegleitung an mir vorbei.
Nach einem längeren Fußmarsch hole ich die Wagen wieder ein. Sie stehen in der abgesperrten Zone vor dem Brandenburger Tor. Auf einer improvisierten Bühne probt Tom Brokaw, einer der drei Top-US-Anchor-Men seinen Auftritt. Er soll live in die New Yorker Abendnachrichten geschaltet werden. Deutsche Fernsehteams sind nicht zu sehen. Polizisten auch nicht. Über Tausend Menschen dürften es sein, die sich jetzt um die Bühne drängeln.
Ich steige über eine Absperrung, von der ich denke, dass die TV-Leute sie errichtet haben. Dutzende machen es mir nach. Jetzt haben wir die Mauer am Brandenburger Tor erreicht. Ich drehe mich um. Ein paar Meter hinter mir steht stumm und bewegungslos ein Polizist im üblichen Thermogrün. Eher schüchtern. Ein wenig so, als gehöre er gar nicht dazu, als sei er aus Versehen hierher geraten.
»Was hat der denn für ›ne komische Kappe?« fragt die Frau neben mir.
Das Ding ist feuerrot und eindeutig nicht westlicher Herkunft.
»Ick gloob', wir sind im Osten, wa?« sagt die Frau.
»Irre«, sag' ich.
Auf der Bühne werden die Scheinwerfer angeschmissen. Tom Brokaw stellt sich in Positur, mit dem Rücken zum Brandenburger Tor.
»Wenn ihr auf die Mauer klettert, kommt ihr gut ins Bild«, rät ein Helfer der TV-Leute.
»Einfacher gesagt als getan«, mault einer aus der Menge zurück.
Die ersten erklimmen mühsam die Mauer. Britische Militärpolizisten treffen ein, bleiben aber brav an der Sektorengrenze stehen. Mir fällt ein, dass ich, sicherheitsbedürftig wie ich in den aggressiven letzten Wochen geworden bin, einen kleinen Hammer in der Tasche meines Ledermantels trage. Wer oben ist, zieht die weniger gewandten hoch. Wir sind das Volk, warum nicht auch wir, und das Volk tanzt auf der Mauer. Zum ersten Mal. Tom Brokaw geht auf Sendung. Ich ziehe meinen Hammer aus der Tasche.
In jener Nacht fuhr ich, im Taxi auf dem Heimweg, den Tauentzien und den Kurfürstendamm entlang. Auf beiden Straßenseiten standen Männer und schlugen mit Eisenstangen Schaufenster ein. Überall krachte und splitterte Glas. Es waren SS-Leute in schwarzen Breeches und hohen Stiefeln, aber in Ziviljacken und mit Hüten. Sie gingen gelassen und systematisch zu Werk. Jedem schienen vier, fünf Häuserfronten zugeteilt. Sie hoben die Stangen, schlugen mehrmals zu und rückten dann zum nächsten Schaufenster vor. Passanten waren nicht zu sehen ...
Dreimal ließ ich das Taxi halten. Dreimal wollte ich aussteigen. Dreimal trat ein Kriminalbeamter hinter einem der Bäume hervor und forderte mich energisch auf, im Auto zu bleiben und weiterzufahren.
Als ich zum vierten mal halten wollte, weigerte sich der Chauffeur: »Es hat keinen Zweck«, sagte er, »und außerdem ist es Widerstand gegen die Staatsgewalt.« 97
Vor dem Springerhochhaus an der Kochstraße verteilen Zeitungsjungen kurz nach zwei Uhr die ersten Extrablätter kostenlos an die paradefahrenden West- und Ostberliner. Ich nehme eine BZ: »Die Mauer ist weg«, verkündet die Schlagzeile, und dabei sehe ich sie doch, nur ein paar Meter entfernt, in bestem Zustand. Wie gezählt ihre Tage sind, kann ich mir immer noch nicht vorstellen.
»In der näheren Umgebung der Grenzübergangsstellen gibt es keine Parkplätze mehr«, heißt es im Verkehrsfunk. Mitten in der Nacht.
Auf Tauentzien und Ku'damm steht der Verkehr in beide Richtungen. Es stinkt bestialisch nach Zweitakter, das Hupkonzert ist ohrenbetäubend. Auch die Bürgersteige sind bis zum Bersten gefüllt. Ich fahre tanken am Hohenzollerndamm.
»Wo geht es hier zum Ku'damm?«
Aus dem Osten kommend, wie Sprache, Kleidung und Gestik verraten, müssen die beiden jungen Paare den längst passiert haben. Ich zeige ihnen den Weg.