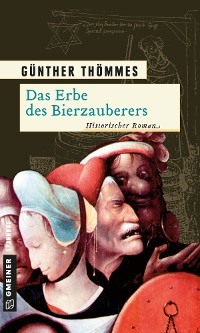Kitabı oku: «Das Erbe des Bierzauberers», sayfa 4
Dieter de Foro
Der Brauer Dieter vom Markte war ein abgrundtief schlechter Charakter. Der Nachkomme von Peter de Foro betrieb das Brauhaus ›Zum Lüsternen Eber‹, das seit über 200 Jahren in der Nähe des Hospitals lag. Die beiden anderen, von Niklas Hahnfurt4 gegründeten Brauhäuser Bitburgs, ›Römer‹ und ›Arschleder‹, waren nach Peters plötzlichem Tod 1281 von der Familie La Penna übernommen worden. Latinisierte Namen waren aus der Mode gekommen, so nannten sich die La Pennas mittlerweile ›Flügel‹. Deren Brauhäuser florierten, während die de Foros/vom Markte mehr schlecht als recht und nur mithilfe ihres sonstigen großen Reichtums den ›Eber‹ durch die letzten 200 Jahre hatten manövrieren können.
Dieter war der letzte männliche Nachkomme der de-Foro-Familie und, wenn kein Wunder geschah, würde das alte Stadtadelsgeschlecht mit ihm in männlicher Linie aussterben. Er hasste Kinder nämlich, und das, was er am wenigsten vom Leben erwartete, war, mit einer Frau in Familienbanden zu leben.
»Womöglich mit einer, die nach dem dritten Kind nur noch fett und nörgelnd hinter mir herläuft«, pflegte er mürrisch von sich zu geben.
Gerne ließ er sich nach ein paar Bier darüber aus:
»Ich möchte keinen schreienden, keifenden Nachwuchs. Die seit Generationen überlieferten göttlichen Strafgerichte, die mal als Hungersnot oder Missernte, mal als Seuche über uns kommen, zeigen doch überdeutlich, dass zu viele Menschen auf der Erde die vorgegebene Ordnung zerstören würden, wie schon Aristoteles gemahnt hat. Von mir aus kann das Menschengeschlecht gerne vom Angesicht der Erde verschwinden.«
Dann betrachtete er amüsiert den Schrecken in den Gesichtern seiner Zuhörer und brach in meckerndes Gelächter aus.
Misanthropie war jedoch nur eine seiner schlechten Seiten.
Verschlagen, hinterhältig, schweigsam und illoyal, war Dieter nur seinen eigenen Interessen und Neigungen verpflichtet, nämlich Bier, gutem Essen und Musik.
Dem Ersten und Zweiten in einem Maße, dass es an Völlerei grenzte, dem Letzteren in einem Ausmaß, das an Götzendienst gemahnte. Aber mit Geboten oder kirchlichen Regeln wie Todsünden gab er sich erst gar nicht ab. Seine sonst übliche Schweigsamkeit überwindend, rechtfertigte er so zum Beispiel volltönend die von ihm mit schöner Regelmäßigkeit abgehaltenen Fress- und Saufgelage, sobald er keinen Denunzianten in seinem Brauhaus glaubte:
»Fasten ist etwas für Idioten. Wenn alle Leute lesen könnten oder die Pfaffen es euch aus der Heiligen Schrift übersetzten, dann wüsste ein jeder, dass Jesus und die Propheten viel gefastet haben. Bis zu 40 Tage. Und dass sie es zum Kotzen fanden!«
Seine große, hagere Gestalt sprach seinem Lebenswandel Hohn.
»Seid froh, in der Stadt zu leben«, sagte er gerne.
»Hier dürfen wir sogar in der Fastenzeit Butter essen.«
Diesen Ausspruch unterstrich er, indem er mit der Hand in den Butterteller langte und ein großes Stück, ohne Brot oder sonstige Beilage, in sich hineinstopfte. Manch einem wurde dabei bereits vom Zusehen übel.
Seine Haare wurden zusehends dünner, aus Eitelkeit kämmte er sie nach vorne, was ihm ein leicht groteskes Aussehen verlieh. Sein fahles Gesicht mit den hervorspringenden Wangenknochen unterstrich dies noch.
Obwohl sein Bier bestenfalls Mittelmaß war und er das gute Essen meist nur sich selbst gönnte, war sein Brauhaus regelmäßig zum Bersten voll. Das lag ausschließlich an seinen erlesenen musikalischen Darbietungen. Es gelang ihm immer wieder, die besten fahrenden Sänger und Musikanten zu engagieren.
In Trier wie in Köln gab es bereits Meistersinger-Schulen, sodass deren Schüler auf der Reise häufig in Bitburg Station machten. Begleitet von Flöten, Dudelsäcken und Handtrommeln, sangen die Fortgeschrittenen unter den Sängern bereits mehrstimmig. Obwohl die Lehre der großen Pariser Magister Leoninus und Perotinus von der Mehrstimmigkeit bereits seit Längerem an den Meistersinger-Schulen gelehrt wurde, galt ein derartiger Vortrag in einer Schenke doch als etwas unerhört Neues. Die Menschen waren ganz verrückt danach und drängten in die Vorstellungen, egal was es kostete.
An diesem Abend war es eher ruhig. Keine Musik, wenige Gäste.
Dieter war derlei gewohnt.
Da er am nächsten Tag Bier brauen wollte, war es ihm aber recht, da konnte er zeitig zu Bett gehen.
Er plante, ein neues Rezept auszuprobieren. Ein Bier mit Zusatz von Queckenwurzel und Runkelrüben. Nach seiner Vorstellung sollte das Bier damit bernsteinfarben bis rötlich herauskommen.
»Dazu ein wenig Wermut und Wacholder. Das wäre doch mal was anderes als die dunkle, bittersüße Brühe, die von den Flügels hergestellt wird«, murmelte er vor sich hin.
Ihm graute nur vor der Arbeit, die Runkelrüben klein zu hacken.
»Mein Brauerbursch wird dazu keine Zeit haben, muss ich es wohl selber machen.«
Da fuhr ein Windstoß durch die fast leere Schenke: Die Tür wurde geöffnet.
Ein Junge stand im Eingang, ging auf ihn zu und fragte:
»Seid Ihr der Brauherr Dieter? Man ruft mich Bertram, und ich suche eine Arbeit als Brauerbursch! Der Flügel-Pierpreu vom ›Römer‹ hat mich zu Euch geschickt.«
»Was denkst du dir, du Bauerntölpel, dass du mich einfach so anreden darfst! Meine Familie ist seit Erlangung der Stadtrechte, seit über 200 Jahren, als Stadtadel im Bitburger Schöffenkollegium vertreten. Du solltest nur mit mir reden, wenn ICH DICH anspreche.«
Dieters Zorn war gespielt, er machte sich gerne einen Spaß daraus, vor einfachen Leuten den arroganten Edelmann herauszukehren.
Bertram blickte eingeschüchtert zu Boden und murmelte eine Entschuldigung.
Dieter schaute ihn an und bemerkte die Entstellung in dessen Gesicht.
Er lächelte hintergründig, eigentlich kam der Bursche ja wie gerufen.
»Magst du Runkelrüben klein schnitzeln? Dann kannst du gleich morgen anfangen.«
Er hatte nicht vor, ihn länger zu behalten, aber diese Arbeit konnte der schiefnasige Trottel ihm gut abnehmen. Danach würde er ihn vom Hof jagen.
4 siehe ›Der Bierzauberer‹.
Georg
Georgs Anfangslohn betrug zehn Pfennige am Tag. Damit hätte er nicht viel anfangen können, aber bei Fischer gab es zu essen, und er hatte sich von seinen, oder besser: Michels Ersparnissen noch vorher neu eingekleidet.
Eine einfache Hose für sieben Pfennige, für vier Pfennige ein Hemd, dazu 15 Pfennige für ein Paar Schuhe, die ersten seines Lebens. Fischer bestand darauf, dass bei der Arbeit mit den Biersteinen Schuhe getragen wurden. Trotzdem hatte er noch reichlich Münzen übrig, die er wieder zurück ins Versteck tat.
Daniel und Georg kamen überraschend gut miteinander aus. Oder war es, dass es Sonja, die länger geblieben war als nur eine Nacht, gelungen war, ihn zu zähmen? Seine Wutausbrüche und ebenso seine Prügelorgien blieben jedenfalls monatelang aus.
Wenn er auch Anfangs viel schimpfte, weil Georg keine Ahnung von der Brauerarbeit hatte, »Heiliger Himmel, einem Esel kann ich das leichter erklären. Dich anzuleiten ist eine Qual, womit habe ich das verdient? Die Via Dolorosa unseres gekreuzigten Heilands war ja ein Zuckerschlecken dagegen!« und dergleichen mehr, so merkte er doch bald, dass Georg schnell von Begriff war und er ihm das meiste nur einmal zeigen musste. Als ein Junge, der bereits in jungen Jahren dreimal Eltern oder Pflegeeltern verloren hatte, war dieser Kummer gewohnt und tat sich schwer, anderen Menschen zu vertrauen. So hatte Georg sich bereits früh eine gewisse Zähigkeit und Unempfindlichkeit angeeignet, die er jedoch gegenüber Daniel mit einer anhänglichen Loyalität paarte, die dem Charakter des selbst ziemlich raubeinigen Brauherrn ungemein entgegenkam. Langsam, ganz langsam, stieg Georg in den Rang eines Protegés von Daniel Fischer auf.
Da dieser als Einziger die Rezepturen kannte, durften weder Georg noch die anderen Mitarbeiter wirklich selber brauen. Aber die Handlangerdienste waren schwer genug.
Alle Arbeiten waren aufgeteilt, es gab niedere und höher gestellte Arbeiten, wobei die höher gestellten Arbeiten direkt mit den Rohstoffen zu tun hatten:
Das von Daniel vorher abgemessene Malz schroten und in den Maischbottich einmaischen.
Oder die von Daniel im stillen Kämmerlein berechnete Hopfenmenge hinzufügen.
Die niederen Arbeiten hingegen waren heiß und dreckig, und je heißer und dreckiger, desto niedriger.
Seit einigen Jahrzehnten war es in Straßburg üblich, nicht den Topf übers Feuer zu hängen, sondern es genau umgekehrt zu machen. Sobald der Braukessel bereit und mit allen Zutaten gefüllt war, versenkte man über hölzerne Kufen glühend heiße Steine darin und erhitzte so den Inhalt des Kessels.
Dies war enorm aufwendig, vor allem, da die Steine häufig zersprangen und somit nur ein einziges Mal verwendet werden konnten. Die Biere aber gerieten meist besonders aromatisch und süßlich, weil ein Teil des Malzextraktes am heißen Stein karamellisierte.
Georgs Aufgabe war es, die Steine zu erhitzen. Dazu wurde im Kamin ein wahres Höllenfeuer angefacht. Zwei ältere Gesellen bliesen mit einem Blasebalg Luft ins Feuer, während Georg mit einer Art langarmiger Riesenzange die Steine hineinlegte und wieder herausnahm. Er hatte das Gefühl, direkt in einem Ofen zu sitzen, die Flammenzungen leckten nach seinen Händen und seiner Kleidung, er troff vor Schweiß, und mehr als einmal hätte er sich um ein Haar schlimme Verbrennungen zugezogen. Nach getaner Arbeit war er krebsrot, seine Haut brauchte Stunden, um ihre normale Farbe wiederzuerlangen.
Sein Herr schickte ihn auch regelmäßig auf die Suche nach Biersteinen. Columban, der lahme und halbtaube Knecht, fuhr mit dem Eselskarren los, manchmal, bevor Georg aufgesprungen war. Der Knecht mochte ihn nicht besonders und zeigte dies deutlich. Dann musste Georg immer hinter dem Karren herlaufen und sich im Fahren daraufschwingen. Das war nicht ganz ungefährlich, trotz der langsamen Fahrt.
Hatten sie dann Biersteine gefunden, musste Georg sie hochwuchten und auf den Karren legen. Columban stand derweil daneben und grinste. In der Brauerei angekommen, musste Georg auch allein abladen. Viele der Steine waren ziemlich schwer, und mehr als einmal schmerzten ihm abends alle Knochen.
Auch Georg schätzte Daniels berühmte Biersuppe und freute sich jeden Morgen darauf. Und am Ende seines zweiten Jahrs in Straßburg, nachdem Georg in der Zwischenzeit ein fester Bestandteil von Fischers Brauerei geworden und auch im Rang der Arbeiten aufgestiegen war, wich Daniel von seiner ansonsten strengen Gewohnheit ab und verriet Georg das Biersuppenrezept:
»Du hängst einen Topf mit Bier übers Feuer, nimm am besten von dem dunklen, süßen, in einen anderen Topf schlägst du ein Dutzend Eier auf, legst ein großes Stück Butter dazu, etwas Milch und quirlst es mit kaltem Bier ab. Dann gießt du das heiße Bier zu den Eiern, ein wenig Salz und noch einmal quirlen. Dann nimmst du ein gutes Brot und richtest die Suppe auf diesem an. Du kannst die Suppe auch mit Zucker oder Zimt versüßen.«
Er hielt inne und steckte sich demonstrativ schmatzend die Finger in den Mund.
»So werden sich die Gäste die Finger schlecken und mehr von dieser Suppe verlangen.«
Monat für Monat ging ins Land, Daniel wurde ruhiger, je älter er wurde. Dafür sorgten nicht zuletzt auch Sonja und Adelheid. Sonja war in Straßburg geblieben, ihr vormaliger slawischer Stolz war einer treuen Ergebenheit für Daniel gewichen, seit sie durchschaut hatte, dass sie ihn dadurch eigentlich umso besser im Griff hatte. Adelheid und sie verstanden sich bestens. Adelheid war für die Küche zuständig, insbesondere für das Kochen der Eingeweide und Innereien, die, angerichtet mit Paradieskorn, Lorbeer und Langpfeffer, neben der Biersuppe zu den Spezialitäten der Fischer-Küche gehörten, Sonja für die Schankstube, beides jedoch unter Daniel Fischers Oberaufsicht.
Georg profitierte von dieser Entwicklung, indem Daniel ihn mehr und mehr in seine speziellen Brauergeheimnisse einweihte.
»Solltest du jemals von hier fortgehen und mir mit meinen eigenen Rezepturen Konkurrenz machen, werde ich dich windelweich prügeln!«, sagte er mehr als einmal, wenn Georg ihm wieder ein weiteres Geheimnis entlockt hatte.
Georg hatte, genau wie Sonja, Gefallen an der Stadt gefunden.
Dadurch, dass sie seit Langem nur dem Kaiser untertan waren und sonst niemandem, ließ es sich befreit und gut dort leben. Sogar der Stadtadel war entmachtet worden, die Zünfte dominierten, und wer ihnen nicht in die Quere kam, oder noch besser, ihnen angehörte, hatte ein gutes Auskommen.
Es gab drei Zünfte, die den Handel und das Gewerbe beherrschten:
Die Kaufleute und Bäcker waren zusammengeschlossen, ebenso die Fleischhauer, Loher und Schuhmacher.
Die dritte Zunft waren die Schmiede und Schröter. Die Schröter hatten die Aufgabe, abgefüllte Weinfässer aus den Kellern der Winzer zu ›schroten‹, auf Wagen durch die engen Gassen zu transportieren und auf die Rheinschiffe zu verladen.
Die Zünfte hatten am meisten von den ständigen Streitereien zwischen den Familien Müllenheim und Zorn profitiert und sich langsam, aber sicher starke Machtpositionen erarbeitet.
Die Zunft der Kaufleute und Bäcker war die älteste, vornehmste und bedeutendste Vereinigung. Ihr wurden später, nach dem Aufschwung des Braugewerbes durch die Frostkatastrophe von 1446, auch die Bierbrauer angeschlossen.
Für das Kind eines Straßburger Bürgers betrug der Eintrittsbeitrag zwölf Schillinge und ein Pfund Wachs, mit dem Kerzen für die verstorbenen Zunftmitglieder hergestellt wurden.
Der gleiche Eintrittspreis galt für Berufe, die einer Zunft neu hinzugefügt wurden, unabhängig von der Herkunft.
Neulinge von auswärts hatten in etablierten Berufen keine Möglichkeit, Mitglied zu werden. Verstoß gegen die Zunftregeln wurde hart bestraft, bis zu einer Mark kostete eine einfache Missachtung, wie zum Beispiel die Herstellung von Brot ohne entsprechende Erlaubnis.
Daniel besuchte die Zunftversammlungen regelmäßig, erzählte hinterher ausführlich davon und schimpfte über die Einfalt und Sturheit seiner Zunftgenossen.
Georg hatte bald herausgefunden, dass es schwierig, wahrscheinlich sogar unmöglich werden würde, hier in Straßburg ein eigenes Brauhaus auf die Beine zu stellen, auch wenn dies in noch so weiter Ferne lag.
Also versuchte er zu lernen, in seiner karg bemessenen freien Zeit das Leben zu genießen und zusammen mit Fafnir Straßburg zu erkunden.
Dominiert wurde die Stadt vom Münster. Das Liebfrauenmünster war angeblich eines der höchsten Gebäude auf der ganzen Welt, zumindest der Nordturm!
Als ein Monument aus rosa Vogesensandstein strebte es dem Himmel entgegen: der ganze Stolz der Straßburger, die nicht müde wurden zu betonen, dass der Bau des Münsters von Bürgergeldern und nicht vom Bischof oder vom Domkapitel finanziert worden war.
Oftmals stand Georg am Münsterplatz, der nicht weit von Fischers Brauerei war, und bewunderte nicht die prächtigen Bürgerhäuser, sondern die eintürmige Kirche und ihre charakteristische asymmetrische Form, obwohl er diese Gedanken nicht in Worte fassen konnte.
Er fragte sich, wie weit entfernt dieser Turm zu sehen sei, »vielleicht sogar über das Rheinufer hinweg«.
Grundsätzlich waren die Voraussetzungen für die Aufnahme in das Brauhandwerk nicht nur in Straßburg, sondern in jeder Stadt des Reiches außergewöhnlich hoch gesteckt. Die beiden wichtigsten Voraussetzungen fehlten Georg von Anfang an: der Nachweis der ehelichen Geburt – sein Nachname ›Esposito‹ dokumentierte dies sogar anschaulich – und der Besitz des Bürgerrechts. Daniel ignorierte dies, obwohl ihm im Gegensatz zu Georg dieser Makel bewusst war, und setzte sich über die alten Regeln hinweg, indem er Georg mehr und mehr in seine Geheimnisse einweihte.
Vor der großen Elsässer Frostkatastrophe war das Recht, ein Brauhaus zu errichten und zu führen, nur an einflussreiche und wohlhabende Bürger, die auch Grundstücksbesitzer waren, verliehen worden. Da diese Brauherren ihr Privileg jedoch in der Regel nicht selber nutzten – ihre städtischen Ämter ließen dies nicht zu –, sondern die Arbeit von Lohnknechten und Gesellen ausführen ließen, hatte sich aus diesen ein ebenfalls privilegierter Berufsstand herauskristallisiert: der der Braumeister, denen es sehr bald gelungen war, ihren Berufstand streng abzuschirmen und gegen Neulinge von außerhalb zu verteidigen.
Nach der Katastrophe waren die Regeln etwas aufgeweicht worden, weil mehr guter Nachwuchs benötigt wurde, als die eigenen Reihen hergaben.
Daniel Fischer war jedoch auch hier die Ausnahme, weil er nicht bei einem Straßburger Brauherr gearbeitet hatte, sondern sich gleich mit eigenen Mitteln sein eigenes Brauhaus errichtet hatte. Seine Kenntnisse hatte er von einigen nützlichen Reisen, die er als junger Mann unternommen hatte. Er kam insofern nicht aus dem eigenen Nachwuchs, hatte sich aber mittlerweile den Respekt der anderen Brauer erworben.
Der aber nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit beruhte, weswegen Daniel auch nicht daran dachte, eine Erlaubnis zu Georgs Ausbildung einzuholen.
Je mehr Zeit verging, je besser Georg das Bierbrauen beherrschte, desto mehr sah er in Georg den Sohn, den er wohl niemals selber zeugen würde können. So hatte ihm eine Wahrsagerin vor Jahren prophezeit. Und ein Medikus, den er aufgesucht hatte, hatte diese Diagnose bestätigt. Sonja schien es egal zu sein, er hatte ihr gegenüber seine Bedenken jedoch noch nicht geäußert.
Georg lernte viel in dieser Zeit. Viele Menschen aus ganz Europa besuchten Straßburg, darunter Pilger und Wallfahrer, Kaufleute und Ritter, aus Frankreich, sogar aus Spanien und den Niederlanden kamen sie an den Rhein. Daniel hatte ihm einmal erzählt, dass in den letzten 100 Jahren in der Diözese Straßburg über 30 neue Wallfahrtsorte entstanden waren, darunter mehr als die Hälfte Marienheiligtümer mit sogenannten Hostienwundern.
»Sollen die Narren doch kommen und ihr gutes Geld bei uns lassen«, hatte der wenig fromme Brauherr oft genug gelästert.
Das Völkergemisch, das sich in der Schankstube drängelte, die fremden Sprachen und der Anblick fremd aussehender Menschen boten Georg viele Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln. Er nutzte sie redlich.
Bertram
Wieder einmal war er verprügelt worden, wieder einmal verfluchte er sein Schicksal.
Zwei Tage lang hatte er jeweils zwölf Stunden lang mit einem nicht sehr scharfen Messer Eimer um Eimer voller Runkelrüben klein geschnitten. Kurze Pausen für ein karges Essen, das Dieter de Foro ihm mehr hingeworfen als -gestellt hatte, dann ging es weiter.
Als er fertig war, hatte er seinen Lohn eingefordert und nach weiterer Beschäftigung gefragt.
Hohnlachen und eine Tracht Prügel waren die Antwort gewesen.
»Soll ich dir den Rest deines Gesichts auch noch verunstalten? Reicht dir deine Nase noch nicht?«
Jetzt saß er am Straßenrand und weinte.
Mehr über die erneute Demütigung als über die Verletzungen.
Er konnte es einfach nicht glauben: Sogar ein Mitglied der städtischen Hochgerichtsbarkeit setzte sich über Recht und Anstand hinweg und verweigerte ihm seinen verdienten Lohn!
Dieter vom Markte war allerdings nicht so geschickt im Austeilen gewesen wie Daniel Fischer, und daher hatte er davonlaufen können.
Er war vom Pech verfolgt und wusste nicht, warum.
Während er sich in Selbstmitleid erging, erkannte er plötzlich mit glasklarem Blick, dass er einfach nicht wehrhaft genug war.
Emmerich hatte ihn zwar als Begleiter akzeptiert, er hatte seine Wehrhaftigkeit während der Reise jedoch nicht unter Beweis stellen müssen.
Er war kräftig, aber es fehlte ihm sowohl an Selbstbewusstsein als auch an ordentlicher Bewaffnung und Erfahrung im bewaffneten wie im unbewaffneten Kampf.
Ein Ruck ging plötzlich durch ihn, als er beschloss, dies zu ändern.
Das wenige, was er darüber wusste, hatte er von Emmerich gelernt.
Lange Zeit waren die Ritter das Maß aller Dinge in perfekter Bewaffnung gewesen. Mit Schwert, Schild und Lanze war ein guter Ritter praktisch unbesiegbar gewesen.
Dies hatte sich in letzter Zeit dramatisch geändert. Der Niedergang des Rittertums war nicht zuletzt auch neuen Waffen geschuldet. Langbogen und Armbrust konnten mit ihren schnell verschossenen Pfeilen und Bolzen auch stärkste Rüstungen durchschlagen. Ein geübter Bogenschütze konnte einen Ritter zur Strecke bringen, lange bevor dieser den Schützen attackieren konnte. Auch ein Verbot des Papstes für diese unritterlichen Waffen hatte nichts genützt. Es war weitgehend ignoriert worden.
Bertrams Entschluss stand fest: gute Waffen mussten her, bevor er sich wieder mit anderen Menschen einließ. Einen Dolch hatte er sich von dem Geld für Emmerichs Dienste bereits beschafft. Mittelgroß, mit schlanker Klinge, jedoch scharf geschliffen, mit einem schwarzen Griff aus Messing, den er mit Leder umwickelt hatte. In einem kleinen Futteral steckend, band er ihn sich jetzt an der Wade fest, bevor er seine Schnürstiefel – die andere Neuanschaffung von Emmerichs Lohn – darüberzog. Damit sollte im Notfall das Überraschungsmoment auf seiner Seite sein.
Eine mittelgroße Armbrust, die bräuchte er noch. Und Übung im Kampf.
Emmerich und seine Gruppe waren schon weitergereist. So gab er sein letztes Geld für einen Beutel mit Wegzehrung aus, dann verließ er Bitburg durch das Kölner Tor. Allein, voll Hass und zu allem entschlossen.
Er musste nicht lange warten, bis er ein Objekt zum Üben gefunden hatte. Hinter Nattenheim traf er auf einen Schäfer, der mit seiner kleinen Herde am Wegrand stand. Der mittelgroße, schwarzbraune Hund bellte ihn fröhlich an, nicht ahnend, wen er da anbellte.
Der Gruß des Schäfers wurde nicht erwidert. Wortlos ging Bertram auf den Hund zu, nahm seinen Dolch, packte den Hund am Hals und schnitt ihm kurzerhand die Kehle durch.
Blut spritzte, als das Messer weich durch das Fleisch des Hundes glitt, der Schreck ging ihm anfangs durch Mark und Bein, schließlich war es das erste Mal, dass er bewusst ein Lebewesen tötete, und dieses dazu noch ohne Grund.
Der Schäfer, ein älterer Mann, dessen Gesicht von einem großen Hut verdeckt war, schrie auf und ging, mit seinem Stab vor sich her fuchtelnd, auf Bertram los.
Bertram schlug ihm den Stab aus der Hand und trommelte mit den Fäusten auf den armen Schäfer ein, der gar nicht wusste, wie ihm geschah. Völlig überrascht von dem Angriff, versuchte er lediglich, sein Gesicht zu schützen, durch die Hiebe und Tritte ging er alsbald zu Boden.
Bertram hatte leichtes Spiel. Er ließ erst ab, als der Schäfer blutend und regungslos, aber noch lebend vor ihm im Gras lag.
Er setzte eine Grimasse auf, die er als diabolisch empfand, überlegte kurz, ob er auch noch ein Schaf massakrieren sollte, empfand das aber als seiner unwürdig und ging weiter seines Weges.
Seine erste Bewährungsprobe hatte er bestanden. Niemals wieder würde jemand ihn wehrlos finden und verprügeln. Plötzlich verwandelten sich der Hass und die Rage, die er eben noch auf alles Lebende empfunden hatte, in ein Triumphgefühl, wie er es noch niemals verspürt hatte. Herr über Leben und Tod zu sein, ein Leben nach seinem Belieben zu verlängern oder zu beenden, dieses Hochgefühl war unbeschreiblich.
Um vor eventueller Verfolgung sicher zu sein – vielleicht hatte der Schäfer ja einen Lehnsherren, der ihn zur Rechenschaft ziehen wollte –, verließ Bertram die Hauptstraße Richtung Köln und wollte sich nach Osten durchschlagen, in Richtung Kyllburg.
Nach einer Stunde Wegzeit fiel ihm ein, dass er in Bitburg noch etwas vergessen hatte, was der Erledigung harrte. Er ging zurück, um die Stadt herum, mischte sich am südlichen Stadttor, dem Trierer Tor, unauffällig unter das Volk und gelangte so in die in diesen ausnahmsweise friedlichen Zeiten weniger streng bewachte Stadt.
Das Brauhaus lag links vom Stadttor, lediglich zwei Türme weiter, hinter dem Hospital. Bertram wartete in einer dunklen Nische des Turms, bis er sicher war, dass der letzte Gast den ›Lüsternen Eber‹ verlassen hatte, dann schlug er zu.
Der Kampf, wenn man es überhaupt ›Kampf‹ nennen konnte, war kurz. Bevor Dieter verstanden hatte, dass er angegriffen wurde, steckte ihm Bertrams Messer schon bis zum Heft im Hals, sodass es hinten wieder herausfuhr. Er sprang mit einem Schrei auf, zog sich das Messer aus dem Hals und wollte damit auf seinen Widersacher losgehen. Bertram hatte mit einem sofortigen Tod gerechnet und war entsprechend überrascht über den anfänglichen Widerstand. Der dauerte indes nicht lange. Mit jedem Atemzug kamen große blutige Luftblasen aus der Kehle, Bertram hatte mit seinem Dolch Dieters Luftröhre angeschnitten. Der lag bald am Boden und röchelte, während seine Wunde weiterhin blutigen Schaum ausspuckte. Bertram stand mitleidlos grinsend über ihm und wartete in aller Ruhe ab, bis der Todeskampf des Brauherrn, der ihn um seinen Lohn geprellt hatte, vorbei war.
Bis Dieter vom Markte am nächsten Mittag in seinem Brauhaus gefunden wurde, mit durchgeschnittener Kehle und den Mund voller Rübenschnitzel, hatte Bertram die Stadt schon wieder verlassen und war auf dem Weg nach Süden.
Dieters Tod wurde zu Protokoll genommen, besonders die Rübenschnitzel wurden vermerkt. Das Protokoll ging an alle Hochgerichtsbarkeiten in der Umgebung mit der Bitte, den Täter nach Bitburg zu überstellen, sollte er gefasst werden.
Mord und Totschlag kamen häufiger vor, als es der Obrigkeit lieb war, aber an Adligen doch eher selten. Da musste mit aller Macht ein Exempel statuiert werden.
Nach einem weiteren Tag erreichte Bertram das Moseltal und war dem Bitburg-Luxemburgischen Herrschaftsbereich bereits wieder entronnen.
Er folgte der Mosel flussabwärts. Was er brauchte, Essen oder Geld, stahl er unterwegs. Es war leichter, als er anfangs gedacht hatte.
Einen Fehler jedoch machte er: Er vergaß, dass er aufgrund seines entstellten Gesichts leichter zu beschreiben war als andere. Da die Wunden verheilt waren und sogar die Nase nicht mehr schmerzte, dachte er meist gar nicht mehr daran. Gelegenheit, in einen Spiegel zu schauen, hatte er keine.
Kurz vor Cochem machte er Rast in einer Schankstube. Der Raum war beinahe leer, lediglich zwei andere Männer verspeisten gerade eine riesige Fleischportion mit einem großen Krug Wein. Bertram sah das üppige Gepäck der beiden, dann hörte er interessiert mit.
Die beiden waren unterwegs zu den Herren von Eltz auf der gleichnamigen Burg. Die Burg Eltz lag im Tal der Elz, die das Maifeld von der Vordereifel trennt.
Der ältere der beiden war der Wortführer, und offensichtlich waren sie Kaufleute in Sachen Bewaffnung. Sie führten Gerätschaften mit sich, die Bertram niemals als Waffen erkannt hätte.
Nach einem weiteren Krug Wein kam Bertram mit ihnen ins Gespräch und gab sich als Brauerbursch auf Wanderschaft aus. Ganz gelogen war das ja nicht.
Der ältere der Kaufleute stellte sich als Bredelin vor, der jüngere, »mein Sohn, der mein Geschäft übernehmen und jetzt lernen soll«, hieß Eberwin.
Ohne großes Nachfragen erzählte Bredelin.
Sie kamen aus Nürnberg, waren in Trier gewesen und jetzt eigentlich auf dem Heimweg. Eine Kundschaft hätten sie noch unterwegs zu besuchen, die Eltzer Herrren.
»Die Burg Eltz ist schon über 300 Jahre alt, wird aber gerade ausgebaut. Und da haben wir neue Waffen im Angebot.«
Bertram schaute interessiert, als Eberwin eines der seltsam anmutenden Geräte in die Hand nahm.
»Das ist eine Hakenbüchse. Hier in der Moselgegend oder im Luxemburgischen nennt man sie ›Arkebuse‹. Das sind ganz neue Arten von Verteidigungswaffen. Die möchten wir den Eltzern verkaufen.«
Bertram hatte keine Vorstellung, wie diese Waffen funktionieren sollten, und gab das auch unumwunden zu.
»Ich kann es dir nicht vorführen, es ist zu aufwendig und zu gefährlich hier drinnen, aber glaube mir, die Wirkung ist verheerend«, erklärte Bredelin.
Nachdem Bertram kein klares Ziel hatte, versuchte er, sich so bei den beiden anzubiedern, dass sie ihn zur Gesellschaft mitreisen ließen.
»Nürnberg ist eine große Stadt. Da gibt es sicher Arbeit für mich.«
»Dann komm mit uns. Wir haben einen kleinen Wagen, nur für unser Gepäck und unsere Ware, neben dem wir hergehen. Da ist gute Gesellschaft immer passend. Und ich verspreche dir, wenn wir in Nürnberg angelangt sind, weißt du alles über die neuen Waffen. Auch wenn es dir beim Bierbrauen nicht hilfreich sein wird.«
Am nächsten Tag schon besuchten sie die Burg Eltz. Imposant und gewaltig reckte sie sich auf einem 70 Meter hohen Felsen aus dem Tal des kleinen Elzflüsschens empor, das sie von drei Seiten umfloss. Die Lage war gut gewählt, einerseits abseits der großen Straßen und nicht leicht zu finden oder zu erobern, andererseits an der Verbindung zwischen Mosel und den fruchtbaren Gegenden des Eifeler Maifeldes. Lediglich eine schwere Auseinandersetzung hatte die Burg Eltz in ihrer Geschichte durchstehen müssen: die sogenannte ›Eltzer Fehde‹ von 1331 bis 1336. Dabei ging es um einen politischen Streit der Eltzer Herren mit dem Erzbischof und Kurfürsten Balduin von Trier. Balduin belagerte schließlich die Burg, und die Eltzer ergaben sich, bevor die Burg zerstört werden konnte. Seither waren die Eltzer Lehensleute des Trierer Erzbischofs.
Bredelin und Eberwin hatten hier gleich drei Kunden. Seit über 200 Jahren lebten auf der Burg Eltz drei Linien der Eltzer in einer sogenannten Ganerbengemeinschaft5. Die Linien waren benannt nach den drei Brüdern Elias, Wilhelm und Theoderich, die die Stammesteilung damals beschlossen hatten.
Sie traten ein durch die auf drei Pfeilern ruhende gewölbte Vorhalle, durch die sich die Hoffront der Häuser öffnete.
Als die Herren von Eltz sich zur Begrüßung näherten, schickte Bredelin Bertram fort.
»Geh, setz dich irgendwo hin und warte, bis wir unser Geschäft erledigt haben.«