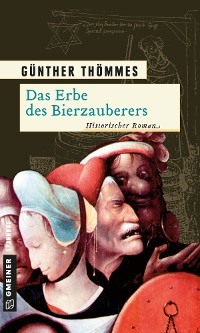Kitabı oku: «Das Erbe des Bierzauberers», sayfa 6
Der Kaiser auf Reisen
Schneller als beabsichtigt, zwangen zahlreiche verschiedene Angelegenheiten Kaiser Friedrich zu einer längeren Reise über viele Stationen.
Im Frühjahr 1475 setzte sich der kaiserliche Tross von Wiener Neustadt aus in Bewegung.
Neben dem Kloster Salem hatte auch Dijon in Burgund als eines der wichtigsten Reiseziele gegolten. Dort wollte Friedrich mit Karl dem Kühnen, dem Herzog von Burgund, die Verheiratung seines Sohnes Maximilian mit Maria von Burgund und auch die Besitzverhältnisse von Luxemburg verhandeln.
Dieses seltsame Staatengebilde, das sich Burgund nannte, hatte sich in den letzten 100 Jahren zu einem teilweise zersplitterten, teilweise aber auch kompakten Territorium gemausert, das vom Genfer See bis zum Oberlauf der Loire und nach Westfriesland reichte. Dort entfaltete das späte Mittelalter seine prächtigste Hof- und Lebenshaltung, nirgendwo sonst wurde so farbenprächtig gelebt und gefeiert wie in Burgund.
Als verbindende Landbrücke zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation weckte die Pracht Burgunds jedoch immer wieder Begehrlichkeiten als potenzielles Beuteobjekt. Und so war Karl der Kühne dabei sowohl meist Verteidiger seines Reiches als manchmal auch vorbeugender Aggressor und tummelte sich munter auf den Schlachtfeldern Zentraleuropas.
Daher hatte sich auch in der Zwischenzeit die Reiseroute des Kaisers geändert. Dijon wurde gestrichen. Karl der Kühne hatte im Juni 1474 begonnen, die Stadt Neuss zu belagern.
Und das, obwohl er zur gleichen Zeit, im November desselben Jahres, bei Hericourt von den Eidgenossen im Auftrag der Habsburger besiegt wurde.
»Wie kann dieser Tor zwei Kriege zugleich führen?« Friedrich war ratlos.
Auch die Neusser Belagerung, die im Zusammenhang mit der Kölner Stiftsfehde stand, bei der Karl den Erzbischof von Köln, Ruprecht von der Pfalz, unterstützte, wurde von Friedrich nicht gutgeheißen.
»Wir müssen diesen Narren wieder zur Räson bringen, bevor er noch größeren Schaden anrichtet«, sagte Friedrich mehr als einmal.
»Hat er aus Hericourt nichts gelernt?«
Da er mit leichtem Tross und wenigen Wachsoldaten reiste – er wollte schneller und beweglicher unterwegs sein –, hatte er seine Armee schon einmal nach Neuss vorgeschickt.
In Salem hatten sie ihren ersten längeren Aufenthalt. Das Stift im Linzgauer Hinterland des Bodensees war ein wohlhabendes Zisterzienserkloster und seit 1137 im Rang einer Abtei.
»Salem, ein schöner Name! Der biblische Ort des Friedens.«
Friedrich machte hier gerne Station.
Die politisch ehrgeizigen Äbte wussten, was sie an diesen hohen Besuchen hatten, und hofierten diese entsprechend. Die Bewirtung war wieder einmal erlesen. Die klostereigene Brauerei stellte ein passables Bier her, und die Klosterküche war für hohen Besuch auf Wild spezialisiert. Hirsch, Hirschkuh und Wildschwein gab es in solchen Mengen, dass die köstlichen Rebhühner nur beiläufig zur Kenntnis genommen wurden.
Auch hier wurde mit Leidenschaft über die Kochkunst diskutiert, und das ohne erhobenen Zeigefinger, da der saure Wein diesmal wegfiel.
»Diese grüne Sauce ist ein Geschenk des Himmels«, seufzte von Meldegg und tunkte einmal mehr ein großes Stück Weißbrot hinein.
»Was da wohl alles drin sein mag?« Friedrich aß zwar auch mit Genuss, ihm fehlten indes die Kenntnisse über die Zutaten.
»Wenn ich mich nicht täusche, Bohnenkraut, Minze, Sauerampfer und Mangold. Dazu erschmecke ich Wein, Essig und etwas Lebkuchen.«
Der fantasielose Friedrich war wieder einmal beeindruckt vom kulinarischen Genius seines Leibarztes.
Nach dem Essen ließ sich besser verhandeln. Satte Gäste waren leichter für Zugeständnisse zu gewinnen. Das wusste die Führung von Salem auch. Diesmal bat der Abt Johannes Stantenat den Kaiser um Erteilung von Privilegien. Diese betrafen in erster Linie die Autonomie des Klosters. Friedrich nahm die Anliegen zur Kenntnis und versprach, sich nach seiner Rückkehr darum zu kümmern. Dies sollte allerdings noch zehn Jahre dauern. Erst am 20. August 1485 besuchte Kaiser Friedrich III. das Kloster Salem wieder, brachte dafür aber erfreuliche Meldung bezüglich der Privilegien: »Mein Freibrief wird Euch gestatten, fortan von Euren Untertanen Steuern zu erheben und säumige Zahler selbst zu bestrafen. Des Weiteren dürft Ihr Euren Schutzvogt selbst wählen und wieder absetzen.«
Nachdem der Tross Salem wieder verlassen hatte, ging es Richtung Rhein, und nach zehn Tagen hatten sie Straßburg erreicht.
»So, jetzt wollen wir unseren treuen Straßburgern noch unsere Aufwartung machen, bevor wir uns mit Herzog Karl auseinandersetzen müssen.«
Friedrich besprach auch Regierungsdinge abseits von seinem Kanzler und seinen sonstigen Beratern gerne mit seinem Leibarzt.
»Was denkt ihr, Andreas, wie sollen wir die Verhandlung mit dem Burgunderherzog angehen?«
Reichlin von Meldegg zuckte die Schultern.
»Das hängt davon ab, was Ihr erreichen wollt. Wollt Ihr dem ›Großherzog des Westens‹« – er grinste bei Nennung dieses Titels, den der Parvenü sich selbst verliehen hatte – »eine Lektion erteilen dafür, dass er Euch vor zwei Jahren in Trier zuerst mit seinem Reichtum gedemütigt und dann noch die Königswürde und eine Krönungszeremonie abgeschwatzt hatte, zu der er dann schlussendlich nicht erschienen ist?«
Friedrich erinnerte sich, als wäre es gestern gewesen: 400 Wagenladungen kostbarer Wandteppiche, jede Menge Gold und Silber hatte Karl mitgebracht, um die Trierer Abtei Sankt Maximin in eine Mischung aus Palast und Schatzkammer zu verwandeln. Sein Schwert hatte allergrößtes Aufsehen erregt: Das vollständige Vaterunser prangte auf dem Schwertgriff, jeder einzelne Buchstabe bestand aus Diamanten. Die besten Musiker hatte er mitgebracht, Karl selbst war in einem prächtigen, juwelenbesetzten Mantel, durchwirkt mit goldenen Fäden, erschienen, und alles nur zu dem einen Zweck – so war es Friedrich erschienen –, um ihm, dem Kaiser, deutlich aufzuzeigen, was wahrer Reichtum bedeutet. Friedrich war am Ende dieser sinnlosen Demonstration ohne Gruß und Verabschiedung abgereist.
Der Leibarzt schaute auf den sinnierenden Kaiser und fuhr fort:
»Oder wolltet Ihr nicht doch Euren Sohn Maximilian erstklassig mit seiner Tochter Maria verheiraten?«
Friedrich, der allen anderen Menschen meist mit Misstrauen begegnete, fuhr aus seinen Gedanken hoch und lächelte.
»Ihr seid mit allen Wassern gewaschen. Wärt Ihr nicht so ein guter Leibarzt, als Berater könntet Ihr kaum besser sein. Da hätte sogar mein guter alter Kanzler Schlick noch etwas lernen können.«
Er zitierte sein Lieblingsmotto: »Mögen andere Kriege führen, du glückliches Österreich, heirate!«
Von Meldegg kam nochmals auf das Trierer Treffen zu sprechen: »Erinnert Ihr Euch noch an das Geschenk, welches Karl Eurem 14-jährigen Sohn überreichte?«
»Diese eigens für ihn angefertigte, mit Initialen und Wappen geschmückte, kostbare Kriegsordnung?«
»Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob er Euch damit seine Geringschätzung zeigen oder Maximilian Ehre erweisen wollte.« Er kratzte sich am Kopf.
»Nun, in dubio pro reo. Im Zweifel für den Angeklagten.«
Der Kaiser wechselte das Thema: »Was ist denn diese Maria von Burgund für ein Weib?«
Von Meldegg war wie immer bestens informiert.
»18 Jahre alt, sein einziges Kind. Lebte die ersten Jahre in ziemlicher Abgeschiedenheit auf der Festung Le Quesnoy. Nach der Trennung von den Eltern wurde das Kind in Gent am Hof des Grafen von Flandern erzogen. Sie wurde in allen für ihren Stand wichtigen Wissensgebieten unterrichtet und gilt allgemein als klug.«
»Auf ihre Rolle als mögliche Herrscherin wurde sie allerdings nicht vorbereitet«, warf Friedrich ein. »Soweit ich weiß, hofft Karl immer noch auf einen Sohn.«
»Das habe ich auch gehört«, lachte von Meldegg.
»Ach ja, da wäre noch etwas«, fuhr er fort. »Sie soll wunderschön sein!«
»Na, das wird meinen Sohn freuen, sollten wir zu einer Einigung kommen.«
Friedrich erklärte die Besprechung für beendet.
Von Meldegg verspürte ein trockenes Ziehen in der Kehle und machte sich auf in die Stadt.
Georg
Der Herbst des Jahres 1475 hatte in Straßburg früh begonnen und somit die Brausaison ebenso. Georg hatte von Daniel den Auftrag bekommen, eine neue Rezeptur auszuprobieren, die Daniel euphorisch ›Trippel‹ nannte.
»Mehr Malz allgemein, mehr geröstetes Malz, mehr Hopfen, da sollte ein wunderbares Bier herauskommen. Vorne süß, hinten bitter, in der Mitte voller Geist.«
Georg fragte nach, warum Daniel nur Hopfen nähme, er hatte mittlerweile in den paar Jahren bei Daniel auch über andere Rezepturen reden hören.
Daniel tat das nur kurz und schnell ab.
»Lass die anderen mit Fichten- und Tannensprossen würzen, der Hopfen ist das Beste, was die Natur uns bietet.«
Er schob noch nach:
»Und mach ja, dass der Trippel schön dunkel wird, am besten kohlrabenschwarz!«
So mühte sich Georg mit dem Maischescheit und bellte Befehle hinüber zum Feuer, wo sein Nachfolger die Biersteine erhitzte, als ein älterer Mann neben ihm auftauchte, den er noch niemals hier gesehen hatte.
Von vornehmer Gestalt, gekleidet wie ein Edelmann, wich Georg verschüchtert zur Seite, um ihn vorbeizulassen, wo immer er hinwollte.
Der Mann machte jedoch keine Anstalten, vorbeizugehen.
»Was schaffst du da Köstliches?«, fragte er Georg.
»Ein Bier, Eure Herrschaft!« Georg wusste nicht einmal, wie er den hohen Herrn richtig anreden sollte.
Dieser lachte. »Ein Bier! Das sehe ich auch. Ich meine, was für ein Bier?«
Georgs Mut kehrte zurück. Der Herr schien ihm nichts Böses zu wollen.
»Ein ›Trippel‹, so nennen wir das. Das wird ein neues Bier, und wir hoffen, dass die Leute wie verrückt danach sein werden.«
»Bist du hier der Brauherr?«
»Oh, nein. Verzeiht, wenn ich den Eindruck erweckt habe. Ich bin lediglich der Brauerbursche Georg. Der Brauherr ist Daniel Fischer. Er ist im Moment in der Küche und sieht nach den Speisen.«
»Habe ich diesem Daniel also nicht nur dieses herrliche Bier zu verdanken« – erst jetzt sah Georg, dass der Herr einen Krug in der Hand hielt, aus dem er einen genüsslichen Zug nahm –, »sondern auch dieses köstliche Hasengericht mit Wein, Schweinebauch, Nelken, Pfeffer, Thymian und Pumpernickel?«
»Ja, Herr, ich braue hier alles nach Daniel Fischers Rezepturen. Er ist der Herr von allem hier. Obwohl …« Er zögerte, ob es einem Fremden gegenüber nicht zu vorlaut klang, »… ich könnte das Bier auch allein machen. Ich bin ja bereits seit vielen Jahren hier und habe viele Rezepturen bereits gebraut. Sagt es aber bitte nicht weiter.«
Andreas Reichlin von Meldegg lachte leise und hatte in diesem Moment eine Idee.
»Möchtest du irgendwann einmal ein eigenes Brauhaus führen?«
»Möchten gerne, aber ich kann nicht lesen und schreiben und bin kein Bürger und nur ein Waisenkind.« Mittlerweile war er sich seiner Defizite bewusst geworden.
»Das können wir ändern.«
Der Leibarzt des Kaisers stellte sich neben den Bottich und wartete ab, bis Daniel aus der Küche zurückkehrte.
Zuerst erschien Sonja, was von Meldegg zu einem anerkennenden Kopfnicken veranlasste.
Bald darauf kam Daniel, von Meldegg stellte sich vor und erklärte seinen Plan. Die Verhandlung mit Daniel war kurz. Erst schien es, als sollte der alte Jähzorn wieder hochkommen, der in seinen jungen Jahren jeden Streit begleitet hatte.
Dann sah er die Münzen, die von Meldegg aus dem Beutel kullern ließ, und grinste.
Georg, bereits wieder bei der Arbeit, sah nur, wie beide einander die Hände schüttelten.
Er ahnte, dass sich sein Schicksal soeben geändert hatte. Wie, das erklärte Daniel ihm nach getaner Arbeit.
»Heute ist dein Glückstag, Junge!« Daniel redete gar nicht erst um den heißen Brei herum.
»Der Herr war Andreas Reichlin von Meldegg, Leibarzt des Kaisers. Des Kaisers! Verstehst du?« Seine Stimme wurde schrill.
»Und er möchte dich nach Österreich an den Hof des Kaisers mitnehmen. Damit du ein Bier braust, mit dem der Kaiser seinen sauren Wein ersetzen kann.«
Seine Aufregung war echt.
»Er fragte erst, ob ich mitgehen wolle. Ich kann aber mein Brauhaus hier nicht aufgeben. Daher habe ich ihm dich versprochen.«
Georg verstand nicht alles sogleich. Er sollte jetzt verreisen?
»Der kaiserliche Tross reist noch weiter rheinabwärts. Auf der Rückkehr, in etwa drei bis vier Monaten, wird von Meldegg dich hier abholen und mitnehmen. In der Zwischenzeit soll ich dich noch in alles einweisen, was du vielleicht noch nicht weißt. Und ich soll aufschreiben, was man zum Betrieb eines Brauhauses an Gerätschaften benötigt.«
Er klopfte Georg auf die Schulter.
»Junge, Junge, so jung und schon kaiserlicher Brauer! Und lesen und schreiben will er dich auch lehren. Ich sage ja, heute ist dein Glückstag!«
Georg war nicht sicher, ob er dieser Einschätzung zustimmen sollte.
Ein wenig Angst hatte er schon.
Ein paar Monate in Straßburg hatte er ja noch …
Aufbruch
Der Kaiser verbrachte zwei Wochen in Straßburg. Von dort begab man sich auf ein Schiff und fuhr rheinabwärts Richtung Neuss, das seit Juli 1474 von Karl dem Kühnen belagert wurde. Die Nachrichten, die mittlerweile mit schöner Regelmäßigkeit rheinaufwärts kamen, klangen dann allerdings beruhigend. Da die Neusser tapfer Widerstand geleistet hatten, bis Friedrichs Armee auf der Bildfläche erschienen war, hatte Karl die Stadt nicht einnehmen können. Und im Juni, nach einem Jahr der Belagerung, hatte Karl der Kühne schließlich aufgegeben. Was sicher auch damit zu tun hatte, dass seine Soldaten zwischendurch immer wieder einmal ihre Kampfhandlungen unterbrochen hatten und zum Grab des heiligen Quirinius in Neuss gepilgert waren. Dort hatten sie gebetet und geopfert, danach wurde wieder fröhlich weitergekämpft.
Friedrich hätte eigentlich frohlocken sollen, wieder einmal war der Kaiser ein Rätsel für die Menschen in seiner Umgebung. Seine kleinen, tief liegenden braunen Augen verrieten Unschlüssigkeit und alles andere als Freude.
Sein optimistischster Kommentar war noch:
»Das wird dem alten Hitzkopf eine Lehre sein!«
Von Meldegg ergänzte:
»Und es schwächt seine Position für die Heiratsverhandlungen.«
Dem konnte Friedrich nur zustimmen.
Als Treffpunkt für die Verhandlung schlug Friedrich Trier vor. Immer wieder hielt das Schiff an, um Nachrichten abzugeben oder aufzunehmen. Die Kuriere Karls und Friedrichs ritten hin und her und sich die Hintern wund, bis eine Einigung erzielt war.
»Wir sind den Trierern ja noch etwas schuldig, da wir die Krönung Karls vor zwei Jahren abgesagt haben.«
Auch hierzu hatte der kaiserliche Medikus ein Bonmot parat:
»Erinnert Ihr Euch noch, dass Karl in seinem Triumphgefühl bei den Trierer Handwerkern bereits eine Königskrone in Auftrag gegeben hatte? Da war die Enttäuschung groß gewesen, nachdem diese Träume zerplatzt waren und er die Krone abbestellte.«
Er lachte schelmisch, der Kaiser schwieg dazu.
Friedrich war meist auf Ausgleich bedacht, und Trier war außerdem gewissermaßen neutrales Gebiet, da der Erzbischof von Trier, der ebenfalls Kurfürst war, sich von niemandem dreinreden ließ.
»Ob der Erzbischof nach meiner Abreise wohl alle Rechnungen bezahlt hat, wie ich es ihm aufgetragen hatte«, fragte Friedrich, jedoch mehr als Selbstgespräch. »Ich habe auf jeden Fall niemals eine Rechnung von ihm erhalten. Also hat er noch etwas gut bei mir!«
Und außerdem wollte Friedrich dort die zwei Jahre zuvor gegründete Universität besuchen.
Das Treffen in Trier Anfang Oktober 1475 verlief, im Gegensatz zu dem von Karl mit großem Aufwand inszenierten Treffen zwei Jahre zuvor, ohne großen Pomp. Maximilians Schwiegervater in spe, angetreten als frisch Besiegter zweier sicher geglaubten Schlachten, war nicht in Streitlaune.
Schnell wurden die Modalitäten vereinbart. Die Hochzeit wurde für August 1477 festgelegt.
Karl der Kühne ließ keinen Zweifel daran, warum er so schnell zugestimmt hatte.
»Ihr werdet noch sehen, was Ihr mit Marias Taufpaten, König Ludwig XI., für eine Freude haben werdet. Er ist ein heimtückischer und herrschsüchtiger Charakter und hat es bereits auf mein Burgund abgesehen. Sogar seine Untertanen nennen ihn ›Den Grausamen‹!«
Er sah Friedrich genau in die Augen.
»Aber wenn jemand mein Burgund für meine Tochter verteidigen kann, so ist es Eure habsburgische Landesmacht.«
Dann trennten sich ihre Wege.
Karl reiste zurück nach Dijon, Friedrich doch noch nach Neuss.
Denn trotz dieser Abmachung hatte Friedrich noch eine kleine Rache für Karls Neusser Angriff parat. Die Stadt Neuss erhielt aus Friedrichs Hand das Münzprivileg, das Recht, mit rotem Wachs zu siegeln, die Rechte einer Hansestadt sowie ein neues Wappen. Fortan war er dort sehr gerne gesehen.
Von Neuss aus reiste Friedrich auf kürzestem Wege zurück nach Wiener Neustadt. Der Winter nahte, und da waren lange Reisen mühsam.
Von Meldegg fuhr rheinaufwärts, legte in Straßburg an und holte Georg ab.
Der Abschied von Daniel war bewegend. Wenn jemand Georg ein paar Jahre früher erzählt hätte, dass er bei der Trennung von Daniel Fischer Tränen in den Augen haben würde, den hätte er ausgelacht. Auch Sonja hatte ihn mittlerweile lieb gewonnen wie einen Sohn und weinte hemmungslos. Sie bat darum, Fafnir behalten zu dürfen.
»Damit wir eine Erinnerung an dich haben.«
Georg zögerte, von Meldegg aber meinte auch, die Reise, jedoch erst recht das Leben am Hof würden Fafnir nicht guttun.
»Hier in der Braustube fühlt er sich zu Hause. Also lass ihn hier.«
Schweren Herzens gab Georg nach, umarmte Daniel und Sonja.
»Gib uns Nachricht, wie es dir ergeht! Oder komm uns einmal besuchen!«
Beide hatten keine Ahnung, wie dieser Wunsch in Erfüllung gehen würde.
Zu zweit ließ sich schneller reisen, nur in gefährlichen Gegenden schlossen sie sich einer bewaffneten und eskortierten Reisegruppe an.
Als sie nach Überlingen kamen, blieben sie ein paar Tage dort und ruhten sich aus.
Hier erkannte Georg zum ersten Mal die Möglichkeiten, die man als Angestellter eines Kaisers haben konnte: Herr von Meldegg besaß ein eigenes Schloss!
»Das Schloss hat meine Familie erst vor fünf Jahren fertiggestellt und es ist unsere Stadtresidenz«, erklärte der Leibarzt. »Ich bin so viel auf Reisen, da möchte ich wenigstens wissen, wo ich daheim bin, wenn ich einmal Ruhe habe.«
Georg war so beeindruckt von Haus und Garten, dass er es nicht verbergen konnte.
»Die Gartenanlage hat einen Ausblick sowohl auf die Stadt wie auch auf den See.«
Auch von Meldegg war sichtlich stolz auf seine Residenz.
Bald rüsteten sie wieder zur Weiterreise. Unterwegs redeten sie viel, von Meldegg versuchte hier bereits, Georg etwas Bildung zu vermitteln, sodass er als Brauer am Kaiserhof bestehen konnte.
»Lesen und Schreiben ist wichtig, aber nicht alles. Auch in der Sprache musst du gewandter werden«, erklärte er Georg.
»Der kaiserliche Hof ist nicht so streng zeremoniell wie andere Fürstenhöfe. Aber dennoch eine Schlangengrube. Voller Günstlingswirtschaft, Verleumdungen und falscher Freunde. Sei also gewarnt! Wenn du zu gutgläubig bist, wirst du dort nicht bestehen.«
Die Worte erinnerten Georg einmal mehr an Michels Warnungen und seine ständige Angst davor, ›behumst‹ zu werden.
»Ist die Welt wirklich so schlecht«, dachte er bei sich.
Nun, er war zumindest vorgewarnt.
Ein gutes Stück reisten sie per Schiff auf der Donau, das Wetter war auf ihrer Seite, und mit Unterricht im Lesen und Schreiben verging die Zeit schneller als erwartet.
So erschienen sie im März 1476 auf Kaiser Friedrichs Burg in Wiener Neustadt.
Junge Freundschaft
Georg, mittlerweile 18 Jahre alt, war nun bereits einige Monate lang kaiserlicher Brauer in der Residenz Wiener Neustadt und glücklich wie noch nie zuvor in seinem Leben.
Von Meldegg hatte seine Beziehungen spielen lassen und all die Gerätschaften, die Daniel akkurat beschrieben hatte, ohne Ausnahme besorgen lassen: Langarmige Zangen für die Biersteine, hölzerne Ascheschaber, Schöpfkellen, Maischescheit, alles war vorhanden.
Georg glaubte, die feinste Brauerei im ganzen Heiligen Römischen Reich zu ›besitzen‹. Ihr waren sogar eine Malztenne, eine Malzdörre, eine Getreidekammer und eine Fässerkammer angeschlossen. Das Brauhaus bestand aus einem Maischebottich, der hier in Österreich ›Maischschaff‹ genannt wurde und der auch als Läuterbottich diente, einem Brühschaff zum Aufbrühen des Hopfens und einem Schaff mit verzapfter Bodenöffnung, unter der ein Fangtrog und eine Rinne angebracht waren. Da lief dann die fertige Bierwürze in den Gärbottich.
Georgs Lohn betrug 30 Pfennige am Tag, acht Pfennige mehr als zum Beispiel ein erfahrener Maurergeselle bekam. Dafür hätte er sich jeden Tag zwei Hühner leisten können. Das tat er natürlich nicht, sondern legte fleißig Geld zur Seite.
»Wer in Armut aufgewachsen, wird niemals zum Verschwender!« Diesen Spruch aus der großen Sprüchesammlung des Baders Michel behielt er zeitlebens im Hinterkopf.
Man hatte ihm drei Brauburschen an die Seite gestellt, die ihm beim Mälzen und beim Sieden zur Hand gingen. Der älteste von ihnen, Winand, hatte schon reichlich Erfahrung mit Steinbierbrauen. Er kam aus Hirt in Kärnten, wo dies seit über 200 Jahren Praxis sei, wie er zu betonen nicht müde wurde. Dennoch akzeptierte er Georg als Vorstand der Brauerei. Die beiden Jüngeren, Otto und Rembold, kamen nur bei Bedarf hinzu. Ansonsten mussten sie in der Küche arbeiten und sogenannte ›Bengelarbeit‹ verrichten, Fische ausnehmen, Bratspieße drehen oder Geflügel rupfen.
Als Quelle für die Biersteine hatten sie einen Platz am Ufer des Leithaflusses gefunden, an dem es reichlich Grauwacke gab. Diese Steine barsten beim Eintauchen in die Würze nicht, auch wenn sie glühend heiß waren.
Um Kundschaft brauchte sich Georg auch keine Sorgen zu machen: Er braute nur für den Hof, da gab es viele durstige Seelen. Friedrich und sein Leibarzt waren nicht die Einzigen, die den Wein leid waren, der so sauer war, dass er die Schnauzen der Zinnkannen zerfraß. Der Trupp der tschechischen Söldner mit den unaussprechlichen Namen, der für die Sicherheit des Hofes garantieren sollte, war immer durstig und gab sich bisweilen heftigen Trinkgelagen hin.
Da Trunkenheit wie überall, so auch hier am Hof, sowieso als aristokratische Tugend galt, hatte er also immer reichlich zu tun.
Wiener Neustadt war zu dieser Zeit das glanzvolle urbane Zentrum Österreichs, durch seine Nähe zum Balkan lag es im Brennpunkt der strategischen Planungen sowohl der Ungarn als auch der Türken und der österreichischen Kleinherrscher. Mit ihrer zwölf Meter hohen und zweieinhalb Kilometer langen Stadtmauer galt die Residenz als uneinnehmbar, zumal die Bewohner der Stadt auf Anordnung Lebensmittel für mindestens ein Jahr zu horten hatten, um einer eventuellen Belagerung zu widerstehen.
Georg liebte die ausgedehnten Parkanlagen voller Obstbäume, Blumenbeete, Fischteiche und Tiergehege. Ebenso genoss er die Aussicht von der Burg über das Steinfeld, den südlichen Teil des Wiener Beckens, und auf die Voralpen, die Hohe Wand und den Schneeberg im Süden und Westen. Schnell hatte er das pannonische Klima schätzen gelernt, mit warmen und trockenen Sommern, dafür kalten, jedoch ebenso trockenen Wintern.
Wenn er etwas in Süddeutschland und Straßburg gehasst hatte, so war es der ständige Regen gewesen.
Die Stadt selbst kam ihm vor wie das Paradies, obwohl auch Straßburg schon ansehnlich gewesen war. Hier jedoch waren die Straßen gepflastert, Bettler, fremde Kinder und ›untaugliches Volk‹ auf Anordnung von oben aus der Stadt verjagt worden. Die Kirchen durften nicht barfuß betreten werden, sogar die Schweine mieden auf höchste Anordnung die Straßen und suhlten sich anderswo. Da ließ es sich leben!
So braute Georg vor sich hin, probierte verschiedene Rezepturen aus. Er hielt sich an die Vorgabe Daniel Fischers, nur mit Hopfen zu würzen. Ansonsten aber braute er auch mit anderem Getreide, nahm neben Roggen, Gerste und Weizen auch Emmer, Einkorn und Buchweizen, gelegentlich Rispenhirse oder Dinkel und erhielt dabei die unterschiedlichsten Resultate. Manchmal beschwerten sich die Höflinge, dann gelobte er Besserung. Manchmal kam Reichlin von Meldegg persönlich vorbei und gratulierte ihm zu einem besonders gelungenen Wurf. Dies vermerkte Georg dann in einem Buch. Das Schreiben klappte immer besser, anfangs konnte Georg seine eigene Schrift nach ein paar Tagen nicht mehr erkennen.
Kaiser Friedrich ließ sich anfangs nicht blicken, der hatte andere Sorgen.
Obwohl von Meldegg Georg mehrmals das kaiserliche Wohlwollen übermittelte.
»Seine Säfte fließen wieder besser, seine Verdauung ist regelmäßiger, und seine Leibschmerzen haben fast ganz aufgehört.« Georg vernahm es mit Befriedigung.
Das wichtigste Lob aber für seine Ohren kam immer von Kunigunde, der Tochter von Kaiser Friedrich III.
Sie war das schönste Mädchen, das Georg jemals gesehen hatte, mit einem weißen, ebenmäßigen Gesicht, rehbraunen Augen, langen Haaren und zarten Händen. Und obwohl erst elf Jahre alt, kam sie regelmäßig in seine Brauerei. Sie musste dies eher heimlich machen, da es als unfein galt, und sie sollte doch die Erziehung einer Prinzessin genießen.
Als sie zum ersten Mal in der Brauerei erschienen war, dachte Georg noch, sie hätte sich verirrt, und hatte sie, da er sie nicht erkannt hatte, mit barschen Worten hinausgeschickt.
»Ich habe mich nicht verlaufen. Ich will mir das Brauhaus ansehen«, hatte sie patzig zurückgeschossen.
Bei Interesse an seinem Brauhaus wird ein jeder Brauer weich, und so hellte sich auch Georgs Miene auf. Er versuchte, Kunigunde mit einfachen Worten zu zeigen, worauf es beim Bierbrauen ankam, was man falsch machen konnte und wie sich ein gutes von einem schlechten Bier unterschied.
Dann zeigte er sein Rezeptbuch, deutete auf eine Notiz darin und sagte lachend:
»Das ist des Kaisers Lieblingsbier. Da muss er am wenigsten furzen!«
»Du redest sehr respektlos über meinen Vater!«
Nun war es heraus!
Da Kunigunde sich nicht vorgestellt hatte, hatte Georg sie für eines der zahllosen Kinder der Höflinge oder Minister gehalten, die immer durch die Burg tollten.
Ihm rutschte das Herz in die Hose.
»Bitte verzeiht mir. Ich wusste nicht, dass …«
Kunigunde schnitt ihm das Wort ab.
»Lass nur, ich lache auch immer über seine Blähungen, zumindest wenn er oder sein Leibarzt nicht dabei sind.«
Nun lachten beide, Georg stellte sich auch vor.
»Das weiß ich doch«, sagte Kunigunde, die häufig an der Tafel ihres Vaters speiste.
»Beim Essen hat der Leibarzt viel erzählt, wie er dich gefunden hat, wie ihr zusammen gereist seid und wie er dich Lesen und Schreiben gelehrt hat. Er ist sehr stolz auf dich, jedoch auch auf sich selbst.«
Bei den nächsten Besuchen fragte sie ihn weiter aus. Georg hatte auch Daniel Fischers Rezept für die berühmte Biersuppe mitgenommen. Die stand nun regelmäßig auf dem Speiseplan, als Frühstück für die Kinder.
Auch Kunigunde liebte diese Suppe.
Manchmal brachte sie Georg aber auch etwas zu essen ins Brauhaus. Georg mochte besonders den Obstbrei, der mit Honig und Pfeffer gewürzt war.
Im Laufe der nächsten Monate wurden sie gute Freunde. Wenn Kunigunde in Wiener Neustadt weilte, besuchte sie ihn. Anfangs brachte sie manchmal ihre besten Freundinnen und Gespielinnen mit, die Schwestern Rosina und Sigune von Kraig, die, gleich alt wie Kunigunde, der Brauerei und Georg jedoch nicht das geringste Interesse entgegenbrachten.
Nach einer Weile kam sie wieder allein, dann spottete sie über Rosina.
»Mein Bruder Maximilian bildet sich ein, sich in sie verliebt zu haben. Und jetzt hält sie sich schon für eine Erzherzogin.«
Auch ihre Hofmeisterin Else Pellenhofer wurde gelegentlich Opfer ihrer spitzten Zunge.
»Bauerntrampel«, schimpfte sie. »Und so was soll mich erziehen. Sie und ihr Mann Hans gehören in einen Kuhstall, nicht an einen Fürstenhof!«
Georg kannte die Pellenhoferin nur vom Sehen, dünkelhaft und geflissentlich ignorierte sie den kleinen Brauerburschen und sah ihn wohl nicht als passenden Umgang für ihren Zögling. So stahl sich Kunigunde meist davon, wenn sie in die Brauerei kam, und schimpfte über ihre Erziehung.
»Vom Lesen und Schreiben wollen sie mir nur das Nötigste beibringen. ›Zu viel Lernen kostet dich Kraft und Gesundheit, mein Liebes‹, sagt die Pellendorferin. ›Und vermindert deine Anmut!‹ Sticken und Nähen soll ich lernen, Reiten, Waidwerk und Haushaltsführung.«
Georg wusste nicht, was daran schlecht sein sollte, er sollte aber noch oft genug ihren wachen Geist und ihren robusten Charakter kennenlernen, aus dem sich mit den Jahren zwei herausragende Eigenschaften über allen anderen ausbilden sollten: Eine tief gehende, ungeheuchelte Frömmigkeit und eine geradezu klassische, aristokratische Tapferkeit.
Sie verbrachte aber auch viel Zeit in Graz, weil ihr Vater nicht viel Zeit für sie hatte und, wie sie Georg bald erzählt hatte, ihre Mutter, Eleonore von Portugal, vor Jahren schon verstorben war.
»Ich war erst zwei Jahre alt, als sie starb, an einer Krankheit der Eingeweide, so wurde mir erzählt. Sie soll eine sehr schöne Frau gewesen sein, ihr Vater war der König von Portugal.«
»Nun weiß ich auch, woher du deine Schönheit hast.«
Georgs Kompliment ließ Kunigunde erröten.
Sie fuhr fort:
»Meine Mutter liebte den Tanz, das Spiel und die Jagd. Das sind nun Dinge, die mein Vater verachtet. Sie hatte mich wie auch meine fünf Geschwister, von denen vier bereits als Kind gestorben sind, immer mit süßen Naschereien aus Portugal verwöhnt.«
Manchmal brachte sie solche Süßigkeiten mit, Naschereien, von denen Georg keine Ahnung hatte, dass es so etwas gab.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.