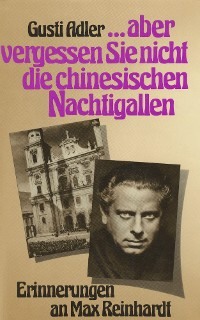Kitabı oku: «"...vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen."», sayfa 5
Von seinen Zeichnungen ist leider wenig erhalten. Sie ergänzten seine Regiebemerkungen, die naturgemäß auch Zeichen für begleitende Musik einschlossen. Er hatte Zeichen für Schweigen, für Pausen, Lärm und Steigerung. Seine Regiebücher gleichen Partituren. In den Notizen für seine Selbstbiographie fand sich Reinhardts eigene Beschreibung der Arbeit an einem Regiebuch:
Das Regiebuch. Man liest ein Stück. Manchmal zündet es gleich. Man muß vor Aufregung innehalten im Lesen. Die Visionen überstürzen sich. Manchmal muß man es mehrfach lesen, ehe sich ein Weg zeigt. Manchmal zeigt sich keiner. Dann denkt man an die Besetzung der großen und kleinen Rollen, erkennt, wo das Wesentliche liegt. Man sieht die Umwelt, das Milieu, die äußere Erscheinung. Manchmal muss der Schauspieler der Rolle angepaßt werden, wenn das möglich ist. Manchmal die Rolle dem Schauspieler. Das gelesene, das gespielte Stück. Niemals eine absolute Congruenz. Idealfall, wenn der Dramatiker für seine Schauspieler schreibt, ihnen die Rollen auf den Leib schreibt. Shakespeare, Molière (für sich selbst), Nestroy, Scholz. Der Dramatiker als Regisseur. (Die Franzosen.) Die Objektivität fehlt. Schließlich hat man eine vollkommene optische und akustische Vision. Man sieht jede Gebärde, jeden Schritt, jedes Möbel, das Licht, man hört jeden Tonfall, jede Steigerung, die Musikalität der Redewendungen, die Pausen, die verschiedenen Tempi. Man fühlt jede innere Regung, weiß, wie sie zu verbergen und wann sie zu enthüllen ist, man hört jedes Schlucken, jeden Atemzug. Das Zuhören des Partners, jedes Geräusch auf und hinter der Szene. Der Einfluß des Lichtes. Und dann schreibt man es nieder, die vollkommenen optischen und akustischen Visionen wie eine Partitur. Man kann kaum nachkommen, so mächtig drängt es an, eigentlich geheimnisvoll, ohne Überlegung, ohne Arbeit. Begründung findet man später. Man schreibt es hauptsächlich für sich. Man weiß gar nicht, warum man das so oder anders hört und sieht. Schwer aufzuschreiben. Keine Noten für Sprechen. Erfindet seine eigenen Zeichen. Der gute Schauspieler, den man kennt, steht vor einem. Man komponiert ihn hinein, weiß, was er machen kann und wie und was er nicht kann. Man spielt alle Rollen. Dann liest man das Geschriebene vor der Probe durch, ändert das und jenes, fügt hinzu. Aber das ist gewöhnlich wenig. Man spricht mit den Schauspielern über ihre Rollen, sagt das Wesentliche. Dann kommt die Leseprobe. Man sagt keine Details, nur denen, die man schon genau kennt. Aber man macht ihnen Lust. Kardinalfrage: sie müssen glücklich sein, freudig, zuversichtlich, müssen an sich, ihre Rolle glauben – auch der, der die kleinste hat. Man hört zu, kriegt neue Ideen; mancher Zufall spielt mit. Manche ärgern sich. Sind wütend über ihre Rollen. Einige lachen, weinen außerhalb ihrer Rollen. Man belauert sie, fischt, hält fest. So müssen Sie schreien, schweigen, aufbrausen in dieser und jener Szene, wie Sie es jetzt getan haben, als Sie sich über die Rolle beklagt haben. Man verhaftet Tonfälle, Bewegungen, spioniert. Manche wollen Hintergründiges hören, tiefere Absichten. Viele wollen nur edle Charaktere spielen. Ein großer Schauspieler lehnt den Cassius im Cäsar ab, weil er »Dreck am Stecken« hat. So was kann er und will er nicht machen. Einige haben eigene Ideen, wollen den lustigen Teufel durchaus als gefallenen Engel spielen. Tragisch, großartig. Man nickt interessiert, bestätigend. Die einzelnen Auffassungen haben selten irgendeine Wichtigkeit, aber man nimmt sie wichtig. Man läßt sich überzeugen. Manche spielen gleich etwas vor. Das ist schon wichtiger, interessanter und oft irgendwie zu verwerten. Dann kommen Proben, in denen die Schauspieler lesen. Manche lesen lange, lernen schwer. Man sagt die Stellungen, spricht über die Absichten des Dichters, legt Tempo, das allgemeine fest. Dann überläßt man am besten einige Proben dem Assistenten. Das ist gut. Der Schauspieler fühlt sich freier, weniger bedrängt. Der Assistent überwacht den Text, die Stellungen, die Hauptaktionen und läßt die Schauspieler möglichst ihre eigenen Wege laufen. Diese ersten, zweiten, dritten, vierten Proben sind meistens langweilig. Kampf mit dem Text, mit dem Gedächtnis. Dann kommt man, hört zu. Manches ist neu, interessant, persönlich geworden. Man ändert, verwirft, baut manches neu auf. Man hat von vielem ein neues Bild, spricht mit dem Autor, findet heraus, was für den und jenen Schauspieler geändert, gestrichen oder neu aufgebaut werden muß. Alles ist im Fluß. Nun beginnt die Arbeit. Man rückt mit den Einzelheiten heraus, probiert, legt fest. Über die Bereicherung des Tonfalls, der Melodie der Sprache. (Das Tempo von Kainz. Rasend, ohne Interpunktionen. Phänomenales Gedächtnis. Jüdischer Tonfall. Ich kann, Sie müssen. Das ist der Unterschied. Tonfälle und Gebärden der Duse und ihr Einfluß auf nordische Schauspielerei. Rossi, Novelli. Die heisere Stimme in der Erregung. Das gleichzeitige Sprechen. Die Pausen: Lears Erwachen, Cordelia. Antoine [Gespenster]: Gänge um das Zimmer. Einwirkung auf Hauptmann.) Die Bedeutung der Pause: das Wichtigste im Sprechen wie das Stehenbleibenkönnen das Wichtigste beim Skilaufen ist. Ein Pferd zügeln. Die Steigerung nach unten. Die vollkommene Auflösung der Interpunktion. Komma: undramatisch, akademisch, buchmäßig. Das Dramatische ist der Punkt mitten in einem Satz. Das Denken, das Bilden eines Gedankens. Seine Entstehung, das Suchen nach Worten, namentlich, wenn sie ungewöhnlich sind. Das Zuhören. Das In-die-Augen-Sehen. Wie es den Ton verändert. Wie Füße, Hände, Blicke reden. Das Gehenkönnen in der Erregung. In der Ruhe. Der Stellungswechsel. Das Spielen mit dem Requisit. Möbel, Tische, Stühle, Wände einbeziehen als Ausdrucksmittel. Nichts Zufälliges. Kein Möbel, das nicht mitspielt, nur als Dekoration verwendet wird. Da jede Bewegung, jeder Blick, jeder Gang, jede Pause etwas bedeuten und ausdrücken muß, keine zufälligen, nichtssagenden Blicke, Gänge, Bewegungen, Pausen. Äußerste Sparsamkeit wie mit dem Wort, dessen letzte Knappheit eine Vorbedingung für das Drama ist. (In der Oper noch weniger Bewegungen.) Deutlichkeit, Plastik, Monumentalität. Die Schauspieler haben alles mitzuteilen. »Sie müssen alles ausplaudern« (Shakespeare), wenn auch nicht vorzeitig. Jago darf nicht als Schuft wirken (der er ist, nur aus eingeborener Lust am Bösen, ohne sichtlichen Gewinn für sich selbst), sondern als grober Biedermann, Brustton, der kein Hehl aus seinem Herzen machen kann. Ein wirklicher Säufer, der dem Laster des Trunks ergeben ist, darf nicht torkeln. Er bemüht sich, sein Laster zu verbergen. Er ist korrekt gekleidet und versucht besonders nüchtern und beherrscht zu wirken. Der Professor bei Krafft-Ebing vor den Studenten (Munch). Nur der den Narren spielt, will närrisch wirken. Der wirkliche Narr erscheint zunächst gar nicht närrisch. Irgendeine zufällige Wendung, eine plötzliche, unerwartete und unbegründete Erregung verrät ihn. Der Ausdruck der Gemütsbewegung bei Kindern und Tieren …
Man versucht das und jenes, hält sich nie eigensinnig an das, was man aufgeschrieben hat, bleibt offen für alles, schon um dem Schauspieler den weitesten Spielraum zu geben und um ihm vor allem Lust und immer wieder Lust zu machen. Denn dann wird er am besten sein. Kritik ist eine gefährliche, oft tödliche Waffe. Brahm hatte fast immer recht. Er war der beste, fast unfehlbare Kritiker. Aber er deprimierte. »Legen Sie großen Wert auf die Nuance? Lassen Sie sie weg.« Der Schauspieler ist ein Mondwandler. Er spaziert im Traum an gefährlichen Abgründen.
Max Reinhardt wiederholte sich nie. Er komponierte dramatischen Konflikt, von Musik und Licht getragen, in den jeweiligen Raum. Die gigantischen Dimensionen der Olympia Hall bedingten eine andere Auffassung des Mirakels als spätere Aufführungen in anderen Räumen. Dort wohnten 10 000 Menschen Tag für Tag dem Schauspiel bei. Die einfache Legende entrollte sich in einer Arena, die mit ihrem Schaugepränge wie ein mittelalterlicher Gobelin den Hintergrund für die aufregende Traumhandlung bildete. Mirakel-Gastspiele in allen großen Städten Europas folgten dem Triumph der Uraufführung in England. 17 Aufführungen, die Variationen über das ursprüngliche Thema darstellen. Ein Gastspiel in Amerika – New York – war für den 9. Dezember 1914 angesetzt. Der Erste Weltkrieg brachte diesen Plan zum Scheitern. Neun Jahre später griff Morris Gest, der amerikanische Theaterunternehmer, das Projekt wieder auf, und der glanzvollen Premiere im Century Theatre am 15. Januar 1924 folgte eine Tournee, die, mit Unterbrechungen, bis 1930 die Vereinigten Staaten durchquerte. Norman Bel Geddes, der geniale amerikanische Bühnenbildner, schuf die Dekorationen. Sein Vorläufer war Ernst Stern, und später, in Wien, zog Max Reinhardt einen der größten Bühnenbildner, Oskar Strnad, heran. Die letzte Aufführung des Mirakels fand 1932 in London statt. Abermals war es Cochran, der Reinhardt dazu bewog.
Die Wiederholung bestimmter Werke zieht sich durch Reinhardts Leben. Angefangen vom Sommernachtstraum, den er in immer neuen Fassungen herausbrachte, Faust, Goldoni, Tolstoi und zahllose andere, von ihm immer wieder aufs neue durchblutet und seinen Zeitgenossen nahe gebracht. Jedermann ist das einzige Stück, an dem Reinhardt, nach der Entdeckung für den Domplatz in Salzburg, nie mehr gerührt hat. (Mit Ausnahme eines kleinen Experimentes mit moderner Kleidung in seiner Schule in Hollywood.) Der Dom von Salzburg als Hintergrund für den Jedermann ließ sich eben auf einer Bühne nicht ersetzen. Dieser Schauplatz war ein einmaliger Fund. Reinhardt hat darüber immer wieder gesagt: »Ein Erfolg wie der Jedermann ist etwas derart Seltenes: nicht daran rühren!«
Die Wiederholung gewisser Inszenierungen motiviert er in seinen Notizen:
Warum immer dieselben Stücke – Sommernachtstraum, Faust, Goldoni, Tolstoi? Würde man aufhören wollen, immer wieder die Neunte, die Fidelio-Ouvertüren, gewisse Stücke von Mozart, Bach, Haydn zu spielen? Diese Werke sind unerschöpflich, und es ist in ihnen mehr Neues als in neuen Stücken, die viel Geschrei machen, aber im nächsten Winter ganz still und tot für immer sind.
1914
Der Winter dieses verhängnisvollen Jahres war für Reinhardt durch die Arbeit an seinem Shakespeare-Zyklus überaus fruchtbar. Glanzvolle Inszenierungen in den Kammerspielen – Scheiterhaufen von August Strindberg, Vom Teufel geholt von Knut Hamsun, Der Snob von Carl Sternheim und Die gelbe Jacke von George Cochran Hazelton und J. Harry Benrimo – ließen auch zeitgenössische Autoren zu Wort kommen. Nach der anstrengenden Arbeit war es verlockend, dem heißen Vorkriegssommer zu entfliehen, um in Italien zu arbeiten. Reinhardt erzählte viele Jahre später darüber:
Wir waren damals in Forte dei Marmi. Dort hatten wir ein Haus gemietet – so ein richtiger verwahrloster italienischer Barockpalazzo. Gersdorff war nach Florenz gefahren, um Kasten und Truhen und was man sonst damals noch sehr billig haben konnte, zu besorgen. Denn wir wollten uns für die Dauer einrichten. Es war wunderschön dort. Am Tage des Kriegsausbruches hatten wir eine Autotour nach Siena gemacht. Gersdorff hat uns dort mit der Nachricht vom Ausbruch des Krieges empfangen. Er hatte uns vorher auch als erster von der Ermordung des Thronfolgers gesagt. Zunächst versuchten wir noch zu bleiben. Aber dann wurde die Stimmung doch so feindselig, daß man fort mußte. Wir hatten ein ungewöhnlich großes Auto, einen Mercedes, den ich noch gar nicht fix gekauft hatte und nur ausprobieren wollte. Wie dieser Wagen in der kleinen Stadt angeschaut wurde …!
Es folgte eine panikartige Rückfahrt nach Berlin. Ins Ungewisse. Die Zukunft des Theaters schien ins Wanken geraten zu sein. Der Hurra-Patriotismus auf den Straßen Berlins konnte düsterste Befürchtungen nicht bannen. Reinhardt hat oft von diesen Tagen erzählt und vor allem von der Reaktion der einzelnen Schauspieler auf das Elementarereignis des Krieges. Wie der junge Karl von Gersdorff, der sich freiwillig gemeldet hatte, in Uniform ins Theater kam, in jedem Knopfloch eine Blume. »Geschmückt wie ein Opferstier.« Strahlend, voll Optimismus – um kurz darauf als einer der ersten an der Front zu fallen. Und der Komiker Victor Arnold, der während einer Vorstellung, von Kriegsangst gepeinigt, einen Wahnsinnsanfall erlitt und sich kurze Zeit danach die Adern mit Glasscherben aufschnitt.
Der Unsicherheit der ersten Wochen nach Kriegsausbruch folgte wie in allen Zeiten und während aller Kriege und Revolutionen – eine Epoche fieberhaften Aufschwunges in allen Theatern. Nur zu gerne ließen sich die Menschen ablenken, und gerade das war auch an »höchster Stelle« erwünscht. Sorgen sollten während der kurzen Stunden im Theater, die in eine vergangene Zeit zurückzauberten, vergessen werden. Hochdramatische Konflikte wurden zu willkommenem Maß für eigene Probleme. So spielte man vor ausverkauften Häusern. Zunächst in Reinhardts Inszenierung den Prinz von Homburg und die Wallenstein-Trilogie. Deutsche Dichter beherrschten das Repertoire neben Shakespeare, dessen Werke unentwegt weitergespielt wurden.
Die Panik der ersten Kriegsmonate wich einer zuversichtlicheren Stimmung im Hinterland. Die Armeen waren im Vormarsch. Man durfte wieder lachen, man wollte wieder lachen. Max Pallenberg war Reinhardt damals der liebste unter den Komikern, die er in seinem Ensemble hatte. Er wurde nicht müde, sich an dem Bitteren, Galligen dieser Komik, an dem Genialen im Wesen Pallenbergs zu freuen. Viele Jahre hindurch, bis er ihm schließlich, ein Jahr vor Pallenbergs Tod, den Mephisto bei den Salzburger Festspielen anvertraute. Aber schon im Jahre 1914 wusste er, dass kein anderer die hintergründige Gestalt des Rappelkopf in Der Alpenkönig und der Menschenfeind, das Unheimliche und dabei so typisch Österreichische dieser Raimundfigur so schlagend darstellen könne wie Pallenberg. Reinhardt führte das Märchenstück in die Tiefen zurück, aus denen Raimund Stoff und Sinn seiner Handlung geschöpft hatte. Es wurde eine glanzvolle Aufführung und auch ein Triumph für Pallenberg. Max Reinhardt war vorher mit Ernst Stern, der die Dekorationen entwarf, in die Alpen gefahren. So wie einst, während der Arbeit am Regiebuch des Sommernachtstraums, hatte er bei Tag Sonne und Schnee genossen und erst abends an seinem Regiebuch gearbeitet.
Um aber auch bodenständigen Humor zu Worte kommen zu lassen, dessen Breite norddeutschem Verstehen näher liegt als das österreichisch Feinsinnige, Geistreiche in einem Stück von Ferdinand Raimund, waren Ende 1914 in den Kammerspielen Die Deutschen Kleinstädter von August von Kotzebue in glänzender Besetzung neuinszeniert worden.
Der Regierung lag damals besonders viel daran, Deutschland dem neutralen Ausland gegenüber als Kulturmacht auszuweisen. Die Inszenierungen Max Reinhardts waren so repräsentativ, dass seine Gastspielreisen nach Skandinavien staatlich subventioniert wurden. Die Kosten des Transportes einer praktikablen Drehbühne, aller Dekorationen, Requisiten und Kostüme wären für ein Privattheater viel zu hoch gewesen.
Max Reinhardt hatte zuletzt 1911 in Skandinavien mit Ödipus gastiert. Diesmal, im November 1915, brachte er Die Räuber, Faust, Sommernachtstraum, Was ihr wollt, Minna von Barnhelm und Strindbergs Totentanz nach Stockholm und Christiania. Er wurde jubelnd empfangen. Nordische Kunst verdankte ihm sehr viel. Als Regisseur und vorher als Schauspieler. Seine Inszenierungen hatten aus den Tiefen der Werke von Ibsen, Strindberg, Björnson, Hamsun ungeahnte Schätze gehoben. Maler wie vornehmlich Edvard Munch hatte er herangezogen, um einen Bühnenraum zu schaffen, der die Wirkung noch steigerte. Unvergessen war aber auch der Schauspieler Reinhardt in Ibsenrollen, wie etwa Foldal oder Engstrand. Ihm selbst war die Kunst nordischer Schauspieler sehr ans Herz gewachsen. Er versäumte niemals, Vorstellungen in Stockholm, Christiania oder Kopenhagen beizuwohnen, und wenn er mit skandinavischen Schauspielern arbeitete, waren ihre feinen Nuancierungen, das Sparsame verhaltener Leidenschaft (das freilich in vielen Fällen nur vom Regietisch, von der Bühne aus, genossen werden konnte), ein besonderes Fest für ihn.
Auf dieser Nordland-Tournee verfolgte Reinhardt noch ein anderes Ziel. Die tänzerische Begabung dänischer und norwegischer Künstler war ihm seit Jahren bekannt. So hoffte er, in Skandinavien Tänzer für ein Ballett-Ensemble zu finden, das, für Berlin neu, in Tanzspielen das Repertoire seiner Berliner Theater beleben sollte. Von der Stockholmer Oper wurde ihm ein Saal zur Verfügung gestellt. Dort konnten Kandidatinnen vortanzen. Aber erst in Christiania kam es zu einer entscheidenden Begegnung: Lillebil Christensen und ihre Mutter Gydda Christensen. Lillebil debütierte später im Deutschen Theater als Prinzessin Fay-yen in Hofmannsthals Tanzspiel Die Grüne Flöte.
Bei seiner Rückkehr nach Berlin fand Max Reinhardt verschärfte Kriegszustände vor. Der Gegensatz musste nach den Wochen im neutralen kriegsfernen Ausland doppelt fühlbar sein. Die Polizeistunde war auf halb zwölf verlegt worden. Das bedeutete früheres Schließen der Theater, da der Nachtverkehr auf Straßenbahn, Hoch- und Untergrundbahn ebenfalls um anderthalb Stunden verkürzt worden war. Rationierungen erschwerten die Anschaffung von Dekorationen und Kostümen. Aber trotzdem war die Stimmung im Hinterland noch immer gut. Beim Fall von Bukarest dröhnten Salutschüsse über der Stadt, die Häuser waren beflaggt, und alle Glocken läuteten. Noch schlug man Brücken in eine glücklichere Zukunft: ein »Haus der Freundschaft« sollte in Konstantinopel errichtet werden. Peter Behrens, Hans Poelzig, Bruno Paul und andere, wenn auch minder bedeutende Architekten nahmen an dem Wettbewerb teil. Und noch blieb die Freude am Theater von den Einschränkungen unberührt. Der Andrang des theaterhungrigen Publikums wuchs in solchem Ausmaß, dass sich Reinhardts Deutsches Theater und die Kammerspiele als unzulänglich erwiesen. Die Volksbühne am Bülowplatz war 1914 eröffnet worden. Von Oskar Kaufmann gebaut und mit allen, damals neuen, Errungenschaften der Bühnentechnik ausgestattet. Ein Haus, das mit seiner warmen dunkelbraunen Mahagonitäfelung einen würdigen Rahmen für Reinhardts Inszenierungen bot. Verhandlungen mit der Neuen Freien Volksbühne führten März 1915 zum Abschluss eines zweijährigen Pachtvertrages, und die Übernahme erfolgte am 1. September 1915.
Die kurzen Sommerferien, die sich Reinhardt gönnte, verbrachte er in Hiddensee. Dort arbeitete er an seinem Regiebuch für Shakespeares Sturm für die Volksbühne. Er liebte das Meer, den Strand, Sonne und Wind. Ob er nun im Norden, am Mittelmeer oder in Kalifornien war: immer suchte er nach Häusern in der Nähe des Ozeans, immer ging er viele Stunden dem Wasser entlang im Sand. So begleitete das Rauschen von Wind und Brandung seine Arbeit an dem Regiebuch in den Nächten von Hiddensee.
Wieder schuf Ernst Stern den Bühnenrahmen, Humperdinck die Musik. Trotz der glänzenden Besetzung – Ludwig Wüllner, Rudolf Schildkraut, Maria Fein, Camilla Eibenschütz, Katta Sterna – konnte diese erste Inszenierung Reinhardts in der Volksbühne das dortige Publikum nicht sofort vollkommen erobern. Instrument und Zuhörer müssen aufeinander abgestimmt sein. Erst spätere Aufführungen brachten diesen Einklang. Viele der Repertoirestücke des Deutschen Theaters wurden in die Volksbühne verpflanzt. Die Räuber, Der Kaufmann von Venedig, Ödipus wurden dort gegeben, neben Gerhart Hauptmanns Werken und Schönherrs Volk in Not.
Shakespeare-Zyklus – Deutscher Zyklus –
Probenarbeit
1916: Shakespeares 300. Todestag. Ein äußerer Anlass für Reinhardts Shakespeare-Zyklus. Seine innerste Andacht zu dem Werke Shakespeares war nicht an ein Datum gebunden. Er hat sie mit glühender Liebe, wie eine nie verlöschende Fackel, sein Leben hindurch bis zu seinem Tode getragen. Vom Sommernachtstraum (1905) angefangen, durch Städte und Länder, auf große und kleinste Bühnen (München), auf Freilichtbühnen (Florenz, Boboli-Gärten; Oxford; Schloss Kleßheim bei Salzburg; Hollywood Bowl), immer lebendig, vertieft mit zunehmenden Jahren, durchleuchtet, in ewigem Fließen wie das Leben selbst.
Im Wilhelminischen Zeitalter hatten die Klassiker, und vor allem Shakespeare, etwas von Herbariumpflanzen. Sorgfältig gepresst, des Lebenssaftes beraubt, vom Publikum mit ehrfürchtiger Langweile betrachtet. Max Reinhardt brachte sie wieder zum Blühen, entriss sie der Gruft, in der sie verdorrt waren. Unter seiner Direktion des Deutschen Theaters allein legen über 2000 Shakespeare-Aufführungen in den ersten 25 Jahren Zeugenschaft dafür ab. Dazu gesellen sich noch zahllose Aufführungen in späteren Jahren und in allen anderen Theatern der Welt, in die er Shakespeares Ruhm trug.
So war der Shakespeare-Zyklus, den er schon 1913 und 1914 begann, nur ein Glied in einer Kette, die längst in seinem Herzen und bei seinem Publikum verankert war. Trotzdem gab es noch immer Steigerungen. Seine Macbeth-Aufführung im Jahre 1916 übertraf alles, was ihr vorangegangen war. Die Fülle der Gestalten zog vorüber, litt, kämpfte und riss Erleben und Begreifen ganz in ihren Kreis. Im Mittelpunkt dieses Kreises, treibend, bewegend, wie giftige Pflanzen, Macbeth und die Lady, hemmungslos, triebhaft. Was Reinhardt hier aus Paul Wegener, Bruno Decarli, Hermine Körner und einem ebenbürtigen Ensemble herausholte, war einmalig. Gleichsam ein Spiel mit lebendigen Schachfiguren, deren Schicksal vom ersten Zuge an vorausbestimmt, mit unerbittlicher Folgerichtigkeit dem vernichtenden Ende zuschritt. Ernst Stern hatte die Dekorationen geschaffen, die in ihrer dunklen Wucht, in ihrem flammenden Rot wie eine stumme Anklage hinter dem Mord standen.
Elf andere Shakespeare-Werke waren Macbeth vorangegangen. Darunter Hamlet, Othello, beide Teile König Heinrich IV., Romeo und Julia, Der Kaufmann von Venedig, Was ihr wollt, Viel Lärm um nichts – alle in Glanzbesetzungen, mit Albert Bassermann, Alexander Moissi, Paul Wegener, Hans Waßmann, Gertrud Eysoldt, Else Heims, Camilla Eibenschütz, um nur einige zu nennen. Reinhardts Ensemble war durch viele Jahre des Zusammenspiels unter seiner Regie wie ein Orchester aufeinander abgestimmt.
Der Spielzeit 1916/17 verlieh Max Reinhardts »Deutscher Zyklus« besonderen Glanz. Den Auftakt gab das Sturm- und Drang-Drama Die Soldaten von Jacob Michael Reinhold Lenz, das mit heißem Atem am Beschauer vorbeijagte. Aneinandergereiht einzelne Szenen, scheinbare Zerrissenheit, der die geschlossenste Einheit zugrunde lag. Vibrierende Vielheit des Lebens in einem Spiegel aufgefangen, zu einem Bild vereinigt. Zahnrädern gleich griffen die Szenen ineinander. Während des Dunkelwerdens, wenn sich die Bühne drehte, legte sich oft nur der Gleichklang der Stimmen wie eine Brücke zwischen sie und führte so zum nächsten Bild hinüber. Die Schauspieler: Hermann Thimig, Camilla Eibenschütz – und Werner Krauß in einer unvergesslichen Episode. Alles leidenschaftlich, innerlich, Sturm und Drang, und doch so sehr ein Schrei aus unserer Zeit. Einheitlich der Rahmen, der für alle Bilder geschaffen war: zwei Pfeiler, rechts und links, in deren Nischen Armleuchter standen. Von ihrem Strahlen ging eine Ruhe aus, die das Leben, das vorbeizog, nur noch hob. Max Reinhardt hatte mit dieser Inszenierung den Ausdruck für die Sprache einer Zeit gefunden, die in solchem Maße niemals vorher zum Leben erweckt, dem Heute so nahe gebracht worden war. Farben, Licht und Klang! Auferstehung eines Feuergeistes, dem die glättende Zeit nichts anhaben konnte. Kurz darauf folgte Das Leidende Weib von Friedrich Maximilian Klinger, in einer Bearbeitung von Sternheim, mit der Höflich in der Rolle der Gesandtin. Diese Aufführung musste neben der Vollblütigkeit des Stückes von Lenz etwas verblassen, und das Publikum nahm sie nicht gut auf. Dann aber kam Dantons Tod von Georg Büchner, diese Symphonie der Leidenschaften, von Reinhardt sein Leben hindurch immer wieder dirigiert. Das Bühnenbild stammte von Ernst Stern. Steil verloren sich die Reihen des Konvents in einer Art Nebel, aus dem Stimmen in scharfem Kontrapunkt zum Zuschauer drangen. Im Gegensatz dazu das Quartett der Kerkerszene – ein Adagio von unbeschreiblicher Harmonie. Der schnelle Wechsel der Szenen wurde durch Licht ermöglicht, das grell auf einzelne Gestalten und Dekorationen fiel, sie aus der Dunkelheit rings herum heraushob. Hinter allem Geschehen die Revolution, deren Grauen zwei Jahre später Europa zutiefst erschüttern sollte. Kabale und Liebe, Minna von Barnhelm und Judith von Friedrich Hebbel beschlossen den »Deutschen Zyklus«.
Um diese Zeit begann Reinhardt mit den Proben zu Figaros Hochzeit in der Bearbeitung von Josef Kainz. In geschliffener Sprache führt diese Übersetzung von Fuldas süßlicher Fassung fort, zu Beaumarchais’ Zeit zurück. Kainz hatte diese Übersetzung für sich selbst gemacht und mit großem Erfolg gespielt. Max Reinhardt fand in Pallenberg für die Rolle des Figaro einen Darsteller besonderer Art. Dieser Figaro kam aus dem Volk. Mit breiten Gebärden, gleichsam von unten herauf, schleuderte er seine Herausforderung in die Dunkelheit des Hauses, immer wieder geduckt, um dann an seinem eigenen Wort zu wachsen. Ein Anklageschrei – Symbol für die Vielheit eines Volkes, Symbol für die Tat, zu der es sich später zusammenschloss. Pallenbergs Figaro ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass diese Tat schwerblütiger Menschen nicht von Sanftmut diktiert sein würde. Langgenährter Hass der Unterdrückten fand hier eine Stimme.
In diesen frühen Zeiten leitete Max Reinhardt seine Proben von einem kleinen Haus aus, das knapp an der Rampe stand und nur zur Bühne hin offen war. Ein Schreibpult und zwei Stühle fanden darin Platz: für Reinhardt und seinen Hilfsregisseur. Dort, gedeckt, geschützt, wie in einem kleinen Arbeitszimmer, saß der Mensch, in dem sich alle Regungen der einzelnen Gestalten des Dramas wie in einem Brennpunkt fanden. Von dort aus strahlten sie wieder zurück.
Ob nun in Worten, im Tonfall oder in der Gebärde. Plötzlich stand er dann neben dem Schauspieler, ging neben ihm her, schmiedete mit suggestiver Gewalt die Bewegung an das Wort. In ihm war die Wasserwaage für das Gesetz, unter dessen Zwang die Gestalten eines Stückes handeln. Aus dem gegebenen Gemütszustand des einzelnen entwickelte sich ihm selbst noch die kleinste unwillkürliche Bewegung in ihrer scheinbaren Unlogik. Er fühlte den Rhythmus seelischer Vorgänge, der für Betonungen, für Pausen bestimmend ist. Ein Beispiel: der Graf Almaviva ist in das Zimmer der Gräfin eingedrungen. In tödlicher Verlegenheit steht sie vor ihm. Er fühlt, dass er betrogen wird – aber noch fehlt es ihm an Beweisen. Wie benimmt sich ein Mensch in solcher Ungewissheit? Für wenige Augenblicke ist Reinhardt der Graf: ein zweckloser Gang durch das Zimmer, ein absichtsloses Rücken an einem Stuhl, ein zögerndes, tastendes Zurechtstreifen einer Gardine, ein misstrauischer Blick auf den Alkoven – dazwischen, wie zerstreut, abgerissene Worte. Sie stehen gleichsam wie Ausrufungszeichen hinter einer Gedankenkette. Alles selbstverständlich – von nun an nicht mehr leicht anders denkbar. Überzeugend, noch ehe es vom Schauspieler in seine Ausdrucksmöglichkeiten übersetzt wurde.
Oder: Cherubin wird von Susanna aus dem Versteck befreit. Er weiß nicht aus noch ein vor Angst. Sinnloses Hinundherlaufen. Reinhardt steht daneben und steigert. Mit knappen Worten, eindringlich, bis er endlich, selbst mitgerissen, an dem wilden Hasten teilnimmt, bis die Szene die höchste Spannung erreicht hat, ein Tempo, das nicht mehr überboten werden kann. Mit einer überaus charakteristischen, sich immer wiederholenden Wendung ging Reinhardt nach einem solchen Eingreifen in sein Bühnenhäuschen zurück. Er wurde wieder nur Stimme.
In späteren Jahren verzichtete Reinhardt auf die Abgeschlossenheit dieses zerlegbaren Regiehäuschens, das ihn selbst auf Gastspielreisen begleitet hatte. Da stand sein Regietisch auf offener Bühne, auf einem in den Zuschauerraum vorgebauten Podium oder, bei den letzten Proben, in den ersten Parkettreihen. Es war, als hätte sich im Laufe der Zeit die Atmosphäre, die von ihm ausging, wie eine Aura um ihn verdichtet. Sie wurde ihm zum Schutz, und es bedurfte keiner Wände mehr.
Wenn Max Reinhardt das Theater betrat, seine Ledermappe, in der er das Regiebuch zur Probe brachte, unterm Arm, strebte er in schweigender Konzentration dem Regietisch zu. Jeder Aufenthalt, jede Unterbrechung war ihm unerwünscht. Und doch lauerten Mitarbeiter, Assistenten, Schauspieler auf ihn, um auf diesem kurzen Weg Fragen zu stellen und Mitteilungen zu machen. Wie oft hatte man nur diese wenigen Minuten, zwischen Bühneneingang und Zuschauerraum, um Antworten auf wichtigste Fragen, die ihn oder seine Arbeit betrafen, von ihm zu bekommen.
Zuschauer bei Proben störten ihn sehr. Es war schwer, von ihm die Erlaubnis zu erlangen, Proben beizuwohnen, und er beschränkte dieses Privileg auf wenige Bevorzugte, von denen er wusste, dass ihr Interesse ehrlich und von Verständnis gedeckt war.
Manchmal verlegte er seine Probenarbeit nach Hause. Da konnte er, in größerer Ruhe als im Theater, in der Arbeit mit einzelnen Schauspielern, vieles vertiefen, abschleifen, abrunden. Diese Stunden mit ihm, die sich oft bis in die tiefste Nacht erstreckten, waren für seine Darsteller das Wertvollste und Kostbarste. Solche Konzentration, dieses Geben und Nehmen, steigerte alle Kräfte und trug Früchte.
Max Reinhardts Ruhe und Langmut auf Proben waren unbegrenzt. Aber auch seine Ausdauer. Unerbittlich gegen sich selbst, forderte er von seinen Schauspielern denselben eisernen Willen, Höchstes zu erreichen. Vor besonders schwierigen Premieren – wie etwa Fritz von Unruhs Phaea – wurde die Nacht durchprobiert, bis acht Uhr früh. Die Generalprobe von Faust, in der Salzburger Felsenreitschule, endete im Morgengrauen, und ahnungsvoller hat wohl kaum je »der Tag graut –« geklungen als an diesem fahlen, fröstelnden Morgen, im Schatten der steilen Felswand, auf deren Höhe schon der erste Widerschein verschleierter Sonne spielte.