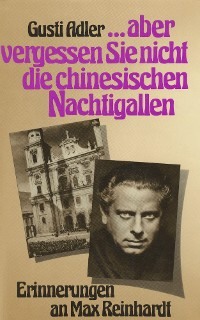Kitabı oku: «"...vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen."», sayfa 6
Es war Reinhardts Überzeugung, dass eine große Müdigkeit geradezu notwendig sei, um bei Darstellern den Widerstand letzter Hemmungen zu überwinden. Am Tag der Premiere war selbst nach den anstrengendsten Nachtproben noch eine Durchsprechprobe auf der Bühne, die nur zu oft zur Arbeitsprobe wurde und bis zum Beginn der Vorstellung dauerte.
Während der letzten großen Proben musste man im dunklen Zuschauerraum bei Reinhardt sitzen, um aufzuschreiben, was er an Schauspielern, Dekorationen, Musik etc. noch auszusetzen hatte. Aber auch sein Lob. Nach jedem Akt, manchmal erst am Ende der Probe, ging er dann zur »Kritik« auf die Bühne, um, unterstützt von diesen Notizen, mit Darstellern und anderen Mitarbeitern zu sprechen, oft Gesagtes zu wiederholen, zu ermutigen, zu loben, zu tadeln, Änderungen oder Striche anzuordnen.
Aber auch das genügte ihm nicht. Wenn er von der Probe nach Hause kam, saß er noch bis tief in die Nacht beim Schreibtisch und notierte in Schlagworten, was seinen Schauspielern und Mitarbeitern am nächsten Tag vor Probenbeginn mitgeteilt werden sollte. Oft war es die Wiederholung des bereits Gesagten, aber noch öfter Neues, das ihm im Nachgefühl der Probe, in der Stille der Nacht, als unerlässlich klargeworden war.
Die Schauspieler hatten kein besseres Publikum als Reinhardt. Sein Lachen war unmittelbar, es entzündete sich an einer Bewegung, an einem Gang, am Gesichtsausdruck eines Darstellers, an einem Tonfall. Seine Tränen flossen gewissermaßen nach innen. Nach einer ergreifenden Szene, nach einem tragischen Schluss, sah man ihn oft mit rotgeweinten Augen weggehen. Gewisse Stücke, die sehr erfolgreich waren, sehr viel von ihm selbst empfangen und auch in der Darstellung etwas ihm besonders Liebenswertes hatten, ergriffen ihn stets aufs Neue. Das waren Inszenierungen, die er sich auch nach der Premiere immer wieder ansah. Oft stand er nur hinter der letzten Parkettreihe, oder er ging in eine Loge. Es bedeutete den Schauspielern sehr viel, wenn es hieß: »Der Professor ist im Haus.« War es ein Lustspiel, so blieb es nicht lange verborgen, wo er saß: sein spontanes Lachen erhob sich in dem dunklen Theater wie ein Trompetenstoß über dem Publikumslachen und verriet ihn.
Expressionismus
Das Grauen des Krieges schritt in diesen Jahren unaufhaltsam, mit bleierner Schwere vorwärts. Es galt, Schritt zu halten oder unterzugehen. Es galt, im Chor der Todgeweihten die Stimmen zu hören, die sich über die Zeit erhoben, denen es gegeben war, eigene Not und die Not der Zeit zu gestalten, es galt, mit letzter Kraft, der Stimme dieses jungen Deutschland Gehör zu verschaffen, ehe sie in grauenhaftem Tode auf den Schlachtfeldern verstummte. Der Theaterverein »Das junge Deutschland« (auf Initiative von Maximilian Harden im Rahmen des Deutschen Theaters gegründet und von Heinz Herald geleitet) hatte sich dieses Ziel gesteckt. Der Bettler von Reinhard Sorge, in der Inszenierung von Max Reinhardt, war das erste Stück in einer Reihe von Werken jüngster deutscher Dichter. Reinhard Sorge war 1916 im Westen gefallen. Sein Werk: ein Versprechen – das Max Reinhardt einlöste. Er hat dem Relief dieses lyrischen Dramas dreidimensionale Tiefe gegeben. In Einfühlung und im Vorfühlen neuer Ausdrucksformen hat er sich hier zum ersten Mal expressionistischer Ausdrucksmittel bedient. Gleichzeitigkeit des Geschehens hinter Schleiern, Ineinandergleiten von Szenen, wie in der unvergesslichen Kaffeehausszene. Stimmen, Farben. Traumhaft kommen und gehen Gestalten. Die Bühne wird schwer von ihrem Geschick.
Was Max Reinhardt hier schuf, griff tief in die Zeit, die damals um ihn war, die sich wandelte, in der alles im Fluss war wie in einem brodelnden Vulkan. Dichtung, bildende Kunst, Musik – alles rang nach neuem Ausdruck, stammelte, wie in den Dada-Schöpfungen, setzte neue Klangwerte anstelle der alten oder zerlegte Form und Farbe. Was Reinhardt turmhoch über die vergänglichen Kunstströmungen dieser Tage erhob, war eine innere Stetigkeit.
Die Gestalten, denen er Leben verlieh, waren durchblutet, keine Schemen. Das offenbarte sich in Paul Wegener, der den Vater ergreifend darstellte, bei Ernst Deutsch als seinem Sohn, vor allem aber bei Helene Thimig in der Rolle des Mädchens. Instinktiv hatte sie die Melodie dieser neuen Zeitströmung erfasst. Das Wort war bei ihr nicht Träger der Empfindung, sondern Krönung, Sublimierung des Sinnes. Als Max Reinhardt sie im Frühjahr 1917 engagierte, hatte er sie noch nie spielen gesehen. Nur einmal hatte er sie im Theater von einer Loge aus beobachtet, als sie einer Aufführung des Lebenden Leichnams von Tolstoi beiwohnte. Ihr auffallend starkes Reagieren und Mitgerissensein während der Vorstellung hatte ihn davon überzeugt, dass da eine Begabung sein müsse.
Er beauftragte Felix Hollaender, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, ließ sie durch ihn auffordern, zu ihm zu kommen. Sie sprach die Marianne in Goethes Die Geschwister vor. Bei dieser ersten Unterredung erzählte er ihr schon von seinen fernsten Plänen: ein Theater in Hellbrunn oder in der Schweiz. Eine Tournee sollte ihn damals nach Schweden führen. Er forderte Helene Thimig auf, daran teilzunehmen, trug ihr die Viola in Was ihr wollt, die Rolle des Mädchens in Strindbergs Gespenstersonate und die Natascha in Gorkis Nachtasyl an. Zunächst setzte sich aber ihrem Engagement an das Deutsche Theater vieles entgegen. Lucie Höflich hatte es kontraktlich, dass Helene Thimig nicht engagiert werden dürfe … Der Vertrag mit dem Königlichen Schauspielhaus in Berlin lief noch bis 1918. Er konnte erst nach schwierigen Verhandlungen um ein Jahr früher gelöst werden. Aber endlich, am 17. April 1917, unterschrieb Helene Thimig einen fünfjährigen Vertrag mit dem Deutschen Theater.
Max Reinhardt hatte sie als Schauspielerin kennen gelernt, gleichzeitig aber war es der Beginn einer langen Entwicklung in der Beziehung dieser beiden Menschen zueinander. Jahre vor diesem Zusammentreffen war Max Reinhardt nur noch dem Buchstaben nach mit Else Heims verheiratet gewesen. Andauernde Konflikte wurden vor Anwälten ausgetragen. Reinhardt hatte den besten Willen, alles auf gütlichem Wege zu erledigen. Deshalb wurde zwischen ihm und Helene Thimig beschlossen, dass sie einander ein Jahr lang nicht sehen und jede Verbindung abbrechen wollten. Während dieser Zeit hoffte er, zu einem friedlichen Vergleich mit Frau Heims zu gelangen. Seine ehrliche Absicht scheiterte an ihrem hartnäckigen Widerstand, und es kam erst viele Jahre später zur Lösung dieser Ehe.
Mit seiner Inszenierung der Seeschlacht von Reinhard Goering – ebenfalls im Rahmen des »Jungen Deutschland« – hat Max Reinhardt noch einem zweiten jungen deutschen Dichter Gehör verschafft. In dieser Vorstellung klappte alles mit einer Präzision, die an das Ineinander-Funktionieren der Maschinen auf Kriegsschiffen mahnte. Überragend Wegener, Krauß und Hermann Thimig. Aber selbst Reinhardts Regie konnte gegen das Objektivierte, Kalte dieser überspitzten Symbolik, das für diese Generation so typisch war, nicht aufkommen. Wohl hörte man eine Botschaft, aber sie zeugte keinen Glauben. Scharfe Polemik war dem Werk in Dresden vorangegangen. Ein Teil des revolutionsbereiten Publikums war wohl auch enttäuscht, dass in Berlin alles sensationslos verlief. So hielten sich Beifall und Zischen die Waage.
Einmal noch, drei Jahre später, hat Max Reinhardt mit der Inszenierung eines Stückes von August Stramm, Kräfte, den Versuch gemacht, expressionistischem Drama Geltung zu verschaffen. Sein Ensemble – Helene Thimig, Agnes Straub, Eugen Klöpfer und Hermann Thimig – wurde damals von einem wahren Furor erfasst, Ton-Werte sprechen zu lassen, scheinbar zusammenhanglosen Worten durch Rhythmus und Klangschattierung Sinn zu geben, Dialog »auf Noten gesetzt« zu rezitieren. Das Experiment gelang, und Max Reinhardt nahm das Stück sogar auf eine skandinavische Tournee mit. Da ihm aber im Grunde diese Kunstform doch sehr ferne lag, hat er nie wieder Ähnliches unternommen.
Großes Schauspielhaus
18. Mai 1918: Die Zirkusfront ist eingestürzt.
6. Juni 1918: R., ein Freund, ist mit Reinhardt am Großen Schauspielhaus vorbeigegangen. Wenn Reinhardt davon spricht, dass es mit dem Bau eventuell nicht klappen könnte, kommen ihm die Tränen in die Augen.
Aber Schwierigkeiten ließen Max Reinhardt seit jeher nur um so leidenschaftlicher danach streben, sein Ziel zu erreichen. Er hatte die Gabe, nachtwandlerisch die Menschen zu finden, die sich für die gegebene Aufgabe am besten eigneten. In Hans Poelzig zog er einen genialen Mitarbeiter heran. So wurde das Große Schauspielhaus nicht nur in architektonischer Hinsicht, sondern auch in Bezug auf alles Technische ein einzigartiger Wunderbau. Indirekte Beleuchtung in Zuschauerraum und Foyers schuf ein warmes Licht, das nicht blendete. Die Pfeiler in den Umgängen glichen Blumen in indischen Tempeln. Die Stalaktiten der Kuppeldecke des Zuschauerraumes unterstützten die Akustik. Das geflüsterte Wort war auf der höchsten Galerie noch hörbar. Reinhardts Traum eines »Theaters der Fünftausend« war erfüllt. (Das Haus fasst in Wirklichkeit 3200 Zuschauer.) Die Kluft zwischen Schauspielern und Publikum war überbrückt. Eine Auferstehung des Theaters der Antike. Mit der Orestie des Aischylos wurde das Haus am 29. November 1919 eingeweiht. In derselben Spielzeit folgten darauf, in ebenfalls glänzenden Besetzungen, Hamlet, Danton von Romain Rolland, König Ödipus und Jedermann.
Mit ungeheuren Kosten, allen Hindernissen zum Trotz, die sich in der chaotischen Nachkriegszeit einem solchen Unterfangen entgegenstellten (Streik, Kohlennot, Lichtmangel), war das Große Schauspielhaus fertiggestellt worden. Die Bedingungen für das Zusammenspiel von Schauspieler und Publikum, der Raum war geschaffen worden. Aber der Kurzsichtigkeit einer Schar von Kritikern, die sich jeder Neuerung eigensinnig verschloss, gelang es über ein Jahr lang, das theaterfremde Nachkriegspublikum zu beeinflussen und fernzuhalten. Nur wenige verständnisvolle, einsichtige, wichtige Schriftsteller traten für Reinhardts ,,Theater der Fünftausend« ein. Zögernd, aber von dem ewigen Zauber echten Theaters doch unwiderstehlich angezogen, folgte dann schließlich doch auch das neue Publikum. Die Suggestion des gedruckten Wortes verblasste neben dramatischem Geschehen, das die Zuschauer in seinen Zauberkreis riss und magisch bannte. Max Reinhardt hatte gehofft, dass eine neue Dichtergeneration der neuen Zeit, die hereingebrochen war, Stimme verleihen würde, dass er dem Drama dieser Jahre des Umschwungs ein Haus geschaffen habe. Aber auch hier erlebte er eine Enttäuschung: das Drama dieser Zeit war blutarm, erstickt in papierener Symbolik und Propaganda. In den Straßen, die zu den Theatern führten, war Revolution. Schauspieler und Zuschauer, die stundenweit zu Fuß gegangen waren, mussten oft zuletzt noch im Kugelregen über die Weidendammer Brücke oder über den Steg laufen. Die Folie der Wirklichkeit war zu stark. Nur echtes Drama hätte dagegen aufkommen können, aber die jungen Dichter versagten. Max Reinhardt hat oft über »die dramatischen Momente der Zeitgeschichte« gesprochen:
… der letzte Zar und seine Familie; der Tod Rasputins. Die Ermordung Lincolns im Theater. Die Abdankung des letzten Sultans. Die Rede Rathenaus. Der Frieden in Versailles. Das Eindringen des Mobs in Versailles, in die Tuilerien. Die Flucht des Königs und der Königin. Gerichtsszenen: Ideal der dramatischen Form (Mary Dugan).
Was damals Europa und die Welt zerriss, war noch zu nahe. Chaos barg Keime einer Saat, die einst grauenhaft aufgehen und Vernichtung bringen sollte. Gestaltung zerschellte an Ungeklärtem, vermochte das Ungeheure nicht zu fassen. Wohl schleppte sich expressionistisches Theater bis in die dreißiger Jahre, aber es war außerstande, sich über die Zeit zu erheben.
Krieg, Nachkriegsnot und Inflation hatten die Existenz der Bühnen untergraben. Nun bedrohte noch eine neue Gefahr das Theater: der Film. Die besten Schauspieler konnten den Lockungen des Films, der hohen Gagen nicht widerstehen. Obwohl Edmund Reinhardt seinem Bruder Direktionssorgen soviel als nur irgend möglich ersparen wollte, war es doch unvermeidlich, dass ihm die Freude an seiner Regiearbeit immer wieder durch Geldnot getrübt wurde, dass ihn die Unzuverlässigkeit der Schauspieler, die der neuen materiellen Anziehungskraft des Films erlagen, kränkte. Schon 1919 hatte Max Reinhardt in Salzburg gesagt:
Man wird so misstrauisch, weil es kaum einen Menschen gibt, der nicht etwas von einem will. Das lässt mich ja auch immer wünschen, alles niederzulegen. Es liegt mir gar nicht, das Schicksal für so und so viele Menschen zu sein. Ich möchte auf der Bühne gutes Theater machen. Mehr nicht. Nun bringt aber der ganze Apparat alles andre mit sich.
Am 9· Oktober 1920 legte er dann die Direktion seiner Theater nieder, behielt aber sich und seinem Bruder die letzte Entscheidung wichtigster Fragen vor. In einer Abschiedsrede an die Schauspieler des Deutschen Theaters erklärte er die Gründe für seinen Rücktritt. Felix Hollaender, sein langjähriger Mitarbeiter, übernahm die Direktion und leitete die Theater bis 1922.
»Orpheus in der Unterwelt«
Das Ende seiner persönlichen Direktionsführung bedeutete für Reinhardt nur den Anfang neuer sorgenvoller Jahre. Was ihn damals und in der folgenden Zeit bewegte, habe ich – seit 1919 in seinen Diensten stehend – bis in viele Einzelheiten miterlebt. Denn meine Arbeit als Privatsekretärin war vielfältig. Da Reinhardt ungern Briefe, nicht einmal an ihm nahestehende Freunde, selbst schrieb, diktierte er den Wortlaut des Briefes, den ich dann in seinem Auftrag schrieb. Sehr häufig konzipierte er – oft auf kleinen Zetteln – Telegramme oder auch Briefe, die ich dann abschreiben und absenden musste. Wenn er im Drang der Probenarbeit gelegentlich trotzdem gezwungen war, an prominente Persönlichkeiten zu besonderen Anlässen zu schreiben oder zu telegrafieren, beauftragte er mich, ihm einige Versionen vorzulegen. Dass er sie unverändert annahm und durch mich absenden ließ, erfüllt mich heute noch mit Stolz. Wenn es sich darum handelte, mit Anwälten oder Behörden zu verhandeln, Eingaben zu machen, überließ er mir die Formulierung. Es gab viele Briefe, die unbeantwortet blieben, weil er nicht dazu kam, Antworten zu konzipieren, die ich weitergeben sollte. Da handelte es sich meistens um Briefe an Menschen, die ihm am nächsten standen, an denen ihm am meisten gelegen war. Das hatte viele Kränkungen zur Folge, da gerade diese Freunde seine Hemmungen nicht ahnten und nicht verstanden. Da er ungern telefonierte, musste ich es oft in seinem Namen tun. Zur Erledigung seiner Korrespondenz kam es meistens in später Nacht, wenn nach Proben, nach einem Empfang in Leopoldskron die letzten Gäste sich entfernt hatten. Dann zog Reinhardt aus seiner Aktentasche oder auch aus einer Tasche seines Anzugs Briefe, die er untertags oder schon vorher bekommen hatte, und begann sie mit mir durchzusprechen. Wenn ich mich nicht am selben Ort aufhielt wie er, übermittelte er mir seine Aufträge schriftlich. Vor seiner Abreise nach Kopenhagen im Januar 1921, wo er mit dänischen Schauspielern Offenbachs Orpheus in der Unterwelt inszenieren sollte, schrieb er am Ende eines langen Briefes über alle schwebenden Angelegenheiten in Wien und in Salzburg:
Es ist nachts vor meiner Abreise, in wenigen Stunden sitze ich im Coupé und erwarte in Kopenhagen möglichst viele und ausführliche Nachrichten von Ihnen … Das ist der längste Brief, den ich je geschrieben habe und die bedrängteste Zeit, in der ich überhaupt je geschrieben habe.
In diesen Jahren lagen Inflation und später Deflation wie Mehltau über allem, Ungewissheit verschleierte die Zukunft, von der stündlichen Verschiebung aller Werte profitierte nur einer: der Schieber. Eine neue unsaubere Gesellschaft ging aus diesem Sumpf hervor. Ehrliche Arbeit wurde zur hoffnungslosen Tretmühle. Nur Gastspiele im Ausland, Bezahlung in stabiler Valuta konnten ein Gegengewicht zu der verheerenden finanziellen Lage in Deutschland und Österreich bilden.
So war Max Reinhardt bereits im November 1920, unmittelbar nach seinem Rücktritt, zu einem Gastspiel nach Skandinavien gefahren. Er brachte den Urfaust, Stella, Kabale und Liebe, Kaufmann von Venedig, Strindbergs Totentanz, Scheiterhaufen und Wetterleuchten sowie Die grosse Szene von Schnitzler und Er ist an allem Schuld von Tolstoi.
Das Orpheus-Gastspiel in Kopenhagen, im März 1921, war überaus erfolgreich. Am 31. Dezember desselben Jahres gab Reinhardt dann Orpheus in der Unterwelt als Silvester-Premiere im Großen Schauspielhaus in Berlin.
Das goldene Gittertor, das so überraschend in den Höhen des Bühnenproszeniums entschwand, um den weiß-blauen Olymp zu offenbaren – weiße Wölkchen, die zu Tänzerinnen wurden –, und dann die Götter: der grantige Jupiter Pallenbergs, die gertenschlanke Öffentliche Meinung Gussy Holls mit ihren wohlpointierten aktuellen Couplets, der ganze Offenbachsche Olymp – alles von der Regie Max Reinhardts weit über das altmodische Operetten-Niveau hinausgehoben und zu Offenbach zurückgeführt. Es war beglückend, Reinhardt bei den Proben zu beobachten. Er hatte selbst die größte Freude an der Musik, an der unbändigen Heiterkeit des Ganzen. Vor ihm lag, wie eine Partitur, sein Regiebuch. Er gab die Einsätze zu dem übermütigen Dialog, er steigerte das Tempo, sein Lachen gab den Schauspielern das Echo, dessen sie bedurften, um die Wirkungskraft einer Pointe, einer Bewegung, eines Tones zu ermessen. Max Reinhardt am Regietisch ersetzte ein volles Haus, das für den Schauspieler, in einer Komödie vor allem, so wesentlich ist. Er ruhte aber auch nicht, ehe sein Ensemble nicht das Äußerste gegeben hatte. So musste der Höllen-Can-Can, der Aktschluss, bei einer der letzten Proben, in später Nacht, immer aufs Neue wiederholt werden. Die Chorführerin, die Tänzer hatten den besten Willen, aber sie waren müde, und so fehlte die Schlagkraft, um die Wirkung, die Reinhardt vorschwebte, zu erzielen. Schließlich ging er mit ungewohnt schnellen Schritten von seinem Regietisch, der auf einer kleinen Plattform in Bühnenhöhe stand, zum Proszenium hinüber, gab der Musik den Einsatz und sprang, stampfte – während sich die Tänzer in der vollen Breite der Bühne nach vorne bewegten – mit beiden Füßen gleichzeitig im Takte auf und nieder, dirigierte mit beiden Armen und sang mit. Alles Gemessene, das für ihn so charakteristisch war, fiel von ihm ab, und so riss er auch die Darsteller über sich selbst hinaus.
Der Premierenabend wurde zu einem triumphalen Erfolg, nicht nur für Reinhardt, der schon nach dem zweiten Akt herausgerufen wurde, sondern auch für Pallenberg, die anderen Darsteller und für den dänischen Bühnenmaler Max Rée, der die Dekorationen geschaffen hatte. Max Reinhardt hatte mit ihm auch schon in Skandinavien gearbeitet. Berlin spielte, sang und pfiff die Orpheus-Melodien und vergaß darüber zeitweise Inflation und wirtschaftliche Sorgen. Die neue Direktion Felix Hollaenders hatte damit ihr Zugstück bekommen.
Reinhardts Inszenierung des Traumspiels von Strindberg, im Deutschen Theater, war der Orpheus-Premiere vorangegangen. Helene und Hermann Thimig, Klöpfer und Krauß spielten in dieser fein abgetönten Aufführung. Max Reinhardt hatte die Arbeit an dem Regiebuch im Juli in Salzburg begonnen, in Stockholm daran weitergearbeitet, um es schließlich in Berlin, im November, zu vollenden.
Ankauf von Leopoldskron
Helene Thimig, Victoriastraße 11, Berlin 16. April 1918
Leopoldvertrag unterzeichnet Gott schenke uns für dieses köstliche Gehäuse die glücklichsten Inhalte Bin froh gut dankbar erkenne wie wundervoll notwendig der Feiertag für den Menschen gespenstische Hindernisse einschrumpfen den Glauben an Erfüllung des Naturnotwendigen wachsen läßt Ich liebe Dich
Dieses Telegramm barg den Keim für alles Künftige. Mit dem Federzug der Unterschrift des Kaufvertrages von Leopoldskron wurden zwanzig Jahre im Leben Reinhardts schicksalhaft bestimmt.
Max Reinhardt hatte seit Jahren nach einem Haus gesucht, das seiner Vorliebe für das Barock entgegenkam. Er konnte, bis an sein Lebensende, niemals widerstehen, wenigstens mit dem Gedanken zu spielen, irgendein altes Schloss, ein altes Bauernhaus, das zum Verkauf ausgeschrieben war, zu erwerben, selbst lange nachdem er schon in Leopoldskron fest verankert war.
Eine solche Möglichkeit war lockend wie eine neue Inszenierung. In Gedanken richtete er dann dieses Haus bis ins letzte ein. Wohin er auch kam: die Suche nach einem derartigen Wohnsitz begann sofort – Kauf oder Miete –, und es war oft schwer, ihn davon abzubringen, sich in ein kostspieliges Abenteuer dieser Art zu verstricken. Freunde und Mitarbeiter wurden auf die Suche geschickt, Pläne mussten beschafft, eigensinnige Besitzer solcher Häuser überredet werden, ihr Haus zum mindesten zu zeigen.
Bei Leopoldskron spielte die Liebe zu Salzburg, dem Salzburg seiner Jugend, noch eine besondere Rolle. Er war verliebt in die Stadt, verliebt in die Landschaft, verliebt in das Barock des Schlosses. Der Gedanke, den Berliner Sorgen entfliehen zu können, eine Ruhe zu genießen, die wie eine Fata Morgana ein Leben lang vor ihm herschwebte, ein Haus zu schaffen, dessen Vollkommenheit er träumte, und wenigstens einen Teil des Jahres so zu leben, wie es seinem innersten Wesen entsprach – dieser Gedanke war zwingend. Die Inflation begünstigte ein solches Unternehmen und ermöglichte es ihm, diesen Besitz um einen erschwinglichen Preis zu erstehen. Es war zunächst eine leere Schale. Nur wenige Möbel standen in den vierzig Zimmern, aber kunsthistorisch wertvolle Stuckdecken, herrliche alte Barocköfen, Bilder, die Halle, das architektonisch vollendete Stiegenhaus, der Marmorsaal gaben Max Reinhardt den Leitton für die schönste Bau-Inszenierung seines Lebens. In den zwei Jahrzehnten, die ihm dort vergönnt waren, hat er diesem verwahrlosten, verfallenden Haus den Glanz seiner barocken Vergangenheit wiedergegeben. Was er hinbrachte, wurde mit empfindsamer Hand eingefügt. Es war für ihn in späteren Jahren immer eine besondere Freude, wenn Sammler oder Kunsthistoriker das Schloss besichtigten und Ursprüngliches nicht mehr von dem unterscheiden konnten, was er hineinkomponiert hatte. (Auch meine Schwester durfte zu dieser Komposition beitragen. Sie war Malerin und Restauratorin, und Max Reinhardt betraute sie mit verschiedenen Aufgaben in Leopoldskron. Er wollte unterhalb der Fenster im Venezianischen Zimmer Blumenstücke haben. Das Deckenbild in diesem Raum mit Commedia-dell’arte-Figuren stammt ebenfalls von ihrer Hand. Für das Speisezimmer malte sie zwei Blumenstücke, die dort in Stuckrahmen eingelassen sind.)
In diesen frühen Jahren, unmittelbar nach dem Ankauf, trug Reinhardt die Vision dessen, was er aus dem leeren Haus machen wollte, bereits in sich. Auch diesen Traum hat er später verwirklicht: Kammermusik-Abende, Theatervorstellungen im Marmorsaal und im Gartentheater, Serenaden auf der Seeterrasse.
Die Einnahmen seiner Arbeitsjahre hat er in die Ausgestaltung dieses Hauses investiert. Wer wollte die Bilanz ziehen zwischen der schöpferischen Freude, die er dabei Jahre hindurch genoss, und der Sorgenlast, in die sich alles in den Jahren wirtschaftlichen und kulturellen Niederganges wandelte, bis zuletzt nur der unerfüllte Wunsch blieb, dem Moloch, zu dem dieser Besitz geworden war, zu entfliehen, sich der Schuldenlast durch Verkauf zu entledigen. Ungerechtfertigte Steuern, mit denen sein Berliner Theaterbesitz nach 1933 belastet worden war, um ihn der Regierung in die Hände zu spielen, hatten zu der Katastrophe beigetragen und im Zusammenhang damit auch seinen österreichischen Besitz bedroht. Schließlich beschlagnahmte die Gestapo im Juli 1938 Schloss Leopoldskron. Max Reinhardt nahm die Nachricht dieses Verlustes mit stoischer Ruhe auf. In einem Satz fasste er zusammen, was er dazu zu sagen hatte: »Ich habe es gehabt.«
Der Raub Leopoldskrons wurde nach der Einnahme von Salzburg durch die Amerikaner rückgängig gemacht. Max Reinhardt hat es nicht mehr erlebt.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.