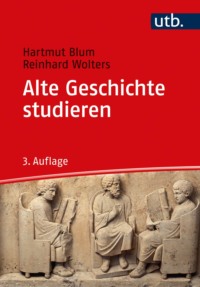Kitabı oku: «Alte Geschichte studieren», sayfa 3
1.3.8 Ästhetischer Reiz
Für viele schließlich zeichnet sich die Beschäftigung mit der Alten Geschichte durch einen besonderen ästhetischen Anreiz aus. Er resultiert vor allem aus der dichten Integration der materiellen Überreste in das althistorische Arbeiten, mit ihrer teils hervorragenden künstlerischen Qualität, aber auch aus der sprachlichen und formalen Perfektion zahlreicher literarischer Quellen. Auch dieser ästhetische Anreiz ist ein legitimes Interesse der bevorzugten Auseinandersetzung mit der Alten Geschichte, soweit dabei die Historizität des Gegenstands gewahrt bleibt und er nicht zum Fokus einer der Gegenwart entfliehenden Antikenbegeisterung wird – oder gar die Gegenwart gegen eine so gezeichnete Antike ausspielt. In einer Zeit nahezu unbegrenzter Reisemöglichkeiten, die das vergangene Fremde als Erlebnislandschaft inszeniert und zur Teilhabe einlädt, zu einer ihnen angemessenen Beurteilung der antiken Kulturen zu kommen, ist ein weiterer Aspekt für den Gewinn, der sich aus einer kritischen Beschäftigung mit der Antike auch für die Gegenwart erzielen lässt.
1.4 Die Geschichte des Fachs
In den bisherigen Bemerkungen ist bereits mehrfach angeklungen, wie prägend die Forschungsgeschichte und Wissenschaftstradition der Alten Geschichte für unsere Beschäftigung mit der Antike in der Gegenwart immer noch ist. Dass bei folgender Skizzierung die deutschsprachige Entwicklung in den Vordergrund tritt, legitimiert sich auch durch die bis in das beginnende 20.Jahrhundert von hier ausgegangenen Impulse.
1.4.1 Zwischen PhilologiePhilologie und UniversalgeschichteUniversalgeschichte
Die Anfänge der Alten Geschichte als Fach wird man sinnvollerweise in RenaissanceRenaissance und HumanismusHumanismus verorten. Zwar beschäftigte sich bereits die Antike intensiv mit der eigenen Vergangenheit und entwickelte die Historiographie zu einer bedeutenden Gattung (→ Kap.2.2.5–2.2.7), und auch im MittelalterMittelalter verfolgte man in den Chroniken die eigene Geschichte bis in die Antike zurück. Doch erst durch die ,Entdeckung‘ des Mittelalters und damit die – trotz gefühlter inhaltlicher Nähe – Erfahrung der zeitlichen Distanz und Abgeschlossenheit der Antike wurde diese eigentlich zu einem eigenen Gegenstand (→ Kap.1.1.2). In den mittelalterlichen Chroniken hingegen hatte man die Geschichte des Altertums noch ungebrochen als eigene Vorgeschichte behandelt, die in christliche Deutungskonzepte eingebunden war.
Der neue Blick auf die Antike zu Beginn der NeuzeitNeuzeit war der eines Staunens und Bewunderns. Man sah in der Antike ein überzeitliches Vorbild, dem es auch in der Gegenwart uneingeschränkt nachzueifern galt. Für Fragen des eigenen Seins holte man sich Rat bei der Antike, und ihre normative Geltung schien alle Bereiche des Lebens zu umfassen. Das Wissen über diese Zeit gewann man aus den Texten der griechisch-römischen Autoren. Der wichtigste Weg zur Vermehrung dieses Wissens wurde entsprechend das Aufspüren noch unbekannter Texte: Während des 14. und 15. Jahrhunderts reisten die Gelehrten zu allen Bibliotheken Europas. Dank der Erfindung des Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhunderts konnten die neu gefundenen Texte rasch verbreitet werden.
Altertumswissenschaft in dieser Zeit war Klassische PhilologiePhilologie, und die Autorität der Texte war unbestritten. Um Hilfen für ihr Verständnis bereitzustellen, entwickelte sich eine spezielle Form von Lexika und THESAURI, welche die Begriffe, die Realien des religiösen oder privaten Lebens bzw. jene des Staates wie Recht, Verfassung und Verwaltung erläuterten. Sie hätten Ansätze für einen auf die geschichtlichen Verhältnisse dieser Dinge verweisenden Sachkommentar bieten können. Doch ihrem Verwendungszweck als Hilfsmittel entsprechend präsentierten diese Werke ihre Gegenstände eher statisch: Das verändernde, dynamische Element galt ganz dem Text.
Das Erkennen der Antike als eigene Epoche mit dem Kontinuitätsbruch zum MittelalterMittelalter provozierte jedoch auch genuin historische Fragestellungen, und in derartigen universalhistorischen Betrachtungen liegt die zweite Wurzel für die Alte Geschichte als Fach. Aus der Erfahrung der DiskontinuitätDiskontinuität resultierten Niccolò MachiavelliMachiavelli, Niccolòs (1459–1527) Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1531 [postum]), in denen er, ausgehend vom Niedergang des römischen Imperiums, die Ursachen des Aufstiegs und Niedergangs der Völker zu ergründen suchte. Ähnlich versuchte Charles MontesquieuMontesquieu, Charles (1689–1755) in seinen Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734) aus der Betrachtung der römischen Geschichte allgemeine Gesetze zu gewinnen. Beiden ging es darum, aus der Geschichte Lehren für die Gegenwart zu ziehen. Das jeweils in die eigene Gegenwart hineinwirkende Thema des Niedergangs wurde dann in dem voluminösen Werk von Edward GibbonGibbon, Edward (1737–1797) History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776–1788) weit ausholend untersucht und erzählerisch zur Darstellung gebracht. Gibbon maß dem ChristentumChristentum eine entscheidende Bedeutung für den Auflösungsprozess des römischen Reiches zu (→ S.23).
Der Beginn einer zweiten äußerst wirkungsmächtigen Phase der Antikenrezeption kann mit dem Wirken von Johann Joachim WinckelmannWinckelmann, Johann Joachim (1717–1768) verbunden werden: der NeuhumanismusNeuhumanismus oder – wegen des engen Bezugs auf Griechenland – der NeuhellenismusNeuhellenismus. Auf der Suche nach Wegen zur Erneuerung der Kunst in seiner eigenen Gegenwart fand Winckelmann in der griechischen Kunst ein Ideal, das er in den Rang überzeitlicher Geltung erhob. Doch Winckelmann ging noch weiter: Ursache dieses Kunstschaffens war für ihn ein ebenso ideales Menschentum der Griechen, für dessen Entwicklung wiederum die politische Freiheit, wie er sie im AthenAthen der klassischen Zeit fand, den politischen Rahmen geboten habe: Kunstschaffen und politische Ordnung, Freiheit, Ästhetik und Menschentum griffen bei Winckelmann ineinander und forderten die Gegenwart: „Der einzige Weg für uns, groß, ja wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten“ (1755).
Winckelmanns überragender Einfluss erstreckte sich nicht nur auf das Schaffen Goethes, Schillers oder Hölderlins und beflügelte die Griechenbegeisterung des 18. und 19. Jahrhunderts; seine Ideen wurden bei Wilhelm von HumboldtHumboldt, Wilhelm von (1767–1835) ganz konkrete Grundlage für die Reform des preußischen Schulwesens: Auf dem Weg zur Erreichung einer allgemeinen ,Bildung‘ wurde das GymnasiumGymnasium zur entscheidenden Lehranstalt erhoben, und in dessen Unterrichtsplan nahmen die alten Sprachen eine herausragende Stellung ein. Nicht anders war es an den Universitäten, wo die Klassische PhilologiePhilologie zum zentralen Fach der Philosophischen Fakultäten aufstieg.
Quelle: Wilhelm von Humboldt: Das Vorbild der Griechen
„Wir haben in den Griechen eine Nation vor uns, unter deren glücklichen Händen alles, was, unserem innigsten Gefühl nach, das höchste und reichste Menschendasein bewahrt, schon zu letzter Vollendung gereift war … Ihre Kenntnis ist uns nicht bloß angenehm, nützlich und notwendig, nur in ihr finden wir das Ideal dessen, was wir selbst sein und hervorbringen möchten; wenn jeder andere Teil der Geschichte uns mit menschlicher Klugheit und menschlicher Erfahrung bereichert, so schöpfen wir aus der Betrachtung der Griechen etwas mehr als Irdisches, ja beinahe Göttliches“ (Wilhelm von HumboldtHumboldt, Wilhelm von, Werke in 5 Bänden [hg. v. A. Flitner u. K. Giel], Bd.2, 4. Aufl., Darmstadt 1986, S.92).
Wie in der Zeit des HumanismusHumanismus war die Antike wieder zu einem überzeitlichen Vorbild geworden, bei der das Einst und das Jetzt miteinander zu verschmelzen drohten. War die Aneignung der Antike im Humanismus von ihren Voraussetzungen allerdings eher überstaatlich angelegt, so verengte der im 18. und 19.Jahrhundert aufkommende NationalstaatNationalstaat die Perspektive: Der Rückbezug und die Orientierung an den Griechen blieb ein vorrangig deutsches Phänomen. Zu ihrem nachfühlenden Verständnis glaubte man sich als Nation – und im Gegensatz zu den anderen – besonders disponiert. Damit war einerseits ein Gegenstand gefunden, der zur Ausbildung einer eigenen kulturellen Identität beitragen konnte, andererseits – und damit im Zusammenhang stehend – grenzte sich diese Identifikation insbesondere von Frankreich ab, der führenden Kulturnation in EuropaEuropa, die in vielfacher Weise das römische Erbe pflegte. Die Französische RevolutionFranzösische Revolution hatte geradezu einen Kult der römischen Republik entwickelt, was dann in der Zeit der Freiheitskriege zur verschärften Hervorhebung des ,Römer-Hellenen-Gegensatzes‘ zwischen Franzosen und Deutschen führte: Der Rückbezug auf je eine andere antike Vergangenheit wurde jetzt als Instrument der Abgrenzung genutzt.
Von Winckelmann ausgehend ist noch eine andere, durchaus gegenläufige Entwicklungslinie zu verfolgen. Sie ebnete einer Historisierung der Antike den Weg: Bei seiner Betrachtung der griechischen Kunst unterschied Winckelmann Stile, die er bestimmten Zeitstufen zuordnete. Damit war nicht nur der Entwicklungsgedanke für die antike Kunst – und als Konsequenz: für alle Überreste aus der Antike – eingeführt, sondern die stilgeschichtliche MethodeMethode, die allein von den materiellen Überresten ausging, befreite deren Einordnung und Verständnis auch aus der Abhängigkeit von den antiken Texten. Ihnen konnten die Objekte nun eigenständig gegenübertreten. Waren bisher schon Inkonsequenzen oder Widersprüche in der literarischen Überlieferung bemerkt worden, so bestand nun die Chance, die materiellen Altertümer als unabhängige Zeugnisse zur Überprüfung der Texte heranzuziehen.
Ein umfassendes Konzept einer weit verzweigten Altertumswissenschaft ist dann in diesem Sinne von Christian Gottlieb HeyneHeyne, Christian Gottlieb (1729–1812) entwickelt und insbesondere von Friedrich August WolfWolf, Friedrich August (1759–1824) systematisch dargelegt worden: Der Übergang von der normativen Aneignung der Texte zur kritischen Auseinandersetzung ist darin bereits vollzogen. Die PhilologiePhilologie wurde zu einer umfassenden, in sich differenzierten Altertumswissenschaft geweitet, deren verschiedene Teile gleichberechtigt waren und als akademisches Fach gemeinsam der objektiven Erkenntnis verpflichtet. Ziel war es, die Philologie zur „Würde einer wohlgeordneten philosophisch-historischen Wissenschaft“ zu erheben.
Wolfs historischer, auf die Sache bezogener Ansatz traf innerhalb der PhilologiePhilologie allerdings auch auf erheblichen Widerspruch. Viele Philologen wollten den Gegenstand ihres Faches nicht über die sprachliche und formale Analyse der Texte hinaus ausdehnen. Auch aus diesem Widerspruch heraus öffnete Wolfs Konzept den Raum für eine ,Alte Geschichte‘ als eigenes Fach. Bahnbrechend für die inhaltliche Ausdifferenzierung wurde dann letztlich der Politiker und wissenschaftliche Autodidakt Barthold Georg NiebuhrNiebuhr, Barthold Georg (1776–1831). In seinen Untersuchungen zur römischen Republik begriff er die literarischen Quellen nicht als Wirklichkeit abbildende, quasi protokollarische Notizen eines vergangenen Geschehens, sondern er interpretierte sie als an Gattungstraditionen und Absichten gebundene literarische Texte aus der Antike. Ziel einer Kritik dieser Quellen müsse es sein, durch die Darstellungen hindurch zum tatsächlichen vergangenen Ereignis selbst vorzustoßen. Erst auf der Grundlage eines so herauspräparierten Geschehens könne dann Geschichte beschrieben werden: Vergangenheit und Darstellung der Vergangenheit, das Geschehen selbst und die darüber berichtenden antiken Texte traten auseinander. Damit war der Platz für eine Alte Geschichte neben der Klassischen Philologie umrissen.
August BoeckhBoeckh, August (1785–1867) war einer der ersten, der eine so neu gewonnene, nicht mehr antiquarisch nacherzählende ,Alte Geschichte‘ vorexerzierte: In seiner „Staatshaushaltung der Athener“ (1817) verband er die literarische Überlieferung in souveräner Weise mit den Realien. Insbesondere die konsequent ausgewerteten Inschriften erlaubten ihm eine genuine Darstellung der athenischen Wirtschaft in klassischer Zeit. Da nach diesem Ansatz die gesamte Hinterlassenschaft dem Verständnis des historischen Geschehens nutzbar gemacht werden sollte, konnten in der Folge auch Archäologie, Epigraphik und Numismatik ihren Stellenwert ausbauen (→ Kap.2.3–2.6).
Die fortschreitende Historisierung der PhilologiePhilologie und der Skeptizismus der kritisch-philologischen MethodeMethode waren überdies geeignet, der Antike die Vorbildfunktion zu nehmen: Die wissenschaftlichen Standards genügende Beschäftigung mit ihr unterhöhlte das Idealitätspostulat. Die gültige, über die Antike hinausgehende Formulierung stammt von Leopold von RankeRanke, Leopold von (1795–1886), nach der „jede Epoche unmittelbar zu Gott“ und von gleicher Dignität sei. Das Abgehen von der Vorbildlichkeit öffnete jetzt auch stärker den Blick auf die jenseits der KlassikKlassik stehenden ‚Ränder‘ der Antike, wie HellenismusHellenismus und SpätantikeSpätantike, oder ebnete den Weg zu einer Geschichte des Altertums unter Einschluss der orientalischen Kulturen: Etwa Johann Gustav DroysenDroysen, Johann Gustavs (1808–1884) „Geschichte des Hellenismus“ (1833–1848), Otto SeeckSeeck, Ottos (1850–1921) „Geschichte des Untergangs der antiken Welt“ (1895–1920) oder Eduard MeyerMeyer, Eduards (1855–1930) „Geschichte des Altertums“ (1884–1902).
Die Ausdifferenzierung der Altertumswissenschaften spiegelte sich auch im institutionellen Ausbau der deutschen Universitäten, wo sich neben der PhilologiePhilologie die Klassische Archäologie und Alte Geschichte als Fächer etablieren konnten: Am Ende des 19. Jahrhunderts waren alle drei an nahezu sämtlichen deutschen Universitäten vertreten. Flankiert wurde die Institutionalisierung der Alten Geschichte durch Ausdifferenzierungen der Geschichtswissenschaft, wo sich jetzt auch die sog. Mittlere und Neuere Geschichte als eigene Teildisziplin etablierte. Ein bleibendes Charakteristikum der Alten Geschichte ist seitdem eine spezifische Zwischenposition, deren institutionelle Klärung immer wieder ansteht: Versteht sie sich – als ein Erbe der UniversalgeschichteUniversalgeschichte – in erster Linie als ein auf eine bestimmte Epoche spezialisierter, doch von ihr nicht zu lösender Teil der Allgemeinen Geschichte, oder aber findet sie ihre Heimat, dem Traditionsstrang der Erweiterung der Philologie folgend, vorrangig als Teil einer umfassenden Wissenschaft vom Altertum.
Die breite, auch die Grundlagenwissenschaften einschließende Ausdifferenzierung und gute Platzierung an Universitäten und Akademien in organisatorischer Hinsicht, die Strenge des methodischen Vorgehens, verbunden mit einem Objektivitätsanspruch in inhaltlicher Hinsicht, schließlich die Menge und Gediegenheit der vorgelegten Arbeiten sicherten den deutschen Altertumswissenschaften in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine international überragende Rolle. Ihren Exponenten fanden sie in dem Politiker, Historiker und Nobelpreisträger Theodor MommsenMommsen, Theodor: Neben den eigenen Forschungen trat er als Initiator zahlreicher Großprojekte auf – Projekte, die zum Teil bis in unsere Gegenwart fortgeführt werden.
1.4.2 Forschungsfelder
Beherrschender Gegenstand der Alten Geschichte nach ihrer Lösung aus der PhilologiePhilologie war die politisch-militärische EreignisgeschichteEreignisgeschichte. Zum Teil wurde diese Perspektive durch die antiken Quellen, zumal die historiographischen, vorgegeben. Doch eine Geschichte der Staaten, die sich wiederum primär in ihrem Verhältnis zu anderen Staaten zu artikulieren schien, entsprach ebenso den Erfahrungen und Denkweisen der Gegenwart. Denn auch eine mit philologisch-historischer Kritik ausgerüstete Wissenschaft konnte sich den zeitgenössischen Erlebnissen und Vorstellungen nicht immer entziehen (→ Kap.3.1.4): So wird in Theodor MommsenMommsen, Theodors Mitte des 19. Jahrhunderts abgefasster Geschichte der römischen Republik die kontinuierliche Expansion der Stadt am Tiber als eine äußerst positiv beurteilte nationalstaatliche Einigung – in diesem Fall: Italiens – beschrieben, die durch RomRom vorangetrieben worden sei.
Info: Theodor Mommsen
Theodor MommsenMommsen, Theodor (1817–1903), Forscher, Wissenschaftsorganisator, aktiver liberaler Politiker und Träger des Nobelpreises für Literatur war der überragende Altertumswissenschaftler in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Seine Forschungen und die von ihm initiierten Großprojekte prägten die Entwicklung des Fachs während des gesamten 20. Jahrhunderts und wirken bis in unsere Zeit.
In souveräner Weise beherrschte und verband Mommsen die verschiedensten Quellengruppen und Methoden genauso wie die Kunst der Darstellung. Hauptwerke unter seinen mehr als 1500 Veröffentlichungen sind seine „Römische Geschichte“ (Bde. 1–3: 1854–1856; Bd.5: 1885; der vierte Band über die römischen Kaiser ist nie erschienen), die „Geschichte des römischen Münzwesens“ (1860), das „Römische Staatsrecht“ (3 Bde.: 1871–1888) sowie das „Römische Strafrecht“ (1899). Hinzu kommen zahlreiche Editionen in monographischer Form: Bedeutende historische Inschriften wie der Maximaltarif des DiokletianDiokletian (1851) oder die Res Gestae Divi Augusti (1865); Werke spätantiker Autoren wie Cassiodor (1861; 1894), Iordanes (1882) oder Eugipp (1898); Rechtstexte wie die Digesten Iustinians (1868–1870) oder das Corpus Iuris Civilis (1872).
 Abb. 2
Abb. 2
Theodor Mommsen, Foto um 1890
Unter den von Mommsen angestoßenen Großprojekten dominiert das Corpus Inscriptionum Latinarum, dessen ersten Band mit den Inschriften der Römischen Republik er selbst bearbeitete (1863; 21893). Auf Mommsens Initiative geht die Gründung der „Reichs-Limeskommission“ (1892) zurück, ebenso das Corpus Nummorum, der groß angelegte Versuch einer Erfassung aller griechischen Münzen.
Aufgrund seiner Stellung in der Preußischen Akademie der Wissenschaften, der Fakultät der Berliner Universität sowie in der Zentraldirektion des Deutschen Archäologischen Instituts prägte Mommsen den organisatorischen Ausbau der Altertumswissenschaften an den deutschen Universitäten. Zahlreiche Lehrstühle wurden mit seinen Schülern besetzt, die sich vorrangig durch epigraphische Arbeiten ausgezeichnet hatten. Den Nobelpreis für Literatur, als erster Preisträger überhaupt, erhielt Mommsen 1902 für seine in zahlreichen Auflagen verbreitete und äußerst populäre „Römische Geschichte“. Die darstellerische Brillanz und kraftvolle RhetorikRhetorik machen sie noch heute lesenswert.
Besonders eng mit dem Namen Mommsen verbunden ist allerdings ein anderer Forschungsansatz: die Untersuchung von Recht und Verfassung. Höhepunkt unter seinen zahlreichen juristischen Werken ist fraglos sein monumentales „Römisches Staatsrecht“. Auch wenn das Buch aufgrund seiner ordnenden Struktur und des souveränen Quellenbezugs noch immer ein vorzügliches Hilfsmittel ist, so hat Mommsen sich durch seinen völlig einseitigen, der systematischen Rechtsschule entlehnten Ansatz, den Staat ausschließlich als Rechtssystem zu erfassen, doch selbst Grenzen gesetzt. Besonders deutlich werden sie bei der Nachzeichnung des Übergangs von der Republik zur Kaiserzeit, wo gesellschaftliche Bedingungen des neuen politischen Systems nur wenig Berücksichtigung finden. Mommsens Entwurf setzte eine Stabilität der Rechtsnormen und der Begriffe geradezu axiomatisch voraus.
So waren es dann vor allem sozialgeschichtliche Ansätze, später dann die Verknüpfung von Verfassung und Gesellschaft, die einen dynamischeren Erklärungsrahmen boten. Mit Gewinn wurden jetzt auch das Recht und die Verfassung konsequent als sich entwickelnde und Veränderungen unterworfene Gegenstände betrachtet. Ein früher Markstein der soziologischen Perspektive war Matthias GelzerGelzer, Matthiass (1886–1974) „Die Nobilität der römischen Republik“ (1912). Nicht zuletzt durch die im akademischen Unterricht weit verbreiteten Werke von Jochen BleickenBleicken, Jochen (1926–2005) ist die gemeinsame Berücksichtigung von Gesellschaft, Recht und Verfassung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Standard geworden.
Unberührt blieb die Alte Geschichte aber auch nicht von den geschichtsdeutenden Modellen des 19. Jahrhunderts, die in den wirtschaftlichen Verhältnissen die Grundlage jeder politischen und gesellschaftlichen Entwicklung sahen. Im Streit zwischen ,Primitivisten‘, welche der Antike im Rahmen linear-fortschrittlicher Vorstellungen nur einen begrenzten Entwicklungsstand unterstellten, sowie ,Modernisten‘, welche die Vergleichbarkeit zwischen antiken und gegenwärtigen Wirtschaftsformen postulierten und zum gegenseitigen Verständnis nutzbar machten, ging es auch darum, in wie weit die Antike für Gegenwartsfragen relevant sein konnte. Gegen die Positionen von Karl BücherBücher, Karl (1847–1930) setzten insbesondere Eduard MeyerMeyer, Eduard (1855–1930) und Karl Julius BelochBeloch, Karl Julius (1854–1929) ihr modernisierendes Verständnis von der antiken Ökonomie. Unter dem Einfluss kulturanthropologischer Modelle, welche den primitivistischen Positionen näher standen, wurde die bereits als ‚JahrhundertdebatteJahrhundertdebatte‘ historisierte Diskussion in den 1960er und 1970er Jahren mit Vehemenz wieder aufgenommen und noch bis fast ans Ende des ideologisierten 20. Jahrhunderts fortgeführt. In der zugespitzten Diskussion hatten vermittelnde Positionen Schwierigkeiten, Gehör zu finden. Allerdings brachte die Kontroverse auch hervorragende Grundlagenarbeiten zur antiken Wirtschaft – wie die monumentalen Arbeiten von Michael RostovtzeffRostovtzeff, Michael (1870–1952) –, zum Wirtschaftsdenken – wie die „Ancient Economy“ von Moses I.Finley (1912–1986) – oder auch zum antiken Handel hervor. Es scheint, dass eine gewisse Erschöpfung durch diese Debatte Schuld daran trägt, wenn die antike WirtschaftsgeschichteWirtschaftsgeschichte heute längst nicht die Rolle spielt, die man aufgrund des vorherrschenden, alle gesellschaftlichen und politischen Bereiche durchziehenden wirtschaftlichen Paradigmas in unserer Gegenwart erwarten sollte.