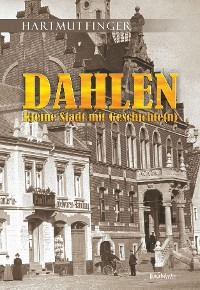Kitabı oku: «Dahlen - Kleine Stadt mit Geschichte(n)», sayfa 2
Bronzezeitliche Besiedlung
Nach neuesten Erkenntnissen gingen die Angehörigen der Kultur der Schnurkeramiker und die der Glockenbecherkultur untereinander auf; sie vermischten sich. Um etwa 1800 bis 1500 vor der Zeitenwende erreichten sie in unserer Region eine höhere Entwicklungsstufe. Der wesentlichste Fortschritt war, dass sie sich nun auf die Produktion und Bearbeitung von Metall verstanden. In diesem Fall war es die Herstellung von Bronze.
Bronze ist eine Legierung von etwa 80 % Kupfer und 20 % Zinn. Der Anteil von Zinn kann etwas variieren. Je nachdem, ob mehr oder weniger Zinn zugesetzt wird, ist die Bronze härter oder weicher. Dies richtete sich meist nach dem Zweck der Anwendung, ob zum Beispiel Werkzeuge, Waffen oder Schmuck hergestellt werden sollten. Die Erzeugung und Verarbeitung von Bronze entwickelte sich zuerst im Mittelmeerraum.
Den Zeitraum, samt der zugehörigen Kultur, in dem im jetzigen deutschsprachigen Raum erstmalig die Fertigung und Verarbeitung von Bronze praktiziert wurde, nennt man „Ältere Bronzezeit“. Man darf jedoch nicht annehmen, dass nun in jeder Siedlung Bronze herstellt wurde. Diese Technologie war damals wie auch heute noch eine Arbeit für Spezialisten. So waren es vor allem die Herren der bronzezeitlichen Burgen, die diese Fachkräfte bei sich ansiedelten, um von dieser Technologie zu profitieren.
Auch wenn er nicht unmittelbar aus dem uns interessierenden Gebiet stammt, so soll der wohl berühmteste Fund der letzten Jahre aus dieser Kultur – die Himmelsscheibe von Nebra nebst dem dazugehörigen Observatorium – nicht unerwähnt bleiben.
Die Vertreter dieser Kultur ließen sich, wie schon die Bandkeramiker und die Angehörigen der Glockenbecherkultur, ebenfalls nur in Altsiedelland nieder. Damit haben wir in und um die Dahlener Heide auch von ihnen keine Siedlungsnachweise.
Die Kultur der „Älteren Bronzezeit“ unserer Gegend entwickelte sich in der Zeit von etwa 1400 bis 750 vor der Zeitenwende weiter. Es war aber nicht die Einführung einer neuen Technologie, die eine größere Veränderung brachte. Auch die Angehörigen dieser Kultur verstanden sich auf die Verarbeitung und Herstellung von Bronze. Entsprechend ihrer Einordnung werden diese Kulturen „Mittlere-“ bzw. „Jüngere Bronzezeit“ genannt. Das wirklich Neue dieser Kulturepoche war, dass wir erstmalig eine flächendeckende Besiedlung unserer Region vorfinden. Damit ist auch erstmals das Gebiet in und um die Dahlener Heide als Siedlungsgebiet nachgewiesen.
Die Kulturen der Mittleren- als auch der Jüngeren Bronzezeit gehören zur sogenannten „Lausitzer Kultur“. Die Angehörigen der Mittleren Bronzezeit hinterließen die zahlreichen Hügelgräber in unserer Gegend, während die Angehörigen der Jüngeren Bronzezeit ihre Toten vorwiegend in Flachgräbern bestatteten. Beide Kulturen führten ausschließlich Brandbestattungen durch. Die Hügelgräber in der Dahlener Heide erhielten zudem rundum einen Kranz großer Felsbrocken. Eine Gruppe von 17 Hügelgräbern befindet sich in der Nähe von Bucha südwestlich des Lattenberges. Im Schmannewitzer Gebiet um Dahlequelle und Jägereiche sind ebenso einige Hügelgräber noch erkennbar. Besonders markant sind die 46 Hügelgräber im „Ramschen Holz“ zwischen Ochsensaal und Forstbaumschule. Es gibt aber auch noch einige andere Stellen in der Dahlener Heide, an denen eine Häufung von Hügelgräbern zu verzeichnen ist.

Urne mit Resten von Leichenbrand, Lausitzer Typus (gefunden bei Bucha)

Hügelgrab im Ramschen Holz, Mittlere Bronzezeit (14. Jh. v.u.Z.)

Die Hügelgräber im Ramschen Holz

Hervorragend erhaltene Keramiken aus der mittleren Bronzezeit (gefunden in der Dahlener Heide)
In beiden Kulturen, der Mittleren wie auch der Jüngeren Bronzezeit, wurde Ackerbau und Weidewirtschaft betrieben, wobei hier vor allem die sogenannte Waldweide eine Rolle spielte. Aber auch die Herstellung von Werkzeugen aus Stein war in dieser Epoche trotz Bronzeherstellung noch weit verbreitet.

Sogenanntes Flachbeil aus Bronze
(Heimatmuseum Dahlen)

Steinbeil aus der jüngeren Bronzezeit, hier hergestellt.
(Heimatmuseum Dahlen)
Im Heimatmuseum von Dahlen haben wir 3500 Jahre alte Steinbeile, welche im Ortsteil Schwarzer Kater gefunden wurden. Das Material dieser Beile besteht aus Gestein aus unserer Gegend. Daher kann man annehmen, dass sie auch hier angefertigt wurden. Wenn man sich die Bohrungen in den Beilen einmal genauer betrachtet, kommt man nicht umhin zu vermuten, dass es zu jener Zeit Spezialisten für dieses Handwerk gegeben haben muss. Die Bohrlöcher wurden mit sehr großem Geschick mittels Kernbohrtechnik angefertigt. Hierzu wurde auf die zu bohrende Stelle als Bohrmittel Quarzsand und Wasser aufgebracht und darauf ein hohler Holzstab oder auch ein Röhrenknochen gedreht. Es versteht sich, dass dies eine sehr langwierige Arbeit war, und ein solches Werkzeug für die Menschen der damaligen Zeit entsprechend wertvoll gewesen sein musste. Ob unsere Vorfahren diese Fertigkeiten selbst entwickelt haben oder ob man sie aus dem Mittelmeerraum übernommen hat, lässt sich heute nicht mehr klären. In Ägypten wendete man zur selben Zeit diese Methode des Lochbohrens beim Bau von Tempeln an. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, auch das Rad wurde mehrfach erfunden.
Wie bereits erwähnt, war diese Kultur die erste, die in unserem Gebiet flächendeckend siedelte. So ist es auch nicht außergewöhnlich, dass wir unmittelbar im Stadtgebiet von Dahlen eine Fundstelle einer Besiedlung aus der Jüngeren Bronzezeit haben. Dieser Ort befand sich auf dem nach Süden abfallenden Hang des Weinberges zwischen Jugendherberge und Eigenheimsiedlung. 1996 führte man dort eine archäologische Grabung durch, wobei eine Fläche von insgesamt 1,9 ha dokumentiert wurde. Hierbei kam einiges Interessante zu Tage.

Überblick über den nördlichen Teil des Grabungsgeländes
Im Nordteil der Ausgrabung wurden drei komplette Hausgrundrisse gefunden. Es handelt sich um rechteckige (ca. 8,6 m x 5,9 m) Häuser mit einer kreisförmigen Kochgrube aus der Jungbronzezeit (zwischen 1000 u. 800 v. Chr.). Die Datierung wurde anhand von Scherbenfunden in den Häusern vorgenommen. Dabei fand man 6 verschiedene Dekors aus der Bronzezeit (zum Beispiel Randscherben mit Daumen und Holzstäbchenabdruck). Weiterhin wurden mehrere Lehmgruben mit Feuerstelle (kleine Brandgruben) lokalisiert, die jedoch als Wohnraum zu klein erscheinen. Sie haben vermutlich als Arbeitsstelle gedient. Was hier angefertigt oder verarbeitet wurde, konnte allerdings nicht festgestellt werden. Des Weiteren entdeckte man im nördlichen Teil der Ausgrabung mindestens 10 kastenförmige Gruben mit einem Querschnitt von etwa 1 m x 0,50 m x 0,80 m, die zahlreiche Scherben enthielten. In einer Grube lag ein großer Stein von etwa 0,50 m Durchmesser. Von Fachleuten werden solche Befunde in der Regel als Erdsilos bzw. Vorratsgruben interpretiert. In ihnen standen zum Beispiel mit Getreide gefüllte Gefäße. Man geht davon aus, dass die Gruben mit Holz oder Bast abgedeckt waren, wobei ein Stein als Gewicht darauf gelegt wurde, der so zusätzlich noch für eine bessere Abdichtung der Grube sorgte. Auf Grund des gesamten Befundes der Ausgrabung kann man davon ausgehen, dass sich auf dem Dahlener Weinberg eine gut strukturierte kleine bronzezeitliche Siedlung befunden hat. Vergleichbare Funde, wie die der Dahlener Ausgrabung sind relativ selten, sodass die hiesige Ausgrabung schon etwas Besonderes darstellt. Sie ist eine der ganz wenigen Fundstellen im Gebiet der Lausitzer Kultur, in der außer Siedlungsgruben auch komplette Hausgrundrisse nachgewiesen wurden.

Rekonstruktion der bronzezeitlichen Siedlung von Dahlen. Wie hoch die Häuser waren, ob sie Fenster besaßen und aus welchem Material diese waren, muss offen bleiben
(Zeichnung B. Richter).
Warum diese Siedlung letztlich wieder aufgegeben wurde, konnte nicht geklärt werden. Ein kriegerisches Ereignis scheint allerdings nicht in Frage zu kommen, da keine Brandrückstände von den Häusern gefunden wurden. Diese sind offensichtlich im Laufe der Zeit von selbst verfallen. Denkbar ist eine Klimaveränderung als Ursache für den Wegzug der hiesigen Bewohner. Nachgewiesen ist, dass die bronzezeitliche Bevölkerung aus der Dahlener Heide, ebenso wie aus der Dübener Heide, am Ende der Bronzezeit abgewandert ist. Die Menschen sind vermutlich in die Niederungen der Elbe oder anderer Flüsse gezogen.
An den noch verbliebenen bzw. den neuen Siedlungsplätzen der Bronzezeitlichen Kultur zeigte sich ab etwa 750 vor der Zeitenwende, dass deren Bewohner eine neue Technologie übernommen hatten. Es handelt sich hierbei um die Herstellung und Verarbeitung von Eisen. Es ist die Kultur der „Frühen Eisenzeit“, die sogenannte „Billendorfer Kultur“, benannt nach einer Fundstelle dieser Kultur, die im jetzigen Polen liegt. Die Billendorfer Kultur steht in direkter Nachfolge der Lausitzer Kultur. Damit handelt es sich um die gleiche Bevölkerung bzw. die direkten Nachfahren der Angehörigen der Lausitzer Kultur. Ihre bevorzugten Siedlungsplätze waren vor allem in der Lausitz sowie beiderseits der Elbe.
Im 6. und 5. Jahrhundert vor der Zeitenwende zeigten sich wiederum bevölkerungspolitische Veränderungen, die auf äußere Einflüsse hinweisen. Diesmal jedoch kam die Zuwanderung nicht – wie zumeist – aus dem Südosten, sondern aus dem Nordwesten. Damit sind es aber auch gänzlich andere Volksstämme, die in unser Gebiet einwanderten. Es handelte sich um Angehörige der „Jastorfkultur“ (benannt nach einer Fundstelle südlich von Hamburg) die man zu den germanischen Volksstämmen zählt. Bei ihnen spricht man auch von den sogenannten „Elbgermanen“. Von ihnen wurde bisher eine starke Besiedlung beiderseits von Elbe und Mulde nachgewiesen. Was unsere Gegend betrifft, so fand man westlich von Cavertitz eine Urne dieser Kultur. Südlich und östlich von Oschatz wurden ebenso Siedlungen dieser germanischen Stämme lokalisiert. Zum Schutz ihrer Gemeinschaft errichteten die Angehörigen dieser Kultur oft mächtige Festungsanlagen, welche meist auf günstig gelegenen Berghöhen lagen und in der Regel aus Erdwällen, Gräben und Palisaden bestanden. Diese Wallanlagen waren so bemessen, dass in Kriegszeiten alle Stammesmitglieder mit ihrem Hab und Gut, einschließlich ihrem Vieh, Zuflucht in ihnen finden konnten. Eine besonders große Anlage dieser germanischen Kultur wurde auf dem Burzelberg in den Hohburger Bergen entdeckt. Hierbei handelt es sich um eine 6 ½ ha große Wallanlage. Die eisenzeitliche Bevölkerung stand außerdem auch unter starkem kulturellen Einfluss keltischer Gebiete aus dem Südwesten Deutschlands sowie aus Böhmen.
Im gesamten Raum der Dahlener Heide selbst hat man bisher keinen Siedlungsplatz dieser Kultur gefunden.
Römische Kaiserzeit
Alle bisherigen geschichtlichen Aussagen basierten auf archäologischen Funden bzw. Befunden. Nun aber kommen Informationen aus Quellen hinzu, die ein wesentlich vielfältigeres Bild unserer Vorfahren zeichnen. Von nun an berichten auch schriftliche Zeugnisse über das Geschehene in unserer Region. Ab dieser Zeit ist es möglich, über Einzelschicksale oder auch ganz spezifische Ereignisse detaillierte Kenntnis zu erhalten. Damit avancieren diese Quellen zu einem ungleich wichtigeren Teil der Überlieferungen. Natürlich gab es in anderen Zivilisationen (Mesopotamien, Ägypten, Kreta) die Schrift schon Jahrtausende früher. Dass diese schriftlichen Hinterlassenschaften jedoch nichts über unser Gebiet enthalten, liegt aber auf der Hand.
Die Ersten, die schriftliche Zeugnisse über unsere Vorfahren verfassten, waren allerdings auch Schreiber anderer Zivilisationen, vornehmlich aus dem Mittelmeerraum. So stammen die frühesten schriftlichen Hinterlassenschaften über unsere Urahnen fast ausschließlich von griechischen Geschichtsschreibern, welche aber zumeist auch nur vom Hörensagen berichteten. Später, in der Epoche der Zeitenwende, wurden die Berichte von römischen Chronisten wie Tacitus oder Cäsar verfasst, welche aber eher die Sichtweise des Gegners und kulturell überlegenen Eroberers wiedergaben. Sie prägten über viele Jahrhunderte das Bild, wonach hier sehr primitive, zum Teil in einer Urgesellschaft lebende Völker, siedelten. Die Römer bezeichneten das Land zwischen Rhein und Elbe als Germanien. Aber erst Jahrhunderte später kam der Begriff von „den Germanen“ auf. Deshalb soll zunächst an dieser Stelle erst einmal Folgendes vorangestellt werden:
„Die Germanen“ als ein Volk zwischen Rhein und Elbe hat es als solches nie gegeben. Die Bezeichnung „Germanen“, verbunden mit den in Germanien lebenden Völkern, wie wir es im allgemeinen heute verstehen, wurde erst im 19. Jahrhundert üblich. Wer diesen Ausdruck „Germanien“ erstmalig verwendete, ist nach wie vor umstritten. Klar ist nur, dass die Römer dieser Provinz, welche sie zunächst als einen noch unzivilisierten Teil Galliens betrachteten, diesen Namen gaben. Im Siedlungsgebiet Germaniens lebte eine Vielzahl unterschiedlicher Volksstämme, die zumeist ständig gegeneinander Krieg führten. Ein wie auch immer geartetes geeintes Staatswesen hat es zu jener Zeit nie gegeben. Auch die Sprachverwandtschaft der Stämme untereinander brachte keine gemeinsame Identität. Dennoch besaßen diese Stämme und Völkerschaften eine Reihe kultureller Gemeinsamkeiten. Wenn im Folgenden diese Übereinstimmungen beschrieben werden, wird der Begriff Germanen verwendet, auch wenn dies von manchem Historiker als nicht korrekt angesehen wird. An dieser Stelle soll auch gleich noch angefügt werden, dass die Germanen nicht „die ersten Deutschen“ waren. Die Bezeichnung „theodiske“, von dem sich später das Wort „deutsch“ ableitete, taucht erstmals im Jahr 786 in einem Synodalbericht auf. Dieses „theodiske“ hat seinen Ursprung im althochdeutschen „Thiota“ bzw. „Diutisc“, was „zum Volke gehörig bedeutet“. Es gibt aber auch andere Erklärungen zum Ursprung des Wortstammes „Deutsch“, wobei hier verzichtet wird, darauf näher einzugehen.
Der Beginn der „Römischen Kaiserzeit“ wird im Allgemeinen auf das Jahr 15 vor der Zeitenwende festgelegt, jenes Jahr, in dem der römische Imperator Augustus den vollen Umfang seiner Machtbefugnisse erhielt, obwohl er im eigentlichen Sinn kein Kaiser war. Wie bereits erwähnt, war dies in etwa der Beginn der Zeit, von der uns auch schriftliche Überlieferungen über unsere Vorfahren zur Verfügung stehen. Dementsprechend gibt es daher auch eine wesentlich größere Fülle an Informationen. Es ist etwas ganz anderes, wenn wir direkt aus Berichten von Zeitgenossen unserer Vorfahren etwas über die Art und Weise ihres Lebens erfahren und dabei eben auch die Schicksale und Namen Einzelner eine Rolle spielen. Dennoch sind die archäologischen Funde aus dieser wie auch aus späteren Zeiten ein wichtiger Bestandteil historischer Forschungen.
Die Epoche der schriftlichen Überlieferungen eröffnet uns ein weiteres Novum bei der Erforschung der Geschichte unserer Vorfahren: die Benennung der Volksgruppen in unserer Region durch deren Zeitgenossen. Allen bis zu diesem Zeitpunkt bei uns lebenden Völkern wurden die entsprechenden Namen zumeist nach archäologischen Funden von Historikern oder Archäologen gegeben. Dabei verwendeten sie in der Regel typische kulturelle Merkmale, wie „Glockenbecherkultur“ oder auch „Bandkeramiker“. Auch eine Benennung nach geografischen Fundorten wie „Billendorfer Kultur“ oder „Elbgermanen“ ist typisch. Das sind natürlich moderne Klassifikationen. Vergangene Lebenswirklichkeit spiegeln sie nicht wieder, auch wenn Keramikscherben Produkte solcher Lebenswirklichkeiten sind. Daher lassen sich rekonstruierte archäologische „Kulturen“ nicht mit realen Völkern gleichsetzen.
Wie aber haben unsere Vorfahren, etwa in der Epoche der Zeitenwende oder in den Jahrhunderten unmittelbar danach, ihr Leben gestaltet?
Die germanischen Stämme in unserer Heimat lebten zu dieser Zeit überwiegend noch in einer Gentilgesellschaft. Das heißt, es war eine Gesellschaft, deren Strukturen auf Sippen bzw. Verwandtschaftsverhältnissen basierte. Hatte eine Reihe von Sippen bzw. Verwandtschaftsgruppen eines bestimmten Gebietes einen ähnlichen bzw. gleichen kulturellen Entwicklungsstand, der auch zu verschiedenen Kooperationen führte – denkbar ist ein kleiner Handel, aber auch der Tausch von Frauen – so spricht man von einem Stamm. Mehrere dieser Stämme bildeten einen Stammesverband. Stämme und Stammesverbände sind es nun, von denen uns erstmalig die Namen durch Zeitgenossen überliefert wurden. Hierbei soll die Herkunft dieser Namen nicht näher erläutert werden. Diese können zum einen Eigennamen sein, aber auch Namen, die ihnen von Angehörigen anderer Kulturen gegeben wurden. Es sind vor allem römische Geschichtsschreiber, welche jetzt erstmalig Namen einzelner Völkerstämme erwähnen, die die Gebiete nördlich der Donau und östlich des Rheins besiedelten.
Aus den Beschreibungen der Römer ergibt sich in etwa folgendes Bild der Siedlungsgebiete der einzelnen germanischen Stämme zwischen Rhein und Weichsel: An der Weser siedelten die Sachsen und zwischen Saale und Mulde die Warnen; die Langobarden lebten an der mittleren Elbe, die Sueben zwischen Elbe und Oder, die Vandalen an der Oder und die Goten an der Weichsel; die Thüringer, auch Hermunduren genannt, siedelten zwischen Werra und Saale, aber vor allem im Thüringer Becken. Ihr Siedlungsgebiet erstreckte sich darüber hinaus bis in unser Gebiet um Elbe und Mulde. Damit ist der Siedlungsraum der Germanen lediglich in groben Umrissen gezeichnet. Auch sind bei weitem nicht alle germanischen Stämme genannt. Es handelt sich bei dieser Aufzählung um das uns interessierende Gebiet und die für unsere Geschichte relevanten Stämme und Stammesverbände.
Aus römischen Quellen erfahren wir auch, dass die Germanen noch kein Königtum kannten. In Zeiten des Krieges wählten sie einen Stammesfürsten, der damit auch ihr Heerführer war. In Friedenszeiten standen bei ihnen die Sippen- und Stammesältesten sowie ihre Häuptlinge an der Spitze. Nicht zu vergessen ist der Einfluss der Druiden bzw. Medizinmänner. Es wird aber auch berichtet, dass die einzelnen Sippen und Stämme in ständiger Konkurrenz zueinander lebten, was zu häufigen bewaffneten Konflikten untereinander führte. Hier könnte die diesen Stämmen oft nachgesagte kriegerische Mentalität ihren Ursprung haben. Die Versuche der Römer, die germanischen Siedlungsgebiete östlich des Rheins ihrem Weltreich einzugliedern, endeten bekanntlich in der Varusschlacht im Jahr 9 unserer Zeitrechnung mit einem Desaster. Der Freiheitswille der Germanen unter ihrem Anführer Arminius war stärker als ihre internen Zwistigkeiten, Cherusker und Chatten schlugen gemeinsam das römische Heer. Danach blieb der Rhein die Ostgrenze des Römischen Reiches.
Wovon lebten nun die hiesigen Germanen?
Eine wichtige Quelle für die Versorgung mit Nahrungsmitteln war der Ackerbau. Zeugnisse einer Feldwirtschaft dieser Epoche wurden bisher jedoch nur wenige gefunden. Hinzu kam noch eine umfangreiche Viehhaltung, die aber fast ausschließlich als Weidewirtschaft betrieben wurde. In den immer noch riesigen und dichten Wäldern um die Siedlungen spielte die Jagd für die Versorgung mit Fleisch eine entscheidende Rolle und auch die verschiedensten Früchte des Waldes trugen zum Unterhalt bei. Für die an den Flüssen gelegenen Siedlungen hat sicher auch der Fischfang eine Rolle gespielt.
Aus Funden wie auch aus schriftlichen Überlieferungen erfahren wir, dass die hier lebenden germanischen Stämme schon Handel betrieben. Es wurde mit tierischen Produkten – Häuten, Pelzen – und auch mit Bernstein gehandelt. Verbreitet war vor allem der Handel mit Kriegsgefangenen.
Über die Handelsbeziehungen mit den Mittelmeerländern wurde auch praktisches Wissen importiert. So führte die Verarbeitung des Eisens recht bald zu einer Blüte des Schmiedehandwerks in unserer Heimat. Im Gegensatz zur Bronzeherstellung, die nur von wenigen Spezialisten an ausgewählten Orten durchgeführt wurde, fand die Eisenherstellung eine wesentlich größere Verbreitung. Das belegen Funde an zahlreichen Orten. Die benötigten Rohstoffe dafür konnte und kann man auch heute noch überall in den Talniederungen als Raseneisenerz an der Oberfläche finden. Die Versorgung der für die Produktion benötigten Holzkohle war beim Waldreichtum unserer Region sicher auch kein Problem. So fand man in unserer Nähe Plätze, wo man Eisen produziert hat. An der Döllnitz bei Leuben (in der Nähe von Oschatz) wurden mehrere sogenannte Rennöfen, in denen Eisen geschmolzen wurde, nachgewiesen. Gleichzeitig mit der Technologie der Eisenherstellung entwickelte sich das Schmiedehandwerk. So schmiedeten unsere Vorfahren zum Beispiel hochwertige Schwerter, deren Knäufe oft mit Elfenbein, Gold oder Bernstein verziert waren.

Rekonstruktion der Arbeitsweise mit einem Rennfeuerofen; vom Rösten des herausgebrochenen Raseneisenerzes (2) bis zum Verdicken des Eisens (10) (n. Jöns 1993)

Eisenschlacke von Leuben: ein Überbleibsel der vorgeschichtlichen Eisenverhüttung
Cäsar (100–44 v.u.Z.), der römische Feldherr und Eroberer, welcher sich auch als Geschichtsschreiber hervortat, berichtete um 50 v.u.Z., dass die Germanen nicht vollkommen sesshaft gewesen wären. Diese Aussage steht jedoch im Widerspruch zu Cäsars weiteren Angaben, denn er schreibt weiter: „Der Ackerbau sei bei ihnen nur primitiv entwickelt. Sie lockern den Boden nur etwas auf und bebauen ihn nur zwei Jahre hintereinander. Danach lassen sie das Land brach liegen und bebauen neuen Boden. Die Germanen kennen kein Privateigentum von Grund und Boden. Der Boden ist Eigentum der ganzen Sippe, und dementsprechend werden die Felder gemeinsam bestellt und abgeerntet. Ebenso werden die Felderträge auch gleichmäßig verteilt.“ Wer Ackerbau betreibt, muss aber zwangsläufig sesshaft sein. Cäsar berichtet weiter, dass die Grundnahrungsmittel nur zu einem geringen Teil vom Ackerbau kämen. Das Sammeln, die Jagd und eine entwickelte Viehzucht (Weidewirtschaft) bildeten die Basis für die Ernährung. Die Tierhaltung ermöglichte bereits eine kontinuierliche Versorgung mit Milch, Käse und Fleisch.
Dass die hoch entwickelte römische Lebensart aber doch einen Einfluss auf die eher einfache Lebensweise der Germanen ausübte, zeigt sich, wenn man die Berichte des römischen Schriftstellers Tacitus, der 100 Jahre nach der Zeitenwende lebte, liest. Er berichtet, dass die Germanen sesshaft seien und ihren Lebensunterhalt hauptsächlich durch Ackerbau bestreiten. Damit wird die Sesshaftigkeit der Germanen noch einmal bestätigt, wobei wir jedoch registrieren, dass in den 150 Jahren von Cäsar bis zu Tacitus, der Feldbau die Weidewirtschaft als Haupternährungsquelle abgelöst hat. Das ist historisch gesehen eine kurze Zeitspanne für eine derartige Veränderung. Es gab aber weiterhin kein Privateigentum an Grund und Boden. Das Land war immer noch Gemeineigentum der Sippen und Stämme, und ebenso wurde es gemeinsam bearbeitet. Aber auch Cäsar berichtete schon, dass die Erträge nicht grundsätzlich gleichmäßig verteilt wurden. Einige „Würdenträger“ bekamen ganz offensichtlich größere Anteile zugesprochen. Es hatte sich also schon ein Stammes- oder Sippenadel herausgebildet. Ein Teil der germanischen Adeligen ließ die mühsame Feldarbeit von Kriegsgefangenen bzw. von Sklaven durchführen.
Tacitus berichtet weiter, dass die Germanen ihre Felder mit Mergel1 oder kalkhaltigem Boden düngten. Auch der eiserne Pflug hatte schon Eingang in die Landwirtschaft gefunden. Angebaut wurden vor allem unsere heutigen Getreidesorten, aber auch Erbsen, Linsen, Bohnen, Möhren, Flachs, Hanf und Mohn. Das einzige Obst, das die Germanen kannten, waren Wildäpfel. Das Anpflanzen von Steinobst wurde erst nach und nach von den Römern übernommen, ebenso der Anbau von Weinstöcken, der sich sehr rasch im jetzigen Deutschland ausbreitete. Was wiederum einen Hinweis auf den kulturellen Austausch zwischen Germanen und den westlich des Rheins herrschenden Römern gibt. Von Tacitus erfahren wir zudem, dass die Hauptnahrungsmittel der Germanen nun neben Milch, Käse und Fleisch auch Hafergrütze und Butter sind sowie ungesäuerte Brotfladen, die auf heißen Steinen gebacken wurden. Ihren Durst löschten die Germanen hauptsächlich mit einem aus Gerste, Weizen oder Hafer gebrauten bierähnlichen Getränk. Der viel besungene Met wurde aus Honig und Wasser bereitet. Andererseits aber lernten die Römer Butter erst durch die Germanen kennen.
Die Germanen, die aus der bereits hier lebenden bronzezeitlichen Bevölkerung hervorgegangen sind, waren ebenfalls sesshaft. Sie errichteten viereckige Holzhäuser, deren Ritzen sie mit Lehm ausfüllten, bzw. eine Art Fachwerkbau, deren Gefache mit einem meist lehmverschmierten Weidengeflecht ausgefüllt waren. Städte bildeten sich jedoch noch nicht heraus. Die Siedlungen waren einzelne Höfe oder Dörfer, die oft zum Schutz vor wilden Tieren umzäunt wurden. Als Sicherung gegen Überfälle feindlicher Stämme errichtete man auch Pfahlbauten auf dem Wasser.
Im Allgemeinen wird immer noch an dem Irrglaube festgehalten, dass zwischen Rhein und Elbe nur undurchdringlicher Urwald vorherrschte. In vielen Regionen dominierten zum Beispiel Buchenwälder, die aber kaum dichten Bewuchs unter ihren Baumkronen zulassen. Zudem gab es auch zahlreiche offene Landschaften. Gerade durch diese Gegenden in den germanischen Siedlungsgebieten zogen sich schon in vorrömischer Zeit Handelswege. Diese waren allerdings nicht befestigt. So gab es zum Beispiel die „Bernsteinstraße“, die von der Ostsee zur Adria führte oder auch den „Hellweg“, der vom Niederrhein zur Elbe lief. Auch die zahlreichen Flüsse wurden als Transportwege genutzt. So ist es kein Wunder, dass, nachdem die Römer bis zum Rhein vorgedrungen waren, sich auch ein reger Handel mit den östlich des Rheins lebenden Völkern entwickelte. Römische Kaufleute drangen weit in germanisches Gebiet vor und kamen die Elbe und Saale aufwärts auch in unsere Heimat. Die Germanen bezogen von den Römern vornehmlich Metallgegenstände, Wein, Glasgefäße, Schmuck, Stoffe sowie Waffen. Dafür lieferten sie vor allem Kriegsgefangene, Felle, blondes Frauenhaar und Gänsefedern neben Honig und Bernstein. Durch den Handel kamen aber auch verbesserte Technologien wie zum Beispiel in der Eisenverarbeitung nach Germanien.
Bei der nun eingeleiteten gesellschaftlichen Arbeitsteilung war es insbesondere das Schmiedehandwerk, das bei den Germanen in hohem Ansehen stand. Einen Hinweis darauf geben noch heute die Sagen von „Wieland dem Schmied“ und die „Siegfriedsage“, in denen das Schmiedehandwerk eine besondere Geltung erfährt2. Bei Ausgrabungen sind vor allem Hämmer, Ambosse, Feilen und Zangen gefunden worden. Diese Gegenstände lassen erkennen, dass die germanischen Schmiede umfangreiche Fertigkeiten beim Gießen, Schmieden, Nieten, Stanzen, aber auch beim Löten und Gravieren, hatten. Das Schmiedehandwerk war zu jener Zeit „die Hochtechnologie“, wie wir das heute bezeichnen würden.
Auch das Handwerk der Töpferei war, wenn zunächst noch ohne Töpferscheibe, bei den Germanen weit verbreitet. Privateigentum gab es, wenn man einmal von Waffen, Schilden und persönlichem Schmuck absieht, nach wie vor nicht. Die Kleidung der Germanen bestand, wie in den letzten Jahren Ausgrabungen von Moorleichen zeigten, hauptsächlich aus gewebten und oftmals auch bunt gemusterten Stoffen. Felle und Leder wurden ebenso weiterhin verwendet.
Kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen, so traten die Germanen in Sippen- oder Stammesverbänden auf. Diese hatten sogar Bestand, wenn sie für die Römer in einer Auxiliareinheit (Hilfstruppe) kämpften. Bei wichtigen Ereignissen, wie zum Beispiel Eheschließungen oder auch Gerichtsverhandlungen, waren alle Sippenangehörigen anwesend. Die Frauen der Germanen nahmen eine geachtete Stellung ein. Die Angehörigen einer germanischen Sippe verfügten alle über die gleichen Rechte. Das wenige Eigentum was die Germanen besaßen, wurde, wenn es nicht als Grabbeigabe Verwendung fand, vom Vater auf den Sohn vererbt. Das änderte sich auch nicht, als privates Eigentum mehr und mehr zur Regel wurde.
Der sich herausbildende Sippen- und Stammesadel beanspruchte die besten Ackerflächen für sich. Da sie diese von Kriegsgefangenen oder Knechten bearbeiten ließen, konnten sie sich verstärkt dem Kriegshandwerk widmen, was schließlich ihre Hauptbeschäftigung ausmachte. Die reicheren Erträge ihrer Böden versetzten sie in die Lage, sich mit Gefolgsleuten zu umgeben, wodurch sie wiederum ihre Macht vergrößern konnten. Später ging aus der Mitte dieses Kriegsadels ein Stammesfürst hervor. Alle wichtigen Angelegenheiten wurden aber weiterhin in der Vollversammlung des Stammes, dem „Thing“, besprochen. Auch die Entscheidung über Krieg und Frieden wurde hier gefällt. Beim „Thing“ verkündeten die militärischen Führer oder die Adligen ihre Meinung, während die einfachen Stammesangehörigen ihre Zustimmung oder Ablehnung mittels Zuruf oder dem Aneinanderschlagen der Waffen zum Ausdruck brachten.
Der „Thing“ galt auch als oberstes Gericht. Hier konnte man Klage erheben. Hier wurde Recht gesprochen und wurden Entscheidungen über Leben und Tod gefällt. Das größte Verbrechen, was ein Germane begehen konnte, war Feigheit vor dem Feind und Verrat durch Überlauf. Während Überläufer kurzerhand aufgehängt wurden, bestrafte man Feiglinge durch Versenken im Sumpf. Diese beiden Vergehen waren aber die einzigen, auf welchen die Todesstrafe stand. Alle anderen Sünden, Mord und Totschlag eingeschlossen, konnten durch Bußzahlungen, vor allem durch Abgabe von Pferden und anderem Vieh, gesühnt werden.