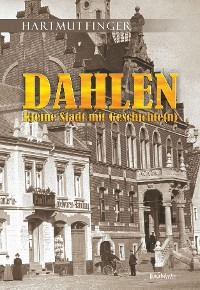Kitabı oku: «Dahlen - Kleine Stadt mit Geschichte(n)», sayfa 3
Auch die Germanen glaubten, so wie alle Völker, die nicht einem Monotheismus huldigten, an vielerlei Götter. So gab es für Naturgewalten, denen sie sich ausgeliefert sahen, einen „zuständigen“ Verantwortlichen = Gott. Freya oder Frigga (Freitag) war die Mutter- und Fruchtbarkeitsgöttin. Wotan (Odin) war der Gott des Sturmes und Donar der Gott des Donners (Donnerstag). Die zuständige Göttin des Feuers hieß Loki, während Baldur als Sommergott angebetet wurde. Besondere Zuwendung dürfte auch die Göttin des Frühlings und der Liebe, Ostara (Ostern), erfahren haben. So könnten wir die Namen der germanischen Gottheiten noch weiter fortsetzen. Ihren Göttern opferten sie vor allem Nahrungsmittel, die sie ihnen zumeist in Sümpfen oder Seen, aber auch heiligen Hainen darbrachten.
Der Zerfall der Gentilgesellschaft und die Herausbildung eines Adelsstandes brachte aber auch im Glauben der Germanen Änderungen. Wenn die Menschen jetzt einen Herren hatten, mussten die Götter ebenso einen Übergott haben. So bildete sich zum Beispiel der Wotanskult heraus.
Der Totenkult der Germanen ähnelte in gewisser Weise dem der Römer. Sie verbrannten ihre Toten auf dem Scheiterhaufen. Gehörte der Verstorbene zu den Privilegierten, der zu Lebzeiten sogar ein Pferd besaß, so wurde dieses mit begraben. Die Asche des Verblichenen kam in eine Urne, die man zusammen mit den Waffen, dem Schmuck und anderen Gegenständen aus dem Besitz des Toten beisetzte.
Diese Zeit, in der sich die germanischen Stämme im jetzigen Deutschland gewissermaßen eingerichtet hatten, sollte jedoch ein jähes Ende finden. Es sollte sogar soweit kommen, dass faktisch beinahe alle Völker Ost-, Mittel- und Westeuropas in Bewegung gerieten. Hervorgerufen durch ein Volk, das bis dahin keiner auf der Rechnung hatte, ja welches bis dahin noch nicht einmal dem Namen nach bekannt war. Diese Eindringlinge kamen auf ihren Pferden so schnell, dass sie ihrem Ruf vorauseilten. Die im Jahr 375 durch sie ausgelöste Wanderungsbewegung führte letztendlich auch zum Ende des Römischen Reiches3 Dieses war zu dieser Zeit auf Grund seiner inneren Widersprüche sehr stark geschwächt und dadurch kaum noch wehrfähig.
Die slawische Besiedlung
Es waren die Hunnen, die im 4. Jahrhundert aus den Steppen Asiens heranpreschten und in die Gebiete der Slawen und Germanen einfielen. Man geht heute davon aus, dass dies eine Kettenreaktion von umfangreichen Wanderungsbewegungen der verschiedensten Völker nach Westen und Süden auslöste, wovon auch die germanischen Stämme unserer Heimat erfasst wurden. Hier gab es allerdings das Problem, dass die germanischen Siedlungsgebiete im Norden durch Nord- und Ostsee und im Westen und Süden durch das Römische Reich begrenzt wurden. Es sollte sich jedoch zeigen, dass das inzwischen stark geschwächte Römische Reich nicht mehr in der Lage war, seine Grenzen gegen diesen Wanderungsdruck zu verteidigen. Zahlreiche germanische Stämme überschritten Rhein und Donau und suchten sich neue Siedlungsgebiete.
Einer der Stämme, die Vandalen (bisheriges Siedlungsgebiet zwischen Oder und Weichsel), zog durch Frankreich und Spanien bis nach Nordafrika, wo er ein Königreich gründete. Der Stamm der Westgoten, der bisher in Gebieten der heutigen Länder Bulgarien und Rumänien siedelte, wanderte nach Gallien und auf die iberische Halbinsel. Auf ihrem Weg nach Westeuropa eroberten sie unter ihrem König Alarich (*um 370-410) im Jahr 410 die Stadt Rom und leiteten damit endgültig den Schlussakkord für das Ende des Weströmischen Reiches ein. Ein anderer germanischer Stamm, die Langobarden, zog die Elbe stromaufwärts, dann weiter südlich über die Alpen. Im Jahr 568 fielen sie in Italien ein und eroberten große Teile Ober- und Mittelitaliens unter der Führung ihres Königs Alboin (*vor 526-573) und gründeten dort ein Königreich. Der zu dieser Zeit dahinsiechende weströmische Sklavenhalterstaat erhielt letztendlich durch den Einfall der Langobarden den Todesstoß. An das Königreich der Langobarden erinnert uns noch heute die italienische Landschaft „Lombardei“ (heißt übertragen „Langbärte“, was wohl an die damals übliche Zier in den Gesichtern der germanischen Männer erinnert). Das Ergebnis dieser heftigen Wanderungsbewegungen war eine nur noch schwache germanische Besiedlung in unserer Region.
Dennoch kam es nun erstmals zur Herausbildung eines germanischen Reiches im Osten des späteren Deutschlands. Um das Jahr 400 gründeten die Thüringer (Hermunduren) ihr eigenes Reich. Es erstreckte sich über das Gebiet von Werra, Saale/Unstrut und Elbe bis nach Meißen und das Dresdner Elbtal. Damit war auch unser Gebiet Teil dieses Reiches.
Zur gleichen Zeit bildete sich im Westen das Frankenreich heraus, während sich im Nordosten, etwa dem jetzigen Niedersachsen, eine Reihe von germanischen Stämmen zum Stammesverband der Sachsen zusammenschlossen.
Im Jahr 531 zerschlugen die Franken und die Sachsen gemeinsam das Thüringer Reich. Die Franken hatten danach das Gebiet der Thüringer bis etwa zur Saale ihrem Territorium einverleibt, während die in unserer Gegend lebenden Stämme sich selbst überlassen wurden. Allerdings war die Siedlungsdichte im Raum von Mulde und Elbe sehr gering.
In die von den Germanen schwach besiedelte Region östlich der Elbe-Saale-Linie kamen im 7. Jahrhundert in mehreren Wellen slawische Einwanderer aus dem Süden über Ungarn und Böhmen, deren Wanderung wiederum durch ein asiatisches Reitervolk (Awaren) ausgelöst wurde. Die Besiedlung durch die Slawen erfolgte zunächst entlang der Flüsse und breitete sich erst danach in der Fläche aus, wobei hier zuerst die waldfreien Gebiete bevorzugt wurden. In späteren Zeiten gab es noch eine slawische Einwanderung vom Osten her über Schlesien.
Die Besiedlung unserer Landschaft durch die Slawen war keine Eroberung. Sie glich eher einer friedlichen Landnahme, da hier bei deren Einzug nur noch wenige germanische Einwohner lebten. Nur im Raum Riesa wurde beiderseits der Elbe für diese Zeit eine stärkere Besiedlung von Germanen nachgewiesen. Die wenigen hier verbliebenen Angehörigen germanischer Völker sind offensichtlich in der zahlreicheren slawischen Bevölkerung aufgegangen. Das könnte eine Erklärung dafür sein, dass sich viele germanische Begriffe im slawischen Sprachgebrauch wiederfinden. Die Lebensformen der Slawen waren denen der germanischen Stämme ähnlich. Aus den Slawen, welche an Elbe und Mulde mit dem Kerngebiet „Lommatzscher Pflege“ siedelten, bildete sich später der Stamm der Daleminzier heraus. Unser Gebiet um die Dahlener Heide blieb aber zunächst unbesiedelt.
Der Geschichtsschreiber Fredegar berichtete im 7. Jahrhundert, dass die Landnahme zwischen Saale/Elbe und Oder anfangs in Abhängigkeit vom fränkischen Reich erfolgte. Diese Abhängigkeit ging erst mit der Gründung des Reiches des Fürsten Samo (um 600/623–658) verloren. Die slawischen Stammesverbände gliederten sich in zahlreiche Supanien (Sippen). An der Spitze einer Supanie stand der Sippenälteste, Supan oder Starort genannt.
In jener Zeit fand der Siedlungsraum zwischen Saale/Elbe und Oder erstmals durch Erwähnungen in überwiegend fränkischen Urkunden und Verträgen Eingang in die Geschichte. In ihnen wird dieses Territorium als von Slawen bewohntes Gebiet bezeichnet. In den fränkischen Reichsannalen jener Zeit werden alle Slawenstämme von der Saale ostwärts bis zur Elbe als „Sorben“ benannt. Das slawische Wort Sorbe bedeutet „Verwandter“ bzw. „Verbündeter“. Schon bald aber taucht daneben der Stammes- bzw. Völkerschaftsname „Dalamince“ auf.
Wenngleich die Slawenstämme allgemein als Sorben bezeichnet wurden, so bildeten diese doch keine völkische Einheit. Die westlichsten und zugleich dominierenden Stämme bei der Besiedlung unseres Gebietes sind die sorbischen Stämme Daleminzier, Nisani (Dresdner Elbtal), Milzani (Oberlausitz), Luzizer (Niederlausitz) und Nelletizi (Wurzener Gegend).

Nach Reinhard Spehr ist die Dahlener Heide kein Siedlungsgebiet der Daleminzier, wie man hier deutlich sieht.
Die in unser Gebiet eingewanderten Slawen waren Bauern mit reichen Erfahrungen im Ackerbau, in der Viehhaltung, in Jagd und Fischfang. Sie führten praktische Tätigkeiten aus wie die Eisengewinnung, das Schmiedehandwerk, die Töpferei oder Herstellung von Textilien. Besonders entwickelt war die Verarbeitung von Holz, was durch den hiesigen Waldreichtum gefördert wurde. So gab es Holzfäller, Böttcher, Wagenbauer, Zimmerleute, Stellmacher, Tischler oder auch Drechsler. Die slawische Kultur war eine regelrechte „Holzkultur“.
Die Slawen wohnten in kleinen Dörfern, die nur eine geringe Zahl von Gehöften aufwiesen und keine regelmäßige Anlage zeigten. Zu diesen Dörfern gehörte eine kleine Feldflur, die nur in geringem Maße dem Anbau von Feldfrüchten diente und in ältesten Zeiten vor allem als Viehweide diente. Genau so unregelmäßig wie die Siedlung angelegt war – eine Dorfform, die wir als Bauernweiler bezeichnen – so unregelmäßig war auch die Feldform.
Die slawischen Sippen selbst gliederten sich wiederum in Großfamilien. In einzelnen Gebieten gab es in Nähe ihrer Ansiedlungen Fluchtburgen. Im 9. Jahrhundert begannen die Sippen mit der Errichtung von Adelsburgen, wie sich die slawische Landesorganisation überhaupt auf Burgen gründete, die uns zum Teil heute noch als alte Wallanlagen erhalten sind und fälschlicherweise im Volksmund oft als Schweden-, Hussiten- oder Heidenschanzen bezeichnet werden. Diese Burgen waren als Sumpf- oder Höhenburgen angelegt und von einem Erdwall umgeben, der meist durch einen Palisadenzaun zusätzlich befestigt war. Oft wurden diese Burgen durch einen Wassergraben von 4 bis 5 Metern Breite geschützt. Diese Befestigungen wurden zur Abwehr von Feinden erbaut und dienten der Bevölkerung in Kriegszeiten als Zufluchtsort. Sie waren ursprünglich kein Sitz von Feudalherren oder Adeligen.

Slawische Spinnwirtel aus Keramik
(Heimatmuseum Dahlen)

Handspindel
(Heimatmuseum Dahlen)
Im Mittelpunkt des Daleminzierlandes lag vor rund 1000 Jahren die Stammesfeste „Gana“. Diese wird gegenwärtig von den meisten Historikern südlich von Oschatz, in der Nähe der Gemeinde Hof, lokalisiert, nachdem dort umfangreiche Ausgrabungen stattgefunden haben. Untermauert wird diese Annahme noch durch einen Bericht des arabischen Kaufmanns Ibrahim ibn Jaqub, der 963 mit einer Gesandtschaft aus dem muslimischen Spanien in Merseburg am Hofe Kaiser Otto I. (912-973) geweilt haben soll4 und von hier aus durch die Slawengaue nach Prag unterwegs war. In seinem Reisebericht gab er uns ein ziemlich genaues Bild über die slawischen Burgen. Er schreibt wörtlich: „Sie, (d. h. die Slawen) graben ringsherum und schütten die ausgehobene Erde auf, wobei sie mit Planken und Pfählen nach Art der Bastionen gefertigt wird, bis die Mauer die beabsichtigte Höhe erreicht.“
Die Daleminzier selbst nannten sich „Glomacii“. Dieser Name leitet sich vermutlich vom Namen „Glomuzi“ ab, einem „Wunder wirkender Weiher“ in der Nähe von Lommatzsch bei Dörschwitz und Lautschen, dem ehemaligen Paltzschener See (jetzt verlandet). Hier soll sich der Kultmittelpunkt der Daleminzier befunden haben. Im Begriff „Glomacii“ hat mit hoher Wahrscheinlichkeit der Name des Ortes Lommatzsch seinen Ursprung. Lässt man bei Glomacii den Anfangsbuchstaben weg, haben wir fast schon den Namen Lommatzsch.
Soweit sie noch nicht zum Christentum bekehrt waren, verehrten die Slawen – und damit die Daleminzier – weiterhin ihre Naturgottheiten. Sie opferten ebenso wie die Germanen ihren Göttern in heiligen Hainen, meist Linden- oder Birkenhainen. Einer der Slawengötter heißt Swantewit. Der sehr ähnlich klingende Ortsnamen Schmannewitz als Nachbarort von Dahlen hat allerdings mit dieser Gottheit nichts zu tun.5
Der erste Bericht über die Daleminzier ist uns aus der Zeit Karls des Großen (747-814) überliefert. Hier fanden sie Erwähnung, als Karl der Große einen breitangelegten Feldzug gegen die slawischen Völker vorbereitete. Dazu entsandte er seinen Sohn Karl zu einer militärischen Expedition in das Land der Daleminzier. Deren Fürst Semila unterlag dem Angreifer und wurde zur Überstellung von Geiseln gezwungen. Im Jahr 805 erfolgte ein weiterer Feldzug. Dieser galt vor allem der Sicherung des Handels in Magdeburg. Dabei drangen die Heere der Karolinger6 über die Elbe vor, errichteten am Ostufer der Saale einige feste Burgen und zwangen einen Teil der Sorben, tributpflichtig zu werden. Es gelang den Franken jedoch nicht, die Unterworfenen in ihr Reich einzugliedern.
Slawische Stämme erhoben sich immer wieder gegen die Vorherrschaft der Franken. So kommt es im 9. Jahrhundert vor allem unter Führung mährischer Stämme zur Herausbildung eines „Großmährischen Reiches“. Zahlreiche Fehden innerhalb dieses Reiches führten aber bald zu dessen Zerfall.
Eroberung und Besiedlung durch Sachsen und Franken / Anfänge der Mark Meißen
Die Eroberungspläne der Deutschen wurden meist unter dem Deckmantel der Christianisierung durchgeführt.
Heinrich I. (876-936), der Sachsenherzog, unternahm bereits Feldzüge gegen die Daleminzier, als er noch nicht den Titel eines Königs besaß. Er unterwarf zunächst das Land an der mittleren Mulde. Von hier aus drang er in das Kerngebiet der Daleminzier vor. Der Bischof Thietmar von Merseburg (975-1018), der um die Jahrtausendwende lebte, berichtete in seiner Chronik, dass Heinrich I. die Landschaft „Glomaci“ „mit Feuer und Schwert“ verwüstet habe. Allerdings wurden die Anfangserfolge von Heinrich I. im Jahr 906 durch das Eindringen der Ungarn nach Mitteleuropa wieder zunichte gemacht. Es wird sogar berichtet, dass die Daleminzier die Ungarn zu Hilfe gerufen und ihnen den Weg gewiesen hätten. Heinrich I., der den Ungarn mit ungenügenden Streitkräften entgegengetreten war, musste sich in die Burg Püchau an der Mulde bei Wurzen zurückziehen und fand dort Schutz, wofür er den Burgleuten, wie es in der Chronik heißt, „Gnadenbeweise“ gewährte. Damit war die Vorherrschaft der Deutschen im Lande der Daleminzier erst einmal abgewehrt.

König Heinrich I., auch Heinrich der Vogler. Der sächsische Herzog Heinrich wird 919 in Fritzlar zum deutschen König gewählt. Er gilt als Begründer des Deutschen Reiches.
Nach seiner Wahl zum deutschen König im Jahr 919 unternahm Heinrich I. einen neuen Versuch, seinen Machtbereich durch die Unterwerfung die Slawen östlich von Saale und Elbe zu erweitern. So berichtet der Chronist Widukind von Corvey (925-973) über diesen Feldzug Heinrichs gegen die Slawen: „Im Spätsommer 928 zog Heinrich von Magdeburg her gegen den Stamm der Heveller. Doch erst der Frost machte ihm den Zugang zu der im sumpfigen Gelände liegenden Festung Brennabor (Brandenburg) möglich.“ Es bleibt unklar, ob Heinrich seinem Heer zunächst eine Ruhepause gönnte oder sofort weiter nach Süden vordrang. Man nimmt an, dass die entscheidenden Kämpfe mit den Daleminziern im Winter 928/929 stattfanden. Die Slawen zogen sich in ihre Stammfeste Gana zurück. Diese Feste konnte von Heinrich I. erst nach 20tägiger Belagerung eingenommen werden. Widukind schreibt darüber, dass Heinrich die Feste nach der Eroberung seinen Kriegern zur Plünderung überließ und alle Erwachsenen, vor allem alle Männer, töten ließ. Die Knaben und Mädchen wurden als Sklaven weggeführt. Er schreibt – üblicherweise auf Latein:
„Cennque illa urbe (gemeint ist Brennabor) potitus omnem regionem, sigma vertit contra Dalamontiam, adversus quam iam olim religuit li Gana, vicessima tandem di cepit eam. Preda urbis militibus tradita, puberes omnes interfedi, pueri ac puelae coptivitati servotae. Post haec Pragam adiit (…)”
Das heißt in etwa: „Und nachdem Cenn (?) diese Stadt (Brandenburg) eingenommen hatte, zog er gegen Gana, die er einst zurückließ, diese nahm er am zwanzigsten Tag ein. Nachdem er die Beute der Stadt an die Soldaten verteilt hatte, tötete er alle Erwachsenen, Knaben und Mädchen wurden der Gefangenschaft anvertraut (sie wurden versklavt). Danach ging er. Er zog nach Prag.” Mit „Cenn” ist vermutlich Heinrich I. gemeint. Sicher ist das jedoch nicht.
Nach Abschluss des Feldzuges gegen die Daleminzier ließ Heinrich I. noch im Jahr 929/30 zur Sicherung des eroberten Gebietes hoch über der Elbe auf einem Felssporn eine Burg errichten. Sie war der Ursprung der späteren Stadt Meißen. In den Jahren danach wurden weitere Festungswerke entlang der Elbe (Burg auf den Spitzhäusern bei Zehren, Althirschstein bei Boritz und Strehla-Görzig) zur Sicherung des Gebietes errichtet. Gleichzeitig sollten von diesen Burgen aus weitere Eroberungszüge in slawisches Gebiet erfolgen. Andere benachbarte Slawenstämme versuchten dem Schicksal der Daleminzier zu entgehen, indem sie erbitterten Widerstand leisteten. Letztendlich aber unterlagen sie der militärischen Übermacht der Deutschen. Heinrichs I. Nachfolger, Otto I. (912-973), setzte diese Politik rigoros fort. Im Ergebnis dieser Eroberungen wurden zwei große Marken geschaffen.

So ähnlich, wie die in Raddusch (bei Vetschau) rekonstruierte Slawenburg, könnte auch die Feste Gana ausgesehen haben.
Die Ostmark, die das Gebiet von Brandenburg bis zum heutigen Erzgebirge erfasst, wurde ab 937 als Mark Meißen vom Markgraf Gero (um 900-965) regiert. Über ihn berichtet uns der Chronist Widukind, dass er falsch und verschlagen gewesen sei und ihm jedes Mittel recht war, die Slawen zu unterwerfen. Unter anderem schreibt er, „indem er fasst 30 Fürsten der Barbaren die bei einem Gelage geschwelgt hatten und vom Wein betrunken waren, in einer Nacht erschlug“. Dieses hinterhältige Massaker an den slawischen Fürsten soll sich in der Burg „Alten-Salzwedel“ zugetragen haben.
Die Ostmark wurde nach dem Tode Geros in die Marken Meißen und Lausitz aufgeteilt. Letztere wurde im Westen von Elbe und Saale und im Osten von Oder und Neiße begrenzt. Dahlen und Umgebung aber waren zunächst Königsland.
Das Land musste auf Verteidigung und Abwehr eingestellt werden. Dazu teilte man es in Burgwarde ein. Das sind einer Burg unterstellte Landgebiete. Die Anlage dieser Burgwarde richtete sich häufig nach der slawischen Verwaltungsstruktur. Oft begegnen uns ehemalige Supansitze wieder als Burgwarde, so auch der Burgward „ad Ganam“. Die Mark Meißen wurde in 14 (?) Burgwardbezirke aufgeteilt, deren Burgwarde sich fast ausnahmslos an Flussläufen befanden. Zur Absicherung des Landes und zur Kontrolle der alten Handelswege wurden einige Burgen auch in unbesiedeltem Land errichtet. Die Besatzungen der Wallanlagen sowie die übrigen Bewohner waren Slawen, die unter deutscher Herrschaft angesiedelt wurden und in deutschen Diensten standen. Ein Ergebnis dieser Politik war die Errichtung der Wallanlage auf dem Burgberg Dahlen, aber auch die Wallanlage auf dem Collm. Zur Versorgung der Burg entstand am Fuße des Burgberges Dahlen die Siedlung Zissen. Dies beweisen Scherbenfunde am und vom Burgberg sowie nördlich der Graumühle, die ins 10. Jahrhundert gehören.
Die Wallanlage auf dem Burgberg Dahlen diente vor allem der Kontrolle der alten Salzstraße. Diese führte aus Richtung Halle kommend, nördlich an Leipzig vorbei, passierte dann bei Püchau die Mulde und verlief weiter über Meltewitz und Schwarzer Kater nach Dahlen. Von hier ging es in Richtung Lampertswalde über den Liebschützberg nach Strehla, wo man durch eine Furt die Elbe durchquerte, um sich weiter in Richtung Osten zu bewegen. Von diesem Handelsweg zweigte am Töpferplatz in Dahlen ein Weg ab, der über die Holzstraße nach Belgern führte.
Auf dem Dahlener Burgberg ist heute immer noch deutlich die ovale Ringwallanlage zu erkennen, deren Längsachse sich parallel zum Lauf der Dahle zieht und die sich auf dem Flussschotter-Untergrund der Dahleterrasse erhebt. Der heutige Weg führt zum Teil auf der Wallkrone entlang. An den steileren Hängen der Bachseite war sie weniger hoch aufgeschüttet als an der dem flachen Hinterland zugekehrten Seite. Der größte Teil der aufgeworfenen Erde wurde in den letzten Jahrhunderten abgetragen. Genauere Erkenntnisse über den Dahlener Burgberg können nur Ausgrabungen bringen, die bisher nicht durchgeführt wurden. Die gesamte Anlage des Burgberges steht heute unter Denkmalschutz.

Der Burgberg von Dahlen
Zum Ende des 10. und Anfang des 11. Jahrhunderts war die Zentralgewalt des Deutschen Reiches nachhaltig geschwächt. Der deutsche König Otto III. war im Jahr 1002 gestorben, ohne einen Nachfolger zu hinterlassen. Dieses Machtvakuum nutzte der spätere König der Polen, Boleslav I. „der Kühne“ (auch Chroby genannt, 965/967-1025). Noch im selben Jahr begann er von seinem im jetzigen Polen liegenden Reich aus einen Feldzug, um Gebiete der Westslawen zu erobern. Es gibt schriftliche Überlieferungen, aus denen hervorgeht, dass die polnischen Eroberer einen großen Teil der Daleminzier aussiedelten und nach dem Osten verschleppten. Auch Bewohner aus der Umgebung des späteren Dahlen sollen „mit Feuer und Schwert“ als Gefangene nach Polen geführt worden sein. Bei diesem Feldzug wurden unter anderem Belgern und Strehla verwüstet.
Im 11. Jahrhundert kam es im Gau Daleminzien zu einem stärkeren Bevölkerungszuwachs. Damit einhergehend wurden zahlreiche neue Ortschaften durch Waldrodungen gegründet. Ein Beispiel dafür ist der Ort Stolpen (jetzt Wüstung), der südwestlich von Börln, am jetzigen Stolpenteich lag. Anhand von Scherbenfunden konnte nachgewiesen werden, dass Stolpen vom 11. bis 14. Jahrhundert bestanden hat. So hat es vermutlich noch weitere Orte gegeben, für die der archäologische Nachweis aber bisher noch nicht erbracht werden konnte.
König Heinrich IV. (1050-1106) schenkte das Gebiet von Dahlen, im Gau „Talmence“ (Daleminze) gelegen, als Teil des Burgwardes Strehla zusammen mit Boritz, 1065 dem Bistum Naumburg. Die späteren Amtshauptmannstädte Oschatz und Grimma wurden im Zuge dieser Neuordnung ebenfalls dem Bistum Naumburg übereignet.
1106 leitete Wiprecht von Groitzsch (bei Borna) den deutschen Landesausbau im Osten ein. Dieser Prozess entwickelte sich vor allem ab Mitte des 12. Jahrhunderts und führte zwischen Saale und Elbe zu einer größeren Siedlungsbewegung. Aus den inzwischen stark bevölkerten (vor allem Franken und Sachsen, auch Flamen) Teilen Deutschlands siedelten sich nun viele neue Bewohner an. Bei dieser Kolonisation wurden auch slawische Zuwanderer aus Gebieten mit einer höheren Bevölkerungsdichte angesiedelt. Deshalb wurde Wald gerodet, um neue Ortschaften zu gründen. Das zeigt eine große Anzahl von Flur- und Ortsnamen, deren Ursprünge auf slawische Siedler während der Zeit des frühdeutschen Landesausbaues zurückzuführen sind. Die Zuwanderer wurden entweder mit geringen oder einer befristeten Befreiung von Steuern und Abgaben angelockt. In dieser Phase der Entwicklung wurden die Siedlungsstrukturen in der Mark Meißen geschaffen, wie wir sie auch heute noch vorfinden. Ursprünglich existierten eine ganze Reihe weiterer Siedlungen bzw. Dörfer, welche aber deren Bewohner in späteren Jahrhunderten, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, wieder aufließen. So auch einige Orte in der Dahlener Heide.
Die neuen Bewohner brachten aus ihrer alten Heimat ein umfangreiches Wissen bei der Entwässerung von Feuchtgebieten sowie der Regulierung von Gräben und Bächen mit. Die überwiegende Mehrheit der jetzt noch zahlreich vorhandenen Teiche in der Dahlener Heide wurden bereits in dieser Zeit angelegt. Sie waren für einen regulären Mühlenbetrieb ebenso notwendig wie für die Versorgung mit Fisch, zu jener Zeit einer der wichtigsten Eiweißlieferanten.
Obwohl hier die Slawen vermutlich die Mehrheit stellten, setzte sich nach und nach die deutsche Sprache durch. Es gibt allerdings Hinweise auf einzelne abseits bzw. etwas isoliert liegende Orte in der Dahlener Heide, in denen die sorbische Sprache noch viele Jahrhunderte im täglichen Umgang eine Rolle spielte.
Im Jahr 1424 wurde schließlich im Meißner Land der amtliche Gebrauch der wendischen (sorbischen) Sprache verboten. Dennoch haben die Slawen ihre sprachlichen Spuren bei uns hinterlassen.
Bei der viel geringeren Bevölkerungsdichte der damaligen Zeit ist aber nicht anzunehmen, dass jedes Dorf mit slawischem Ortsnamen auch von Slawen gegründet oder bewohnt wurde. Die schon vorhandenen slawischen Flurnamen wurden von den deutschen Siedlern übernommen, so dass heute viel mehr slawische Ortsnamen vorhanden sind, als ehedem Dörfer im Gau Daleminzien bestanden. Dass Slawen und Deutsche nebeneinander gelebt haben, zeigen auch solche Orte wie Luppa, wo noch heute zwei Ortskerne erkennbar sind. Die Kirche bildete das Zentrum für Deutsch-Luppa, während sich der Mittelpunkt von Wendisch-Luppa (wendisch=sorbisch) an der heutigen Bundesstraße befindet. Diese Bezeichnungen verwenden auch gegenwärtig noch einige Luppaer.
Wenngleich der amtliche Gebrauch der sorbischen/wendischen Sprache verboten wurde, so war diese Sprache längst nicht aus dem Alltag verschwunden. Noch heute sind zahlreiche Vokabeln mit sorbischer Herkunft in Anwendung. So hört man hier und da noch den Begriff Buwerzche für ein schlechtes Bett oder Lager. Einen miesen Rock nennt man Kittel (sorbisch kitel), ein paar schlechte Schuhe Latschen (von hlačiče = Strümpfe) und einen ungeschickten Menschen Platsch. Ein altes Weib wird auch heute noch oft als Bäbe (baba) bezeichnet. Wenn jemand schlecht Luft bekommt, sagt er häufig, dass er es auf der Plauze hat und meint damit die Lunge (pluco). Die meisten noch verwendeten sorbischen Begriffe finden wir heute im landwirtschaftlichen Bereich.

Quelle: Topographischer Atlas des Königreiches Sachsen 1847, Reproduktion E. Lange
So haben wir Tierbezeichnungen wie Basch für Schwein, Kunz für Eber, Mutsche für Kuh (muča), Putte für Huhn, Bielchen für Gänschen (pilo) oder auch Husche für Gans (huso). Das, was die Tiere hinterlassen, die Jauche, ist ebenso slawischen Ursprungs. Die in der Dreifelderwirtschaft übliche Brache hat ihren Ursprung im sorbischen Wort prahnu für trocken. Der zweite Grasschnitt, das Grummt, wurde in der Regel am Hieronymustag (wendisch growmus) gemacht. Auch die Peitsche (bič), Krietschel oder Krietscher für schlechtes Obst sowie der Plinsen (blinč) haben slawischen Ursprung. In der Milchwirtschaft kommen die Begriffe wie Schlickermilch und Quark, mundartlich bei uns „Quarch“ gesprochen, zu uns. Aus Quarch entwickelte sich der Querchel für einen langen Käse. Ist der Hausfrau beim Backen etwas misslungen, so ist daraus Kluntsch geworden. Zu essen gab es oft Mauke (muka = Mehlbrei). Beim Hausrat sollen hier der Bähnert für den Flechtkorb und die Hitsche für eine niedrige Bank genannt werden. Kleine Kinder legt man auch heute noch in die Haia schlafen und gibt ihnen zur Beruhigung einen Lutsch, Nuppel oder Zulp, nachdem man sie gründlich verhätschelt (hejčkam) hat. Wenn das Kind etwas größer ist, darf es sein Patschhändchen geben, während es schon einige Worte nuschelt. Sind die Sprößlinge noch größer und treiben Unfug, so wird ihnen gedroht: „Euch soll gleich der Popanz (popodač = Räuber) holen!“ In manchem Haus poltert auch heute noch ein Kobold (kubolčik) herum. Abends trafen sich die Männer öfter mal beim „Kretschmer“. So nannten die Sorben einen Schankwirt, und man kann davon ausgehen, dass die vielen Familien in unserer Gegend mit diesem Nachnamen sorbische Vorfahren mit eben diesem Beruf haben. Es gibt in unserem heutigen Sprachgebrauch noch wesentlich mehr Begriffe, die auf sorbischen bzw. slawischen Ursprung zurückgehen. Die vorgenommene Aufzählung nennt nur einige Beispiele.
Quellen und Literaturverzeichnis
1. Radig, Werner: „Der Burgberg Meißen und der Slawengau Daleminzien“, erschienen 1929 bei Bruno Filser, Augsburg.
2. Näther, A.: „Der Collm. Kurze Beschreibung des Berges und seiner Aussicht“, erschienen 1901 bei Fr. Oldesop´s Erben, Oschatz.
3. Lippert, Waldemar: „Meißnisch-Sächsische Forschungen“, erschienen 1929 bei W. und B. v. Baeusch Stiftung.
4. Ruppel, H. Gotthelf: „Aus Strehlas vergangenen Tagen“, erschienen 1936 bei Georg Luck Nachfahren, Strehla.
5. Kleber, Julius: „Chronik der Stadt Strehla und Umgegend“, erschienen 1909 bei Robert Noske, Borna und Leipzig.
6. Eichler, Dr. Ernst: „Historisches Ortsnamensbuch von Sachsen“, Akademie Verlag Berlin, 2002.
7. Landesamt für Archäologie: „archäologie aktuell im Freistaat Sachsen“, 1/1993.
8. 8. Mutzsch-Reichenbach, Carl v.: „Die interessanten alten Schlösser und Burgen Sachsens“, erschienen 1940 bei Wilhelm Baeusch, Dresden.
9. Buchwald, D. Georg: „Neue sächsische Kirchengalerie. Ephorie Oschatz“, erschienen 1901 bei Arved Strauch, Leipzig.
10. Festschrift zur 700-Jahrfeier der Stadt Dahlen, erschienen 1928 bei F. Irrgang, Dahlen.
11. Lepsius, C. P.: „Geschichte der Bischöfe des Hochadels Naumburg“, erschienen 1846 bei Franz Littfas, Naumburg.
12. Ericson, Cecilia, Cand. Phil.: Landesamt für Archäologie Dresden / Die Ausgrabung auf dem Weinberg.
13. Ericson, Cecilia (Landesamt für Archäologie Sachsen): „Häuser der Lausitzer Kultur in Dahlen“, „archäologie aktuell“, 5/1997.
14. Publius Cornelius Tacitus: „Germania“, Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, 1982.
15. Reinhardt Butz / Werner Folde: „Mein Sachsen lob` ich mir“, Volk und Wissen Verlag GmbH 1993.
16. Landesamt für Denkmalpflege Sachsen: „Historische Bauforschung in Sachsen“, Arbeitsheft 4, Dresden 2000.
17. Ruth Pfeiffer/Peter Haferstroh: „Das Rätsel der Hügelgräber“, Die Dahlener Heide – Ein kulturhistorischer Touristenführer; Verein „Dörfliche Kulturentwicklung in Sachsen e. V.“.